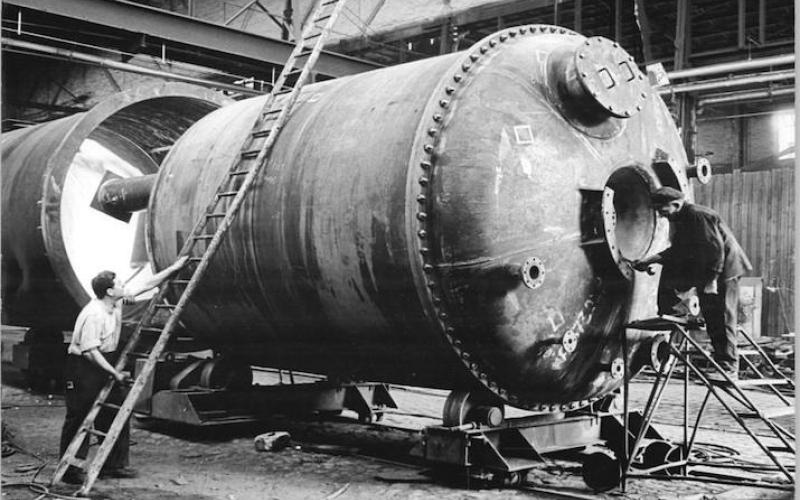Mit der Ausstellung Arbeit. Sinn und Sorge endet das Programm Arbeit in Zukunft im Sommer 2009. Seit 2006 sind mehrere umfangreiche Projekte zum Wandel der Arbeitsgesellschaft im Auftrag der Kulturstiftung des Bundes durchgeführt und inzwischen abgeschlossen worden. Der Kurzfilmwettbewerb Mach doch, was du willst, die vielen Filmreihen und –festivals Work in Progress, das Literaturprojekt Schicht! Arbeitsreportagen für die Endzeit und das Jugendprojekt Der 100.000 Euro Job. Außerdem konnten Fördergelder aus dem Fonds für unabhängige Projekte aus allen Sparten beantragt werden. Wir haben die Kritikerin Petra Kohse gebeten, das Programm noch einmal Revue passieren zu lassen und ihre Eindrücke aus der Jetztzeit zu schildern: Welche Vorstellungen vom Wandel der Arbeitsgesellschaft haben sich in den Projekten niedergeschlagen und wie sind sie vor dem Hintergrund der weitgehend unerwarteten Entwicklungen des letzten Jahres zu beurteilen?
Berlin, im Januar 2009. Rund um das Kulturzentrum Saalbau in der Neuköllner Karl-Marx-Straße drängen sich die Billigläden. Bei Garbelli gibt es neonfarbene Polyester-Handschuhe für einen Euro, bei Preisfuchs Staubsauger für neunzehn. »Los komm, gucken kostet nichts«, sagt eine ältere Frau vor der T€di-Filiale und zieht ihre Bekannte ins Innere, wo Windjacken für Hunde, Plastikgestecke und Stimmungsleuchten angeboten werden — ein groteskes Sortiment für jene, die beim Einkaufen genau wissen, wie viel Geld sie in der Tasche haben und trotzdem den Luxus genießen sollen, sich Überflüssiges zu leisten. Wer noch Anschluss an den Warenfluss hat, braucht sich vor dem Kapitalismus nicht zu schämen.
Auch die Straßengalerie des Saalbaus selbst bietet seit einigen Wochen ein volles Schaufenster. Plastiktröten, Badetiere und die Stoff-Ausführung der Maulwurfsfigur von Zdeněk Miler nehmen die Schwellenangst beim Eintritt in den Bereich der Kultur. »Vor Weihnachten hatten wir einen wahren Massenandrang«, berichtet Antonia Herrscher, die Presse-referentin des von Andreas Wegner kuratierten Projekts Le Grand Magasin. »Allerdings bestand die Laufkundschaft vor allem aus jüngeren Leuten. Eingesessene Neuköllner wollten, wenn sie sich trauten, den Laden zu betreten, meist über das Genossenschaftsmodell sprechen, mit dem viele noch eigene Erfahrungen gemacht haben.«
Le Grand Magasin ist eine Verkaufsausstellung von Waren aus europaweiter genossenschaftlicher Herstellung. Produkte aus Tschechien und der Slowakei, Spanien und Frankreich, Italien und Deutschland wurden in den dreieinhalb Galerieräumen nach dem Solidarprinzip aufgebaut: preisgünstige Lippenstifte neben kostbarem Holzspielzeug, kitschiger Christbaumschmuck gegenüber von Design-Kommoden. An den Wänden finden sich knappe Hinweise auf die jeweiligen Herkünfte der Waren, manchmal auch Fotografien der Produktionsstätten, hie und da ein paar Zahlen. Weiterführende Literatur liegt auf dem Informationstisch. Im Ganzen eher ein — für die jeweiligen Anbieter sicher nützlicher — Appetizer zum Thema genossenschaftliche Arbeit in Europa, stimmt das Grand Magasin allerdings nicht wirklich optimistisch. Denn dass europäische Produkte aus arbeitsplatzgesicherter und mitsprache-berechtigter Herstellung inmitten der T€di- und Preisfuchs-Welt Ausstellungswert haben, leuchtet zwar ein. Aber wird es die Sache der Genossenschaften wirklich befördern, wenn sie damit von der wirtschaftlichen in die kulturelle Zuständigkeit rutscht?
Le Grand Magasin wurde als Antragsprojekt im Programm der Kulturstiftung des Bundes Arbeit in Zukunft gefördert. Und zwar gemeinsam mit einem Dutzend weiterer Projekte, bei denen — so stellt es sich zumindest im recherchierenden Rückblick dar — es nicht so sehr um tatsächliche Zukunftsvorstellungen, sondern im Wesentlichen um Feldforschung und Wirklichkeitssimulation gegangen ist und geht. Ersteres in einem Falle buchstäblich. Denn in dem Hofmaler-Projekt Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben tauschen die Künstler Antje Schiffers und Thomas Sprenger von ihnen gefertigte Ölgemälde von Höfen und Nutzflächen gegen Videos, die die jeweiligen Landwirte über ihren Arbeitsalltag selbst drehen sollen — Greif zur Kamera, Bauer! Seit über acht Jahren sind die beiden in Österreich, den Niederlanden, Wales und deutschen Regionen unterwegs und stellen ihre Kunst in den Dienst einer jeweiligen Repräsentation, während sie die Macht des gesellschaftlich wirksamen Bildes den repräsentierten Individuen selbst überlassen.
Auch in David Levines Bauerntheater , das im Frühjahr 2007 im uckermärkischen Joachimsthal stattfand, zeigte sich, dass die Landwirtschaft als Urform kultureller Tätigkeit eine geeignete Fläche sein könnte, um postmoderne Entfremdung nicht nur darzustellen, sondern womöglich zu überwinden. Ein amerikanischer Schauspieler (David Barlowe), der in New York die Rolle des Flint aus Heiner Müllers Umsiedlerin einstudiert hatte, bestellte knapp vier Wochen lang in Handarbeit ein deutsches Kartoffelfeld. Es sei um die Frage gegangen, wie tief man in eine Rolle schlüpfen und unter welchen Umständen man noch in ihr bleiben könne, erklärt Levine im Begleitbuch — »Kann man als ein anderer arbeiten?« Method acting im Elch-Test. Der Darsteller selbst notierte am letzten Aufführungstag im Tagebuch: »Offen gestanden hat mich der Vorgang des Pflanzens immer mehr interessiert als die Rolle.«
Andere Simulations-Projekte zielten auf stärker gesellschaftlichen Einfluss: Das Hotel Subbotnik der Theaterfabrik Gera vom letzten Herbst etwa: Eine temporäre Umwandlung des seit Jahren leer stehenden »Kaufhauses ›auf der Sorge‹« (so die Adresse) in ein spielerisches Trainingslager für Problemlösungen des echten Arbeits(losen)alltags. Inzwischen ist dieser Kulturraum wieder Wirtschaftsfläche geworden: Das 1822 erbaute Gründerhaus des Hertie-Konzerns wird von der Stadt nun doch nicht aufgegeben, sondern als Kaufhaus Gera neu geplant.
Eine buchstäbliche Zuspitzung des Grenzbereiches von Kunst und Wirklichkeit stellt das — noch andauernde — Projekt Die grosse Pyramide von Ingo Niermann, Jens Thiel, Frauke Finsterwalder und Heiko Holzberger dar. Niermanns Idee, in der Nähe von Dessau eine globale Grab-Pyramide entstehen zu lassen, in deren Steinen Menschen aus der ganzen Welt entweder ihre Asche bestatten oder Erinnerungsstücke einschließen können, ist so kühn und allseits nützlich, dass vermutlich nicht einmal die Beteiligten wissen, ob sie noch an einem Kunstprojekt arbeiten oder längst ein Unternehmen aufbauen. Schon wurde alles in wirtschaftlicher, moralischer und architektonischer Hinsicht gedreht, gewendet und vernetzt. Schon gibt es eine Homepage in zehn Sprachen. Und schon haben sich mehr als 1.500 Menschen aus der ganzen Welt einen Stein reservieren lassen. Noch fließt kein Geld und wird nicht gebaut. Aber so weit, um sagen zu können, dass diese Sache eine Zukunft hat, darf man der Virtualität inzwischen vertrauen — der Internettugend des Ineinanderfließens von Schein und Sein, die die Grenzen des Vorstellbaren in der Gesellschaft definitiv erweitert hat. Als Christoph Schlingensiefs Konzeptpartei Chance 2000 zur Bundestagswahl 1998 zugelassen wurde und sogar 25.000 Stimmen erhielt, war das ein allseits bestaunter Theatercoup. Wer heute auf die Webseiten von thegreatpyramid.org kommt und liest, wie leicht es ist, Vorsorge zu treffen, sich körperlich mit einem Kunstwerk zu verbinden, eine weltumspannende Versöhnungsgeste zu machen, der Wirtschaft zu dienen und dabei sogar noch zu sparen — der wird sich vor allem fragen, warum er nicht selbst auf diese Idee kommen konnte.
Die private Suche nach einfachen Lösungen für viele ist das Gebot der Stunde: Die Banken sind nicht sicher, die Exporte brechen ein, die Auto- und die Chemiebranche liegen darnieder, der Milchmarkt ist prekär, der Kunstmarkt schlapp, aus den USA kommen Reportagen über den nackten Hunger von Millionen, und die eigene Regierung leiht sich was zusammen und schickt Care-Pakete an die Wirtschaft und das Volk. Nur der Kulturstaatsminister ist zuversichtlich und verspricht eine erneute Erhöhung der Kulturausgaben im nächsten Jahr, weil dies (so Bernd Neumann gegenüber dem Börsenblatt des Deutschen Buchhandels in der Ausgabe vom 22. Januar) »keine Subventionen, sondern Investitionen in die Zukunft« seien. Vielleicht sind die Genossenschaften im kulturellen Sektor also doch ganz gut aufgehoben. Und vielleicht macht es Schule, dass Geschäftsideen als Simulationen kulturgefördert werden und im Second Life durchstarten, bevor sie ins ›erste Leben‹ hinübergleiten.
Der Zeitpunkt, die Kultur zur zentralen Sammelstelle der Energien auszurufen, ist jedenfalls günstig. Denn die deutsche Wirtschaft, auf deren zuverlässiges Wachstum sich das Selbstbewusstsein der Nation im letzten halben Jahrhundert ausschließlich gründete, fällt als Projektionsfläche für Selbstentwürfe in die Zukunft derzeit aus. Mit ein wenig Eigeninitiative von Outgesourcten ist es in dieser Krise nicht getan. 20.000 kurzarbeitende Daimler- Mitarbeiter in Sindelfingen können sich nicht als nebenberufliche Dienstleister neu erfinden. Stattdessen werden sie weniger konsumieren und damit eine Abwärtsspirale der ganzen Stadt in Gang setzen. Regionale, überregionale, internationale Lösungen müssen gefunden werden, weil ein Rädchen ins andere greift. Tschüss Ich-AG, willkommen — ja was?
Der Versuch, den Konsum ein klein wenig anzukurbeln, zielt jedenfalls in die falsche Richtung. Soll sich eine Familie mit geringem Einkommen von den im Konjunkturpaket vorgesehenen 100 Euro pro Kind wirklich ein Haushaltsgerät (am besten natürlich in Deutschland gefertigt) kaufen, wenn das Geld ansonsten kaum für den Essenseinkauf beim Discounter reicht? Es geht ja nicht nur um eine Überbrückung, wie die Prognose vom sinkenden Bruttoinlandsprodukt deutlich zeigt. Im Gegenteil: Besser als jetzt wird man es vermutlich lange Zeit nicht haben!
Die Antragsprojekte zum Thema Arbeit in Zukunft machen natürlich nur den kleineren Teil des entsprechenden Programmes aus. Im Laufe der letzten drei Jahre hat die Bundeskulturstiftung auch fünf eigene große Projekte initiiert und koproduziert: Den Kurzfilmwettbewerb Mach doch, was du willst, den Jugendfonds Der 100.000 Euro Job, die Filmreihe Work in Progress, die literarische Anthologie Schicht! Arbeitsreportagen für die Endzeit und — als zeitlich letztes — die Ausstellung Arbeit. Sinn und Sorge im Dresdner Hygiene-Museum, die im Juni eröffnet wird. Auch in der Wahrnehmung dieser Projekte (bzw. ihrer jeweiligen Spuren) lässt sich feststellen, wie sehr sich das kulturelle Lebensgefühl unter dem Einfluss der letzten Herbst/Winter- Saison verändert hat. Die (in Kooperation mit der KurzFilm- Agentur Hamburg entstandene) Kurzfilmrolle Mach doch, was du willst etwa verströmt trotz deutlicher Gegenwartskritik noch eine erstaunliche Zukunftsgewissheit, die sich auf die Initiativ- und Arbeitskraft des Einzelnen gründet.
Die drei Hauptthesen, die sich in den elf Beiträgen finden, sind, dass sich die Existenz über Arbeit definiert, dass Arbeitsbeschaffung und Arbeitsgestaltung selbst in die Hand genommen werden müssen und dass das bestehende System reichlich Absurditäten gebiert, über die man aber immer noch lachen kann. Wie in Peters Prinzip, einem Knetmännchen-Trickfilm von Kathrin Albers und Jim Lacy. Darin wird die Theorie des Soziologen Laurence Peter veranschaulicht, nach der jeder Arbeitnehmer bis zu dem Posten befördert wird, für den er nicht mehr kompetent ist, auf dem er dann aber sein gesamtes restliches Arbeitsleben lang verharrt. Im Film arbeitet ein Krokodil im Schwimmbad erst als Kassierer, dann als Bademeister und wird schließlich Chef einer Schwimmringfabrik, die am Ende in die Luft fliegt.
Von lustiger Deutlichkeit ist auch Waldmeister, ein Beitrag von Markus Mischkowski und Kai Maria Steinkühler. Weil ihnen private Wertstoffsammler die Arbeit wegnehmen, schleppen zwei Ein-Euro-Jobber hier extra Fremdmüll in den Stadtpark, für dessen Säuberung sie zuständig sind. Und Bus von Jens Schillmöller und Lale Nalpanteglo erzählt die Geschichte eines entschlossenen Dienstleistungstrupps, der ohne Auftrag Überflüssiges leistet und dann dreist in Rechnung stellt. Alles gut gelaunte Beiträge, die gerade in ihren Zuspitzungen zeigen, dass alles noch viel schlimmer sein könnte. Pessimistisch zwar hinsichtlich staatlicher Lösungen, aber mit viel Vertrauen in die Pfiffigkeit des Individuums, zumindest selber noch mit heiler Haut davonzukommen.
Auch bei den Schriftstellern stehen das Individuum und die Gesellschaftskritik naturgemäß im Vordergrund. Und so befassen sich gleich fünf der siebzehn (im Suhrkamp Verlag erschienenen) Arbeitsreportagen für die Endzeit mit Aussteiger- oder Individualisierungs-biografien: Juli Zeh schrieb über ein lesbisches Paar aus Berlin, das in Brandenburg mit Pferdepflege und Tauschhandel sein privates Glück findet. Gabriele Goettle besuchte einen ehemaligen Theaterwissenschaftler auf seinem Ziegenhof. Georg Klein hatte mit einem Ex-Punk zu tun, der als esoterisch angehauchter Schandwerker eine Art Mädchen für alles ist. Thomas Kapielski zeigt sich als permanenter Repräsentationsverweigerer. Und Oliver Maria Schmitt porträtiert die nach ihrer Berentung im Sozialdienst tätige Birgit als fitte Alte. Es finden sich in diesem Buch auch je einzelne Beispiele, wie man sich mit veränderten Gegebenheiten arrangiert oder sie für sich nutzt oder welche Arbeitsmoral die Internettätigkeit gebiert. Und in den gesellschaftskritisch orientierten Texten fühlt Bernd Cailloux dem Zukunftsforscher des VW-Werks auf den Zahn, stellt Thomas Raab fest, dass es in der Konsumwirtschaft nicht möglich sei, nicht zu arbeiten (weil man auch als Konsument kapitalistisch tätig sei) oder beschreibt Felix Ensslin die Kaste der politischen Referenten.
Formal ist das zuweilen sehr verspielt, und gleich vier Autoren denken im Rahmen ihrer Reportage auch hörbar (lesbar) über ihre eigene Arbeit nach. Aber diese Verschnörkelung kann auch der etwas mühsamen Rahmenerzählung des Herausgebers Johannes Ullmaier geschuldet sein, derzufolge er von Wesen aus dem Jahr 2440 den Auftrag erhalten habe, »Literaturdichter« zu finden »die uns reportieren«, wie die Welt Anfang des 21. Jahrhunderts eben so aussieht im »Deutschsprachraum«. Trotzdem ist der vorliegende Band bemerkenswert. Er zeigt, aus welchen Weltenfernen sich manche Schriftsteller dem Thema Arbeit in der Konkretion nähern. Und er zeigt, mit welchem Gewinn das geschieht. Erfahrungsgewinn für sie selber. Und Gewinn an gedeuteten Zeichen für den Leser. Für die Lektüre von heute symptomatisch ist, dass sich nur zwei Autoren mit einer ganzen Gruppe von Leuten und dann auch gleich mit ausgemachten Verlierern des Systems beschäftigen: Kathrin Röggla in ihrem Text über Schuldnerberatungen in Los Angeles und in Berlin und Wilhelm Genazino in einem Feuilleton über das Betteln. Wobei ausgerechnet Genazinos Text zu den optimistischsten des Buches zählt, weil er fest davon ausgeht, dass diese Tätigkeit mit angemessener Schulung durchaus ein Erwerbszweig sein könnte.
Von robuster, fast krisensicherer Aktualität erscheinen hingegen die Filmreihe und die Festivals zum Thema Work in Progress: Aus einem von den Freunden der Deutschen Kinemathek in Berlin erstellten Pool von 75 Filmen zum Thema Arbeit haben sich Kinobetreiber aus der gesamten Republik ein auf ihre jeweilige Stadt zugeschnittenes Festival zusammenstellen können. So interessierten in der Medienstadt Köln natürlich ›Filme über das Filmemachen‹, in Sindelfingen die globalisierte Arbeitswelt, in Bad Tölz die Zukunft der Erholung und in Berlin auch der Genderaspekt der Arbeitswelt. Kommunal orientiert und vielfach anwendbar — ein Veranstaltungstyp mit Potential zum Klassiker!
Ein weiteres Projekt, das ganze Gruppen in Bewegung setzte, war der (in Trägerschaft der Leipziger Agentur Visionauten durchgeführte) Selbst-Förderfonds Der 100.000 Euro Job. Hier durften die Antragstellenden (Leute bis 26 Jahre) die Fördergelder in eigener Verantwortung verteilen und dadurch über Güte und Wichtigkeit aller eingereichten Projekte selbst entscheiden. Bundesweit gingen aus dieser 2006 gestarteten Aktion 47 kleine und mittlere Projekte hervor, die ein erster Ansatz für Arbeit waren, Arbeit erleichterten oder thematisierten: Ein Arbeitslosen-streichelzoo auf dem Berliner Alexanderplatz. Ein Film über Ökodörfer. Eine Buttonserie (Galerie am Körper) zum Thema Berufe. Eine Berliner Podcast-Oper für den Weg zur Arbeit. Oder eine Mutmachmaschine in einem Erwerbslosencafé in Pirmasens, bei der kleine Freuden geboten (etwa ein Keks), aber auch bereitet werden mussten (selber einen Keks ausstechen). Für die Projektemacher war das eine »prima Sache«, wie einige von ihnen in einer filmischen Begleitdokumentation sagen. Sie haben das Selbstvertrauen gewonnen, planen und die Planung auch durchführen zu können. Sie haben etwas geschaffen, was ihnen Spaß machte, wobei die Sache selbst tendenziell wichtiger war als das Ergebnis. Eine Mutmachveranstaltung im Ganzen also ganz bestimmt. Aber nicht auch eher ein Streichelzoo für die Generation Praktikum? Denn von welcher Produktionsfirma bekommt die Ökodorffilmerin das nächste Geld? Der Buttonmacher hat seine Idee zumindest in einen 80-Cent-Shop (pro Einzelbutton) im Internet verwandelt, während man sich die Podcast-Oper von Justin Lépany kostenlos herunterladen kann.
Wo kulturelle Leistung immer weiträumiger nur mit Aufmerksamkeit entgolten wird, aber gleichzeitig als Entwicklungslabor der Echtweltunternehmungen immer wichtiger wird, müsste bundeskulturell als Nächstes eigentlich an großflächigen Lösungen zum Überleben ohne Erwerbsarbeit gearbeitet werden. Programmtitelvorschlag: Zukunft im Netzwerk. Oder: Wer Ideen hat, der soll auch essen.
Die Dresdner Ausstellung Arbeit. Sinn und Sorge scheint — siehe das Interview mit Daniel Tyradellis auf S. 12 — durchaus schon in dieser Richtung voranzugehen, wenn sie etwa zeigt, dass bei der Arbeit noch nie allein der Gelderwerb gezählt hat oder dass exakt die gleiche Tätigkeit mal im Kontext einer Erwerbsarbeit stehen, mal als Kunst oder in einer noch immer so genannten Freizeit stattfinden kann. Doch bei einer Neufassung des Arbeitsbegriffes geht es nicht nur um anthropologische und soziologische Fragen. Sondern ganz konkret auch um das zukünftige ökonomische Überleben des homo ludens. Dass Kultur nicht immer nur der Luxus ist, den sich die Gesellschaft leistet, sondern den sich immer häufiger umgekehrt die Kulturschaffenden leisten, indem sie auf Marktpreise für ihre Arbeit verzichten, ist dabei das eine. Dass es wichtig ist, diese Trennung — von Kultur und Markt! — trotzdem und unbedingt beizubehalten, das andere.
Aus: das magazin der kulturstiftung des bundes Nr. 13 – frühjahr 2009. S. 16-17.
Mit freundlicher Genehmigung der Kulturstiftung des Bundes – magazin –
Franckeplatz 1, 06110 Halle an der Saale
Redaktion: Friederike Tappe-Hornbostel
Zitation
Petra Kohse, Sammelstelle der Energien. Das Programm Arbeit in Zukunft - im Rückblick , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/sammelstelle-der-energien