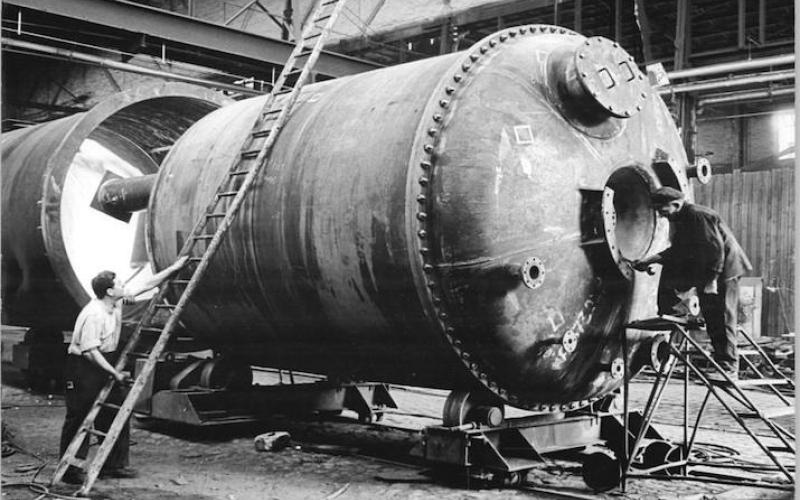Den industriellen Arbeitsgesellschaften der OECD-Länder und inzwischen auch der sogenannten Schwellenländer wird nicht erst seit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise von 2008 eine eher schwierige Zukunft prophezeit. Schon vor rund vier Jahrzehnten tauchten die ersten Voraussagen einer postindustriellen Ära auf.[1] Während aber eine insbesondere politik-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlich geführte Debatte das Ende der Arbeit und des Industriezeitalters erörterte,[2] hielt sich die sozialgeschichtliche Diagnose in dieser Hinsicht bemerkenswert zurück.[3] Das lag nicht nur daran, daß die Voraussage der Zukunft nicht ihr Metier sein kann, oder daß die zeithistorischen Quellenvoraussetzungen Grenzen zogen. Vor allem hatte und hat man es mit der Tatsache zu tun, daß die Geschichte der Arbeit, der Arbeiterschaft und der Arbeitsgesellschaft allen Prophezeiungen zum Trotz nach wie vor stattfindet. Das läßt nach dem Zustand der industriellen Arbeitswelt ebenso fragen wie nach den Gründen, ihr Ende an die Wand zu malen.
Noch im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts schien es für die Mehrheit der Bevölkerung in den europäischen Industrieländern, die „abhängig Beschäftigten“, zu den Selbstverständlichkeiten einer „Normalbiographie“ zu gehören, einen Beruf zu erlernen und diesen dann auch bis zum Eintritt in das Renten- oder Pensionsalter auszuüben, möglichst ohne die Arbeitsstelle zu wechseln. Das war mit einem bis dahin kaum erreichten Maß an sozialer Absicherung und Berechenbarkeit des aktiven Arbeitslebens und des Altersruhestandes verbunden. Michael S. Aßländer schreibt dazu: „Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts gehören lebenslange Berufsarbeit, durchgängige Beschäftigung in möglichst einem Unternehmen und eine klar strukturierte berufliche Karriere zu den Erwartungshaltungen innerhalb der modernen Arbeitsgesellschaft. Der sichere Arbeitsplatz garantiert materiellen Wohlstand und bildet die Voraussetzung zahlreicher sozialer und politischer Rechte. Wie keine Epoche zuvor definiert das 20. Jahrhundert Vollbeschäftigung als Normalzustand der Arbeitsgesellschaft.“[4] Dennoch, über einen größeren Zeitraum betrachtet, handelte es sich um eine historische Ausnahmesituation: „Das ‚Normalarbeitsverhältnis’ war selten normal.“[5] Vielleicht, so ließe sich vermuten, käme hierfür neben dem von Aßländer genannten Zeitraum auch noch die Zeit zwischen Jahrhundertwende und 1. Weltkrieg in Betracht.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich bald erreichte relativ komfortable Beschäftigungssituation stand in einem chronologischen und strukturellen Zusammenhang mit der Wiederaufbauperiode nach dem Zweiten Weltkrieg. In Ost und Westeuropa hatte sie trotz aller systembedingten Unterschiede in erstaunlicher Parallelität für viele Menschen zu einer einigermaßen auskömmlichen Existenz geführt.[6] Nicht ohne Grund galten die 1950er und 1960er Jahre in der englischsprachigen Welt im sicher auch etwas verklärenden Rückblick als „Golden Age“. In Frankreich sprach man von „les trentes glorieuses“ und die (West)-Deutschen hatten ihr „Wirtschaftswunder“.[7] Aber auch in den mittel- und osteuropäischen Regionen des sowjetischen Machtbereichs sorgte ein beachtliches Wirtschaftswachstum trotz innerer Krisen und systembedingter Bremswirkungen zur selben Zeit für einen deutlichen Anstieg des Lebensstandards.[8]
Es wirkte wie eine Fortschreibung dieser positiven Tendenzen, ergänzt freilich durch die neuen Technologien des heraufziehenden Computerzeitalters, wenn Daniel Bell, Zbigniew Brzezinski, Herman Kahn, Raymond Aron u. a. in den späten 1960er Jahren ihr Konzept der „postindustriellen“ Gesellschaft entwickelten und „eine Welt des vermehrten Überflusses und deshalb hoffentlich auch des verminderten Wettbewerbs“ in Aussicht stellten.[9] Den historischen Hintergrund dieser attraktiven Projektion bildete jedoch ein neuer industrieller Technologieschub, ein Vorgang, der für das hier zu betrachtende Problem maßgebend werden sollte. Man hat hierfür verschiedene Bezeichnungen gefunden. Relativ weit verbreitet ist der 1978 von dem deutschen Wirtschaftsjournalisten Dieter Balkhausen mit Blick auf den Einzug elektronischer Rechentechnik in Wirtschaft und Verwaltung eingeführte Begriff der „dritten industriellen Revolution“.[10] Die, wenn man so will, „Leitfossilien“ der ersten und zweiten industriellen Revolution waren die Dampfmaschine bzw. der Elektromotor. Nun folgte also die Mikroelektronik. Daniel Bell nannte dies die „dritte technologische Revolution“.[11] Ein anderes Drei-Stufen-Modell präsentierte Dieter Otten, der von einer industriellen Revolution des Mittelalters, der zweiten industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts und einer in den 1970er und 1980er Jahren einsetzenden dritten Revolution ausging.[12] Manche sprachen von einer „digitalen Revolution“ oder auch von einem „Informationszeitalter“,[13] mit der die einen eine „Postmoderne“[14] bzw. eine „postindustrielle“ Ära, wieder andere eine „zweite Moderne“ heraufziehen sahen.[15]
Der Blick blieb dabei auf die westlichen OECD-Länder fixiert. Das war einerseits nachvollziehbar, machte sich doch der neue industrielle Technologieschub gerade dort zuerst und deutlich bemerkbar. Im Verlauf der 1960er Jahre registrierte man im Bereich der „alten“ Industrien, vor allem bei Kohle und Stahl sowie in der Textilbranche einen zunehmenden strukturellen Druck. Sie schienen ihre Zeit gehabt zu haben, während anderen Zweigen wie der Elektronik- und der Chemieindustrie eine glänzende Zukunft vorausgesagt wurde. Das gab auch zu euphorischen Erwartungen Anlaß. Neue Werkstoffe, fortschreitende Automatisierung und höhere Qualifikation der Beschäftigten ließen auf mehr Wohlstand bei weniger Arbeit hoffen. Insofern kam es nicht überraschend, wenn zugleich nach den künftigen Formen von Arbeit, insbesondere der Erwerbsarbeit gefragt wurde.
Doch gerade während das verlockende Bild einer auf „High-Tech“ gründenden Zukunftsgesellschaft aufschien, begann es im Gebälk der Weltwirtschaft hörbar zu knacken. Die industrielle Welt registrierte nach Jahren eines scheinbar unerschöpflichen Nachkriegsaufschwungs nicht nur neue technologische Herausforderungen, sondern auch wirtschaftliche und soziale Turbulenzen. Im harten Kontrast zur bisherigen Erfolgsgeschichte sahen sich die westlichen Volkswirtschaften seit den späten 1960er Jahren mit steigenden Inflationsraten und zunehmender Arbeitslosigkeit, stagnierendem Sozialprodukt und Zahlungsbilanzungleichgewichten, wachsenden Haushaltsdefiziten und instabilen Wechselkursen, desintegrativen Tendenzen auf dem Weltmarkt und mit einer Reihe anderer Probleme konfrontiert.[16] Man reagierte zunächst mit der Aufgabe des „Bretton-Woods“-Systems der festen Wechselkurse. Wenig später, 1973/1974, sorgte der auf die erste Ölpreiskrise folgende Konjunktureinbruch für neue Irritationen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Konsequenzen für die abhängige Erwerbsarbeit. Selbst Länder wie Japan und die Bundesrepublik Deutschland, die „relativ unbeschädigt“ aus diesen Schwierigkeiten hervorgingen, registrierten eine sich verfestigende strukturelle Arbeitslosigkeit und, daraus folgend, eine stärkere Belastung der sozialen Sicherungssysteme.[17]
Schon im letzten Viertel dieses Jahrhunderts wandelte sich das Bild der Erwerbsarbeit sehr schnell und zu Beginn des 21. Jahrhunderts schienen verzögerte Berufskarrieren, fragmentierte Erwerbsbiographien, Niedriglohnsektoren und „Minijobs“ zum Standard zu werden. Versagende Arbeitsmärkte und eine sich verfestigende Massenarbeitslosigkeit waren die andere Seite der Medaille. Die „fordistisch“[18] geprägte Arbeitsgesellschaft geriet offensichtlich in eine Krise.[19] Das war kein abrupter Vorgang, vielmehr vollzog er sich, nach Ländern und Branchen abgestuft, in den 1960er und 1970er Jahren als Übergang von einer Arbeitswelt mit hohem Arbeitskräftebedarf zu einer kapitalintensiveren Produktion mit sinkendem Arbeitsplatzangebot.
Die in den frühen 1970er Jahren einsetzende Beschäftigungskrise hatte weniger mit dem Ölpreis zu tun als vielmehr mit einem einschneidenden Strukturwandel der modernen Industriegesellschaft.[20] Erstmals trat eine Situation ein, in der „die Nachfrage nach Arbeit dauerhaft und in wachsendem Ausmaß hinter dem Arbeitsangebot zurückbleibt“.[21] Von nun an hinterließ jeder Konjunkturzyklus mehr Arbeitslose als der vorige. Treffend beschrieb der französische Soziologe Robert Castel den Vorgang als „Bruch einer Verlaufskurve“.[22] Eine anhaltende Massenarbeitslosigkeit wurde zum „Krebsschaden“ – nicht nur der Wirtschaft.[23] Seither verunsicherten steigende Arbeitslosenquoten die Arbeitsmärkte und setzten die Sozialsysteme unter Druck. Der in den 1960er Jahren kräftiger gewordene „Expansionstrend des Sozialsektors“[24] hielt zwar an, aber er speiste sich nun nicht mehr aus einem forcierten Wirtschaftswachstum, wie das von 1949 bis zum Beginn der 1970er Jahre der Fall gewesen war. Damit bahnte sich ein normativer Konflikt zwischen Marktwirtschaft und Sozialstaat an.[25]
Bereits in der zeitgenössischen Wahrnehmung galt die abhängige Erwerbsarbeit als bedroht. Die Furcht vor einer Wiederkehr der Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er Jahre mit ihrer Massenarbeitslosigkeit erschien nicht unbegründet.[26] Dies war um so mehr der Fall, als die politischen Klassen der einschneidenden Konsequenzen erst allmählich gewahr wurden.[27] Tatsächlich waren die maßgeblichen Akteure der Politik, der Unternehmerseite und der Gewerkschaften über den Fortgang der Entwicklung gar nicht sicher. Geradezu zwangsläufig gingen ihre Vorstellungen weit auseinander, wie Alain Touraine zeigt: „In einigen Fällen schon in den sechziger Jahren und in den siebziger Jahren in fast allen Teilen der Welt begann das umfassende Nachkriegsprojekt einer auf Technologie basierenden nationalen Entwicklung seine Kraft und Wirksamkeit zu verlieren und löste sich allmählich in seine Bestandteile auf. Eine international ausgerichtete neoliberale Politik, oft ‚strukturelle Anpassung’ genannt, setzte an die Stelle von Produktion den Markt, an die Stelle von Entwicklung Wettbewerbsfähigkeit, an die Stelle von Wohlfahrt Flexibilität und an die Stelle von Ausbeutung soziale Ausgrenzung oder Unsicherheit. Nur eine Minderheit setzt die Prioritäten auch weiterhin bei internen Fragen einer neuen Form der Wirtschaftsgesellschaft. Eine größere Gruppe betont die negativen Auswirkungen der alten Formen wirtschaftlicher Organisation und von Staatseingriffen, die noch vor einer Generation positive Effekte hatten. Eine ganz andere Minorität, die eher aus Intellektuellen und Sozialarbeitern als aus Gewerkschaftern und Politikern besteht, fordert die vollständige Abkehr von der Industriegesellschaft. Gruppen auf der extremen Linken teilen die Kritik an der industriellen Organisation mit den Neoliberalen, die fordern, daß die Marktkräfte von staatlichen Eingriffen befreit werden müßten, weil sie ein Hindernis auf dem Weg zu wirtschaftlichen Innovationen seien und sogar auf dem Weg zur Angleichung der Lebensbedingungen. Der Staat dürfe nicht länger aktiv handelnd in die Einkommensverteilung eingreifen.“[28]
Dieses höchst widersprüchliche Meinungsspektrum war symptomatisch für die um 1970 registrierte Umbruchsituation. Insofern überraschte es nicht, wenn auch die „transnationale soziologische Makroperspektive […] keine eindeutige, historiographisch tragfähige Bezeichnung der 1970er Jahre hervorgebracht“ hat.[29] Die Unsicherheit beeinflußte nicht zuletzt die Debatte über die Zukunft der Arbeit in der „dritten industriellen Revolution“. Dagegen stellte kaum jemand die Tatsache einer Zäsur in der Geschichte der Erwerbsarbeit in Frage. Der spanische Soziologe Manuel Castells qualifizierte die Zeit um 1970 als eine der wichtigsten Tendenzwenden des 20. Jahrhunderts. Sie schied seiner Meinung nach zwei Perioden in der Entwicklung moderner Industrieländer. Die eine umfasse ungefähr die Jahre 1920 bis 1970 und sei durch einen „massive(n) Rückgang der landwirtschaftlichen Beschäftigung“ gekennzeichnet gewesen, die andere erstrecke sich etwa über den Zeitraum von 1970 bis 1990 und habe zu einem „schnelle(n) Niedergang der industriellen Beschäftigung“ geführt.[30] Das schien überzeugend, zumal die Erwerbsstatistiken in Europa und Nordamerika diesen Prozeß offenbar bestätigten.
Castells’ Bemerkung zielte im Prinzip auf die westlichen OECD-Länder, sie galt mutatis mutandis jedoch auch auf die Länder des sowjetischen Blocks. Diese hatten ebenfalls einen industriellen Entwicklungspfad gewählt, der nahezu zeitgleich die technologische Schwelle der „dritten industriellen“ oder, wie es in Mittel- und Osteuropa bevorzugt hieß, der „wissenschaftlich-technischen Revolution“ erreichte. Und auch sie sahen sich mit der Frage nach der Zukunft der Arbeit und den sozialen Konsequenzen der neuen Technologien konfrontiert. Allerdings schienen ihre beschäftigungspolitischen Perspektiven günstiger zu sein als die der westlichen Industrieländer.[31] Zwei Argumente sprachen dafür: (1.) In Mittel- und Osteuropa hatten das Recht auf Arbeit und Vollbeschäftigung Verfassungsrang. (2.) Was die aktuelle und künftige Arbeitskräftesituation betraf, überstieg der Bedarf im allgemeinen noch die Arbeitskraftressourcen, wobei Polen zeitweise eine Ausnahme machte.[32]
Die Beschäftigungssituation der RGW-Länder war ambivalent. Zum einen hatten die meisten von ihnen aufgrund starker Nachkriegsjahrgänge eine erhöhte Zahl von Arbeitsfähigen mit Arbeitsplätzen zu versorgen. Zum anderen blieb ihr Arbeitskräftebedarf angesichts relativ niedriger Produktivitätszuwächse, einer nach wie vor extensiven Industrialisierung und eines hohen Personalbedarfs der Staats- und Parteibürokratien sowie der Militär- und Sicherheitsapparate außerordentlich hoch. Im Hinblick auf das politische Grundziel der Vollbeschäftigung erwies sich diese Situation als vorteilhaft, in der ČSSR, Polen und Ungarn trat Ende der 1970er Jahre sogar ein Arbeitskräftemangel ein. Die DDR sah sich, bedingt durch eine besonders schwierige demographische Situation, damit schon länger konfrontiert, und es entstanden auch in den 1970er Jahren mehr Arbeitsplätze als Arbeitskräfte verfügbar waren. In diesen Ländern setzte man zu dieser Zeit verstärkt auf Rationalisierungsmaßnahmen und Automatisierung.[33] Auch in der UdSSR machten sich Personalengpässe bemerkbar, weniger hingegen in Bulgarien und Rumänien.[34] Die Beschäftigungszunahme setzte sich dennoch fort, wobei der Schwerpunkt nach wie vor auf der Industrie lag. Insgesamt sind die Zahlen der Industriebeschäftigten in den 1970er Jahren in Mittel- und Osteuropa gestiegen. Während der 1980er Jahre gingen sie mit Ausnahme Bulgariens und Rumäniens etwas zurück, wobei hier vor allem demographische Prozesse, strukturpolitische Entscheidungen und Rationalisierungsmaßnahmen zu Buche schlugen:
Tabelle 1
Industriepersonal im Jahresdurchschnitt (1.000 Personen)
|
Jahr |
1970 |
1980 |
1989 |
|
Bulgarien |
1.087 |
1.271 |
1.476 |
|
ČSSR/ČSFR |
2.485 |
2.687 |
2.664 |
|
DDR |
2.843 |
3.209 |
3.189 |
|
Polen |
4.115 |
4.783 |
4.503 |
|
Rumänien |
2.064 |
3.327 |
3.796 |
|
UdSSR |
31.593 |
36.891 |
36.414 |
|
Ungarn |
1.790 |
1.684 |
1.440 |
Quelle: Совет экономической взаимопомощи, Секретариат (Изд.): Статистическй Ежегодник стран-членов совета экономической взаимопомощи 1981, Москва 1981 [Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, Sekretariat (Hg.): Statistisches Jahrbuch der Mitgliedsländer des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, Moskau 1981], S. 126; Совет экономической взаимопомощи, Секретариат (Изд.): Статистическй Ежегодник стран-членов совета экономической взаимопомощи 1990, Москва 1990 [Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, Sekretariat (Hg.): Statistisches Jahrbuch der Mitgliedsländer des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, Moskau 1990], S.280.
Ohne dieses Thema hier näher auszuführen bleibt festzuhalten, daß in den Ländern des sowjetischen Blocks von einer Beschäftigungskrise nicht die Rede sein konnte. Der Herausforderung des raschen technologischen Wandels hoffte man mit einer planmäßigen Beschäftigungs- und Sozialpolitik entsprechen zu können. Diese Erwartung fand ihre Ergänzung im Verweis auf die Krise der westlichen Industrieländer. Exemplarisch für eine solche Sicht hieß es im Bericht des ZK an den IX. Parteitag der SED von 1976, während sich der RGW-Raum zur „dynamischsten Wirtschaftsregion der Erde“ entwickelt habe, zeige sich im Westen seit Beginn der 1970er Jahre „eine ganz besondere Art der Verflechtung von allgemeiner und zyklischer Krise“.[35]
Zu dem Zeitpunkt glichen solche Zustandsbeschreibungen zwar dem Pfeifen im dunklen Wald, gleichwohl verdient der implizit enthaltene Aspekt von Vollbeschäftigung und Beschäftigungskrise Beachtung. Denn die in Mittel- und Osteuropa praktizierte Beschäftigungspolitik ist nicht nur aus einem Modernisierungsrückstand zu erklären. Sie führte auch bei lokalem und regionalem Arbeitskräfteüberschuß zum Angebot von Arbeitsplätzen, die unter rein wirtschaftlichen Kriterien nicht erforderlich waren. Die Annahme, es handele sich hier um versteckte Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit, ist nicht unbegründet, aber auch nicht ganz zu Ende gedacht. Man kann in diesem Beschäftigungsmodell nämlich auch einen im großen und ganzen erfolgreichen Versuch sehen, Arbeitslosigkeit durch einen staatlich subventionierten Beschäftigungssektor zu verhindern.
Eines fällt auf: So unterschiedlich die Perzeption der Beschäftigungsproblematik in den westlichen und den östlichen Industrieländern war, so sehr ähnelten sich die politischen Reaktionen darauf. Sie waren nämlich im wesentlichen durch den Rückgriff auf vorhandene Arbeitsmarkt- bzw. Beschäftigungsinstrumente bestimmt. Der Erhalt oder die Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung blieb die eigentliche Option. Der Fall, daß sich in absehbarer Zeit ein mehr oder minder großer Teil der Erwerbsbevölkerung schlicht als „überzählig“ erweisen würde, kam – zumindest öffentlich – nicht in Betracht. Auch daß sich unter dem Einfluß neuer Technologien ein Teil der bislang dauerhaften Arbeitsplätze in prekäre Beschäftigungsverhältnisse verwandeln würde, war in den 1970er Jahren noch kein Thema. Hier aber lag der Ausgangspunkt einer sozialen Frage, die sich nicht auf die Peripherie moderner Arbeitsgesellschaften beschränkte, sondern in deren Zentren hineinreichte. Robert Castel benannte drei Kristallisationskerne für dieses Problem: (1.) die Destabilisierung des Stabilen; (2.) das Sich-Einrichten in der Prekarität; 3.das Entstehen einer Schicht von „Überzähligen“.[36]
Das war von anderer Qualität als die „klassische“ Erwerbslosigkeit, deren fatale Folgen u.a. in der berühmten Marienthal-Studie beschrieben worden sind: „Losgelöst von ihrer Arbeit und ohne Kontakt mit der Außenwelt haben die Arbeiter die materiellen und moralischen Möglichkeiten eingebüßt, die Zeit zu verwenden. Sie, die sich nicht mehr beeilen müssen, beginnen auch nichts mehr und gleiten allmählich ab aus einer geregelten Existenz ins Ungebundene und Leere.“[37] Jetzt ging es um das Vordringen struktureller Arbeitslosigkeit in zentrale Bereiche der industriellen Arbeitsgesellschaft und um die dauerhafte Verdrängung in weitgehend von Sozialtransfers abhängige Unterschichten. Das über Jahrzehnte hinweg dominierende „fordistische“ Arbeitsparadigma geriet unter diesen Umständen in akute Bedrängnis.
Während in Ost und West das Bestreben erkennbar war, die Beschäftigungsprobleme mit den bisher schon praktizierten Methoden zu lösen bzw. zu steuern, fiel die katholische Soziallehre in gewisser Weise aus dem Rahmen. Von den anderen zeitgenössischen Reaktionen auf den Umbruch der industriellen Arbeitswelt unterschied sie sich, indem sie die neue Qualität des heraufziehenden Beschäftigungsproblems klar erfaßte, aber auch voreilige Festlegungen und unausgegorene Schlußfolgerungen tunlichst vermied: Bereits im Mai 1971 reagierte der Vatikan mit dem von Papst Paul VI. an Kardinal Maurice Roy, Präsident des Laienrates und der Päpstlichen Kommission „Iustitia et pax“, gerichteten apostolischen Schreiben „Octogesima adveniens“. Darin wurde der Übergang von der deduktiven Anwendung einer „fertigen“ Soziallehre auf konkrete Situationen zur induktiven „lernenden“ Ableitung aus solchen Situationen postuliert.[38] Das Schreiben lenkte den Blick auf „die schweren Probleme unserer Zeit“ und auf „bedrohliche Spannungen“ im Dasein einer „ganzen, nach ihrer Zukunft, nach Richtung und Bedeutung der sich derzeit abspielenden Vorgänge fragenden Menschheit“.[39] Vor dem Hintergrund einer eben erst eingetretenen qualitativen Zäsur in der sozialen Entwicklung der modernen Welt sprach dies für die frühzeitige Wahrnehmung einer systemübergreifenden Problemlage.[40] Eine im Hinblick auf die Arbeit wesentliche Positionsbestimmung erfolgte dann 1981 mit der Enzyklika „Laborem exercens“ Johannes Paul II.[41]
Offensichtlich trat in den 1970er Jahren ein Wechsel der Arbeitsparadigmas ein. Im Grundsatz war das nicht neu. Der vor ca. 12.000 Jahren im nördlichen Bereich des „Fruchtbaren Halbmondes“ erfolgte relativ rasche Durchbruch neuer Subsistenzstrategien im Zuge der neolithischen Revolution dürfte ein solcher Wendepunkt gewesen sein.[42] Ein wachsender und seßhaft werdender Teil der Menschheit erarbeitete seither sein Brot nicht nur im Schweiße des Angesichts, sondern auch in zunehmend fester gefügten, funktional organisierten und sozial differenzierten Kontexten. Das helle Vergnügen war das kaum. Im Buch Genesis der Bibel findet sich eine Spur, die bis ins hohe Mittelalter zu verfolgen ist: Arbeit als Strafe nach dem Sündenfall (Genesis 3, 17-18). Erst im Mittelalter, unter dem Einfluß eines christlichen Ständekonzepts, verlor Arbeit das „Stigma der moralischen Minderwertigkeit“.[43] Mit dem Bedeutungsgewinn der Stadt, die wachsende Akzeptanz des Kaufmannsgewerbes und des Handwerks, nicht zuletzt gefördert durch die Reformationsbewegung, wandelte sich das gesellschaftliche Verständnis der Arbeit. „Die Geburtsstunde unserer heutigen Arbeits- und Erwerbsmentalität ist auf das engste mit der Entstehung dieser bürgerlichen Gesellschaft verknüpft.“[44] Man wird zum Vergleich den Blick auf China richten können. Das Reich der Mitte habe sich im 14. Jahrhundert kurz („um Haaresbreite“) vor der Industrialisierung befunden, meint Eric L. Jones.[45] Noch unter der Ming-Dynastie im 15. Jahrhundert richteten Kaufleute Betriebe mit Lohnarbeitern ein. Im 16. und 17. Jahrhundert dominierten staatliche Handwerksbetriebe und Manufakturen, die allerdings weitgehend auf Fron- und Zwangsarbeit basierten. Gleichwohl entstanden auch private, wenngleich streng reglementierte Privatmanufakturen, vor allem im Textilgewerbe. Unter der Mandschu-Herrschaft im 17. und 18. Jahrhundert brachen diese Parallelen zur europäischen Entwicklung zwar nicht völlig ab, doch zogen staatliche Kontrolle, Gewinnabschöpfung und Selbstisolation nach außen enge Grenzen. Man kann von einer Modernisierungsblockade sprechen.
Daher blieb für das im 18. Jahrhundert heraufziehende Industriezeitalter vorläufig nur die europäische Wurzel relevant. Die abhängige Erwerbsarbeit wurde für die entstehende Industriegesellschaft konstitutiv. Hier nahm eine Entwicklung ihren Ausgang, die Michael S. Aßländer mit Blick auf die jüngere Zeit so resümierte: „Wohl kaum ein anderer Lebensbereich bestimmt die soziale Selbstwahrnehmung des modernen abendländischen Menschen mehr als seine berufliche Arbeit. Neben der Ermöglichung materieller und sozialer Chancen bildet die Berufsarbeit für den einzelnen neben der Familie den wohl wichtigsten Bereich sozialer Identifikation.“[46]
Ein zentrales Element dieses Übergangs war der Wandel des Arbeitsparadigmas. Er vollzog sich in enger Bindung an die Veränderung des individuellen und kollektiven Zeitmanagements.[47] Es ist „die Maschine, die eine neue Zeit schafft“, konstatierte Thomas Nipperdey. Zeit werde rationalisiert und gemessen. „Arbeitszeit wird etwas ganz anderes als gelebte Zeit. […] Die arbeitsmoralische Erziehung zu Fleiß, Pünktlichkeit (und Frühaufstehen) war davon geprägt, Unternehmer und Fabrik haben – gegen Widerstände und mit großen Schwierigkeiten – dieses neue Prinzip durchgesetzt; die Arbeiter aus der alten Welt haben es übernommen. Erst danach wurde der Kampf um die Verkürzung von Arbeitszeit oder die Bezahlung von Überstunden möglich.“[48] Hier entstanden die Voraussetzungen des „fordistischen“ Jahrhunderts, das wiederum der „dritten industriellen Revolution“ den Boden bereitete. Seither bildete sich in der Erwerbsarbeit die Dominanz der Industriebeschäftigung heraus. In Europa weitete sich der Industriesektor zwischen 1950 und den frühen 1970er Jahren zum größten Beschäftigungsbereich, womit, wie Hartmut Kaelble es formulierte, der Höhepunkt der Industriegesellschaft erreicht wurde.[49]
Der Begriff des Höhepunktes legt den des Wendepunktes nahe oder sogar den des Bruchs, wie ihn Castel im Bild von der „Verlaufskurve“ verwendete. Damit steht auch die Frage im Raum, ob das Signum „1970“ für ein Ausscheren aus den Koordinaten der Industriemoderne steht. In Theorieansätzen, wie sie mit den Begriffen der „Postmoderne“ oder auch des „Postindustrialismus“ verbunden sind, deutet sich eine entsprechende Perspektive an.[50] Unübersehbar machte sich im politischen Raum der 1970er und 1980er Jahre eine technikkritische Strömung bemerkbar. „Die optimistischen Zukunftsvisionen verloren ihre Attraktivität angesichts der Grenzen des Wachstums, der limitierten Energievorräte und bedrohten Umwelt, der drohenden neuen Epidemien, aber auch der immer weiter wachsenden Arbeitslosigkeit.“[51] Es scheint sich hier ein in besonderer Weise deutsches Phänomen reaktiviert zu haben, das durchaus auch auf eine Auflösung des modernen industriellen Arbeitsparadigmas zusteuerte. Seine Vorläufer hatte es in „romantischen“ Reaktionen auf die Industrialisierungsschübe des 19. und 20. Jahrhunderts, wie man bei Rüdiger Safranski lernen kann. In seinem Buch „Romantik. Eine deutsche Affäre“[52] spannt er einen Bogen von der Frühromantik (im Kontext der Frühindustrialisierung) über die „völkischen Bewegungen“ und „1968“ bis hin zum Paradigma der „Postmoderne“ und zeigt deren technik- und industriekritischen Attitüden als Folge einer sozialen wie auch mentalen und intellektuellen Verunsicherung durch Industrialisierung und deren gesellschaftlichen Begleiterscheinungen. Während allerdings der frühen Romantik die Ironie zu Gebote stand, verschob sich der industriekritische Denk- und Argumentationsstil hin zur „ökologisch“ drapierten „Romantik“ der Gegenwart, die über zahlreiche Querverbindungen mit „German ‚Angst’“ in Beziehung zu stehen scheint. Die Konsequenzen für das Arbeitsparadigma waren erheblich, stellten sie doch das industriell geprägte Arbeitsethos in Frage.[53] Allerdings, wird man daraus nicht ohne weiteres auf das Ende der Industrie und der Industriearbeit schließen dürfen, sagt doch Safranskis These nicht mehr, als daß solche „romantischen“ Konjunkturen als Resonanzen eines jeweils neuen industriellen Modernisierungsschubes zu verstehen sind.
Wie aber steht es nach „1979“ um die an die Existenz der Industrie gebundene Erwerbsarbeit? Ohne Zweifel zeigte sich seither in den OECD-Ländern eine Tendenz zum Abbau von Industriearbeitsplätzen. Mitte der 1990er Jahre proklamierte der in den USA wirkende Ökonom Jeremy Rifkin das Ende der Arbeit.[54] Eine gewisse Ähnlichkeit mit Francis Fukuyamas Postulat vom Ende der Geschichte liegt auf der Hand, womit die globale Durchsetzung des liberalen Gesellschaftsmodells des Westens nach dem Ende des Kommunismus gemeint war.[55] Wenn der Kommunismus als etatistischer Gegenspieler des Kapitalismus verschwinden konnte, so die naheliegende Schlußfolgerung, würde das Ende der Arbeit nun auch den sozialen Kontrahenten, die Arbeiterschaft, aus dem Rennen werfen. Hinter dem Argument wetterleuchtete noch etwas Klassenkampf.
Der Vorstellung vom Ende der Arbeit geht eine von der großen Arbeitsverweigerung voraus. Klassisch hat Georg Herwegh 1863 im Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) die Idee auf den Punkt gebracht: „Mann der Arbeit aufgewacht! Und erkenne deine Macht! Alle Räder stehen still. Wenn dein starker Arm es will“. Den Zeitgenossen des Maschinenzeitalters erschien das einleuchtend. Rifkin setzte hierzu einen radikalen Kontrapunkt. Seiner Meinung nach hat der „starke Arm“ ausgedient: „Jetzt geht es um Maschinen, die mit Maschinen reden. Der Mensch wird überflüssig.“[56] Diese beiden Sequenzen, nimmt man sie beim Nennwert, flankieren einen Zeitraum, der im Zeichen einer raschen Industrialisierung vor allem Europas, Nordamerikas und Japans stand. Näher betrachtet, lagen und liegen die Dinge aber doch nicht so einfach, wie die beiden Zitate suggerieren. So ließe sich Herweghs griffiger Formel entgegenhalten, daß sich ganze Betriebsbelegschaften oder gar die Arbeiterschaft überhaupt nur selten in ihrer Gesamtheit zur Arbeitsniederlegung bewegen ließen, und außerdem war die Geschichte der Arbeitskämpfe meist auch begleitet von Versuchen des Streikbruchs.[57] Szenen dieser Art fanden bald Niederschlag in der Literatur, etwa in Bernhard Kellermanns 1913 erschienenem Roman „Der Tunnel“, in dem nach einer Explosionskatastrophe beim Bau eines transatlantischen Tunnels Ingenieure die Räder am Laufen hielten, während die Arbeiter streikten.[58] Aber auch der Notbetrieb der Deutschen Bahn während des Streiks von 2007 folgte einem solchen Muster. Die Konsequenz lautet: Der starke Arm ist ersetzbar, und zwar nicht in erster Linie durch die „Ingenieure“, sonder durch automatisierte Produktions- und digitalisierte Informationstechniken, aber auch durch billigere Arbeitskräfte anderswo.
Rifkins Interpretation hingegen ist der Umstand entgegenzuhalten, daß die Zahl der Industriearbeitsplätze zwar in einigen „alten“ Industrieländern rückläufig wurde, in anderen Ländern aber auch nach Beginn des 21. Jahrhunderts weiter zunahm. Das spräche für eine globale Dynamik der Industriearbeit, die sich in regionalen Zentren und in deren tektonischen Verschiebungen manifestiert. Vor diesem Hintergrund wäre die Industrialisierung Europas zwar als eine zentrale Komponente des Industriezeitalters, nicht aber als dessen ultima ratio wahrzunehmen.
Die industriegeschichtliche Tektonik rückte inzwischen demographische Schwergewichte ins Zentrum des Geschehens: Brasilien mit rund 200 Mio. Einwohnern, China mit 1,3 Mrd., Indien mit 1,1 Mrd. und Rußland mit 140 Mio. Sie sind dabei, den „alten“ Industrieländern Europas und den USA den Rang abgelaufen – und zwar nach deren eigenem Industrialisierungsmodell. So hatten sie entscheidenden Anteil am weiteren Anstieg der Industrieproduktion. Setzt man den Index der industriellen Produktion für 1995 = 100, so standen im Jahr 2004 die USA bei 129,2, die Russische Föderation bei 130,5, Indien bei 165,6. China erreichte jeweils gegenüber dem Vorjahr (=100) 112,7 im Jahr 2002, 116,7 im Jahr 2003 und 116,3 im Jahr 2004. Deutschland lag bei 103,4, während seine östlichen Nachbarn Polen auf 179,1 und die Tschechische Republik auf 141,0 verweisen konnten.[59] Gewiß wird man die unterschiedlichen Ausgangsniveaus zu beachten haben, doch bot etwa die Sowjetunion im 20. Jahrhundert ein Beispiel, wie schnell sich die Relationen verändern konnten. Das gilt auch dann, wenn die hohen Kosten des sowjetischen Hyperindustrialismus für Mensch und Natur in Rechnung gestellt werden.[60]
Als Indikatoren dieser industriellen Schwerpunktverlagerungen sind auch andere Daten zu verstehen. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verteilten sich die jährlichen Wachstumsraten bei der Arbeitsproduktivität, den Arbeitskräften und beim BIP zwischen 1993 und 2003 wie folgt:
Tabelle 2
Arbeitsmarkt und ökonomische Indikatoren (Welt und Regionen, ausgewählte Jahre, Prozent)
|
|
Beschäftigungsquote |
Zunahme der Arbeitsproduk-tivität 1993-2003 in % |
Jährliche Zunahme der Arbeitsproduk-tivität in % |
Jährliche Zunahme der Arbeitskräfte in % |
Jährliche Zunahme des GDP (gross domestic product = BIP) in % |
|
|
|
1993 |
2003 |
1993-2003 |
|||
|
Welt |
63,3 |
62,5 |
10,9 |
1,0 |
1,8 |
3,5 |
|
Lateinamerika und Karibik |
59,3 |
59,3 |
1,2 |
0,1 |
2,3 |
2,6 |
|
Ostasien |
78,1 |
76,6 |
75,0 |
5,8 |
1,3 |
8,3 |
|
Südostasien |
68,0 |
67,1, |
21,6 |
2,0 |
2,4 |
4,4 |
|
Südasien |
57,0 |
57,0 |
37,9 |
3,3 |
2,3 |
5,5 |
|
Mittlerer Osten und Nordafrika |
45,4 |
46,4 |
0,9 |
0,1 |
3,3 |
3,5 |
|
Subsaharisches Afrika |
65,6 |
66,0 |
-1,5 |
-0,2 |
2,8 |
2,9 |
|
Transitionsökonomien |
58,8 |
53,5 |
25,4 |
2,3 |
-0,1 |
0,2 |
|
Industrialisierte Ökonomien |
55,4 |
56,1 |
14,9 |
1,4 |
0,8 |
2,5 |
Quelle: ILO (Hg.): World Employment Report 2004-2005: Employment, productivity and poverty reduction, S. 27, 07.12.2004 [www.ilo.org/public/English/employment].
Die in Asien deutlich steigende Arbeitsproduktivität sowie die hohen Zuwächse des GDP sprechen für einen fortdauernden Industrialisierungsprozeß. Das Bild wird deutlicher, wenn man die Daten des Gross domestic product (GDP) aus dem Jahr 2008, den Gini-Index und den Human Developement Index (HDI) der neu industrialisierten Länder (Newly Industrialized Countries, NIC) vergleicht. Hier fallen besonders China und Indien mit sehr hohen Wachstumsraten des GDP auf.
Tabelle 3
GDP (gross domestic product = BIP), Gini-Index, HDI und reale Wachstumsraten der neu industrialisierten Länder (Industrieländer (Newly Industrialized Countries, NIC)
|
Kontinent |
Land |
GDP pro Kopf * (USD, 2008 IMF) |
Einkom-mensver-teilung (Gini) (2006) |
Human Development Index (HDI, 2007) |
||||
|
495.990 |
6.170 |
10.187 |
57,8 |
0.674 (mittel) |
4.50 |
4.92 |
||
|
1.550.257 |
10.747 |
14.582 |
47,3 |
0.829 (hoch) |
3.00 |
3.30 |
||
|
1.975.904 |
8.676 |
10.298 |
54 |
0.800 (hoch) |
5.40 |
4 |
||
|
7.890.277 |
3.180 |
5.943 |
44,7 |
0.777 (mittel) |
11.10 |
9.95 |
||
|
|
3.305.435 |
1.043 |
2.787 |
32,5 |
0.619 (mittel) |
9.70 |
7.02 |
|
|
|
388.313 |
7.866 |
14.225 |
49,2 |
0.811 (hoch) |
5.40 |
3.65 |
|
|
|
319.773 |
1.108 |
3.539 |
44,5 |
0.771 (mittel) |
7.50 |
7.40 |
|
|
|
556.410 |
4.099 |
8.380 |
42 |
0.781 (mittel) |
4.40 |
3.93 |
|
|
937.143 |
11.463 |
13.447 |
38 |
0.775 (mittel) |
5.20 |
4.10 |
* Kaufkraftparität.
Quelle: Newly Industrialized Countries, in: www.en.wikipedia.org.
Die hohen Wachstumsraten erklären sich nicht allein aus Produktivitätszuwächsen, wie aus einem Vergleich der beiden vorstehenden Tabellen zu erkennen ist. Sie werden zu einem beträchtlichen Teil durch eine Zunahme des Arbeitskräftepotentials getragen. So teilt Castells für die Beschäftigung in der Fertigung einige Zahlenreihen mit, die ziemlich klar für eine Ausweitung der Industriebeschäftigung und für deren geographische Schwerpunktverlagerung sprechen. Diese Daten sind hier in einer etwas vereinfachten Übersicht und gerundet wiedergegeben:
Tabelle 4
Beschäftigung in der Fertigung in wichtigen Ländern und Regionen 1970-1997 (in Mio.)
|
Jahr |
USA |
EU |
Japan |
Brasilien |
Mexiko |
China |
Indien |
Südkorea |
|
1970 |
19,4 |
38,4 |
- |
2,5 |
- |
- |
4,6 |
0,9 |
|
1975 |
18,3 |
36,6 |
13,4 |
4,0 |
- |
42,8 |
5,1 |
2,7 |
|
1980 |
20,3 |
35,2 |
13,7 |
7,4 |
2,6 |
67,1 |
5,9 |
3,0 |
|
1985 |
19,2 |
30,7 |
14,5 |
7,9 |
- |
83,5 |
6,2 |
3,5 |
|
1990 |
19,1 |
30,2 |
15,1 |
9,4 |
4,5 |
97,0 |
6,1 |
4,9 |
|
1995 |
18,5 |
28,0 |
14,6 |
8,5 |
4,9 |
98,0 |
6,8 |
4,8 |
|
1997 |
18,7 |
29,9 |
14,4 |
8,4 |
6,1 |
96,1 |
- |
4,5 |
Quelle: Manuel Castells: Das Informationszeitalter. Teil 1: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Opladen 2004, S. 349.
In den Jahren um 1990 beschäftigte die Industrie in Europa noch 36% der Erwerbstätigen, in Japan 34% und in den USA 26%.[61] Diese Anteile sind seither weiter zurückgegangen. So werden für 2007 folgende Anteile der im produzierenden Gewerbe Beschäftigten an den Erwerbstätigen insgesamt mitgeteilt: Deutschland 29,8%; Frankreich 23,2%; Italien 30,2%; Polen 30,7%; Spanien 29,3%; Ungarn 22,0%; Vereinigtes Königreich 22,5%; Türkei 32,7%; Brasilien 22,9%; Mexiko 29,3%; Japan 32,1%.[62] Der Rückgang wird allerdings durch die steigende Zahl der Erwerbstätigen (vgl. Tab. 2) und durch einen wachsenden Anteil industrienaher Dienstleistungen sowie oft durch „Outsourcing“ verlagerte Produktionen in Niedriglohngebiete relativiert. Dieser Prozeß hat einen beträchtlichen Umfang angenommen. Er setzte in größerem Maßstab in den 1960er Jahren bei Industrieunternehmen ein, die ihre Produktion an Auftragsfertiger auslagerten und damit die Wertschöpfungstiefe verringerten. Das begann mit technologisch weniger anspruchsvollen Erzeugnissen, Textilien etwa, und setzte sich bei komplizierteren Produkten fort, deren Herstellung von „Fertigungsdienstleistern“ übernommen wird.[63]
Offenkundig hat man es im globalen Kontext und bei unterschiedlichen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen mit einer weiteren absoluten Zunahme der Industriearbeitsplätze und mit einem relativ stabilen Anteil des sekundären Wirtschaftssektors zu tun.[64] Das belegen auch andere, geradezu klassische Industrialisierungsindikatoren wie die Kohle- und Ölförderung, Elektroenergie-, Eisen- und Stahlerzeugung. Einige Beispiele mögen verdeutlichen, daß man nicht aus der Schrumpfung einiger alter Industriestandorte auf einen allgemeinen Rückgang der industriellen Leistung schließen sollte:
Die Weltförderung an Braunkohle stieg von 890 Mio. t 1980 auf 1.166 Mio. t 1989, um 10 Jahre später auf 840 Mio. t abzusinken, was maßgeblich von der Schrumpfung des ostdeutschen Braunkohlebergbaus beeinflußt wurde. Im Jahr 2005 erreichte die Weltförderung bereits wieder 909 Mio. t, bei derzeit verfügbaren Reserven von 283.184 Mio. t. Eindeutiger stellt sich die Entwicklung der Steinkohleförderung dar: Sie stieg von 2.909 Mio. t 1980 mit einigen Schwankungen in den 1990er Jahren auf 4.978 Mio. t 2005. Die zu dieser Zeit förderungswürdigen Reserven beliefen sich auf 736.112 Mio. t.[65]
Allein zwischen 1990 und 2003 hat sich der Energieverbrauch der OECD-Staaten von 197,4 auf 234,3 Quadrillionen Btu (British thermal unit; 1 Btu = 252 cal = 1055 J) erhöht (OECD Nordamerika von 100,8 auf 118,3, OECD Europa von 69,9 auf 78,9, OECD Asien von 26,7 auf 37,1), unter den Nicht-OECD-Staaten stechen China (von 27,0 auf 45,5) und Indien (von 8,0 auf 14,0) hervor. Rußland machte mit negativem Trend eine Ausnahme (von 39,0 auf 29,1).[66]
Die Weltproduktion an Stahl lag 1960, also noch zur Zeit des Nachkriegsbooms, bei 346 Mio. t, 1970 bereits bei 595 Mio. t, 1980 bei 716 Mio. t, 1990 bei 771 Mio. t und 2007 bei 1.344 Mio. t. Die bedeutendsten Herstellerländer sind China, Japan und die USA, gefolgt von Rußland, Deutschland und der Ukraine.[67]
Im globalen Maßstab ist von einem Rückgang der Industrieproduktion oder gar von einem Niedergang der Industrien, nicht einmal der „alten“, wenig zu erkennen. Vor dem Hintergrund des Wachstums der Weltbevölkerung überrascht das nicht. Manuel Castells kommentierte sarkastisch, als „die Analysten in den 1980er Jahren die De-Industrialisierung Amerikas oder Europas verkündeten, übersahen sie einfach, was im Rest der Welt passierte.“[68] Auch die sogenannte Tertiärisierung,[69] die Ausweitung des Dienstleistungssektors gegenüber Industrie und Landwirtschaft, erweist sich als gar nicht so eindeutig.[70] Im Hinblick auf die USA machten Stephen Cohen und John Zysman auf einen hohen Anteil der Dienstleistungen aufmerksam, der unmittelbar mit der Industrie verbunden blieb, und sie erklärten die Existenz einer postindustriellen Ökonomie schlichtweg zu einem Mythos.[71]
Wie dieser Mythos zustande kam, wer ihn lancierte und welche Interessen dabei im Hintergrund wirkten, steht auf einem anderen Blatt. Hier öffnet sich ein Forschungsfeld, in dessen Zentrum das Entstehen, die Rekrutierung und Finanzierung sowie das Agieren technikkritischer Politikströmungen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts stehen. Zu fragen ist auch, welche Folgen daraus für das Arbeitsparadigma und das von ihm geprägte Wertesystem der Industriemoderne erwuchsen. Festzuhalten bleibt in jedem Fall der Zusammenhang mit einem neuen Technologieschub des Industrialisierungsprozesses, der in der Zeit um 1970 seine Wirkung zu entfalten begann.
Ein weiterer Gesichtspunkt betrifft die Geschichte der Arbeit unmittelbar. Der übliche und legitime Ansatz, die Entwicklung der Arbeit als sozialen, technischen, ökonomischen und kulturellen Prozeß von den europäischen und nordamerikanischen Industriezentren her zu betrachten und, was nicht einmal selbstverständlich ist, dann die industrielle Evolution oder Revolution in anderen Teilen der Welt vergleichend zu betrachten, vernachlässigt die „Temporalität“ der nordatlantischen Kernregion der Industriegeschichte.[72] Es bleibt dabei weitgehend außer Betracht, was es mit den oben genannten Indikatoren eines andauernden industriellen Wachstums auf sich hat. So wären etwa empirische Befunde zur Arbeit, vor allem zur industriellen Erwerbsarbeit in Afrika, Lateinamerika und Asien genauer zu prüfen. Man findet hier zum Beispiel Lohnformen, deren Wurzeln nicht im industriellen Kapitalismus liegen, die aber für die Verlagerung von Industriearbeitsplätzen überaus relevant sind.[73] Auch das gehört zur „Globalisierungsgeschichte der Arbeit“.[74] Man wird im Urteil darüber, was in Deutschland oder Europa geschieht, nicht ohne diese erweiterte Perspektive auskommen. Es ergibt zum Beispiel ein schiefes Bild, die Demontage einer erst 1992 im Ruhrgebiet in Betrieb genommenen Kokerei als Zeichen für das Ende der Industriearbeit und für den Beginn einer postmodernen Zeit zu nehmen, wenn man dabei außer acht läßt, daß diese Kokereianlagen 2004, sorgfältig zerlegt und in Kisten verpackt, via Rotterdam nach China verschifft, dort wieder aufgebaut wurden.[75] Das Gegenstück der in Dortmund entstandenen Industriebrache findet sich jetzt nahe der Stadt Zaozhuang im Nordosten Chinas. Die ehemalige Kokerei „Kaiserstuhl“, eine der modernsten der Welt, produziert dort seit 2006. In Dortmund hat man 2007 die beiden noch stehenden 165-m-Schornsteine gesprengt, einen davon so unglücklich, daß er auf die bislang erhaltenen Kokereigebäude stürzte.[76] Aber dies war wohl eher ein Symbol für die Wandlung, nicht für das Ende der industriellen Welt.
[1] Konrad H. Jarausch: Krise oder Aufbruch? Historische Annäherungen an die 1970er Jahre, in: Zeithistorische Forschungen 3 (2006) 3, S. 334-341, hier 334.
[2] Vgl. Ralph Dahrendorf: Im Entschwinden der Arbeitsgesellschaft. Wandlungen in der sozialen Konstruktion des menschlichen Lebens, in: Merkur 38 (1980) 8, S. 749-760; ders.: Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, in: Joachim Matthes (Hg.): Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982, Frankfurt am Main 11983, S. 25-37; Oskar Negt: Die Krise der Arbeitsgesellschaft: Machtpolitischer Kampfplatz zweier „Ökonomie, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ (APuZ), B 15/1995, S. 3-9; Gerd Schmidt (Hg.): Kein Ende der Arbeitsgesellschaft. Arbeit, Gesellschaft und Subjekt im Globalisierungsprozeß, Berlin 1999; André Gorz: Arbeit zwischen Misere und Utopie, Frankfurt am Main 2000.
[3] Vgl. u.a. Werner Faulstich: Gesellschaft und Kultur der siebziger Jahre. Einführung und Überblick, in: ders. (Hg.): Die Kultur der 70er Jahre, München 2004, S. 7-18, hier bes. S. 11-14; André Steiner: Bundesrepublik und DDR in der Doppelkrise europäischer Industriegesellschaften. Zum sozialökonomischen Wandel in den 1970er Jahren, in: Zeithistorische Forschungen 3 (2006) 3 342-362; Anselm Doering-Manteuffel: Nach dem Boom: Brüche und Kontinuitäten der Industriemoderne seit 1970, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 55 (2007) 4, S. 559-581.
[4] Michael S. Aßländer: Von der vita activa zur industriellen Wertschöpfung. Eine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte menschlicher Arbeit, Marburg 2005, S. 385.
[5] Vgl. Jürgen Kocka: Thesen zur Geschichte und Zukunft der Arbeit, in: APuZ B 21/2001, S. 8-13, hier 9.
[6] Margrit Grabas: Der Nachkriegsboom der 1950er und 1960er Jahre in Mittel- und Westeuropa – Modellcharakter für eine gesamteuropäische Prosperität im „postsocialist century“, in: Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung für Weltwirtschaft und Weltpolitik (IWVWW) e.V. (Hg.): Berichte November 2004, S. 8-27, hier bes. 9-18.
[7] Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München, 4. Aufl. 2000, S. 324-262; Stepan Alan Marglin/Juliet Schor (Hg.): The Golden Age of Capitalism, Oxford 1990.
[8] Vgl. Gerold Ambrosius/William H. Hubbard: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im 20. Jahrhunderts, München 1986, S. 293-297.
[9] William Brown/Herman Kahn/Leon Martel: Vor uns die guten Jahre, Wien/München/Zürich 1976, S. 310.
[10] Dieter Balkhausen: Die dritte industrielle Revolution. Wie die Mikroelektronik unser Leben verändert, Düsseldorf/Wien 1978. Später verwendete er den Begriff „elektronische Revolution“; vgl. ders.: Die elektronische Revolution, Düsseldorf 1985.
[11] Daniel Bell: Die dritte technologische Revolution und ihre möglichen sozialökonomischen Konsequenzen, in: Merkur 44 (1996) 1, S. 28-47.
[12] Dieter Otten: Die Welt der Industrie. Entstehung und Entwicklung der modernen Industriegesellschaften, 2 Bd., Reinbek bei Hamburg 1886.
[13] Manuel Castells: Das Informationszeitalter, 3 Bd., Opladen 2004.
[14] Einflußreich bes. Jean-Francois Lyotard: Das Postmoderne Wissen, Wien 1999; Jacques Derrida: Die Stimme und das Phänomen, Frankfurt am Main 2003; kritisch hierzu Bernd Goebel/Fernando Suárez Müller: Kritik der postmodernen Vernunft. Über Derrida, Foucault und andere zeitgenössische Denker. Darmstadt 2007; Wolfgang Welsch: Unsere postmoderne Moderne, Berlin 6. Aufl. 2002.
[15] Ulrich Beck: Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main 1995; ders.: Aufbruch in die zweite Moderne, in: Konrad Adam u.a. (Hg.): Stimmen gegen den Stillstand: Roman Herzogs „Berliner Rede“ und 33 Antworten, Hamburg 1997, S. 44-52.
[16] Ebd., S. 298.
[17] Helga Haftendorn: Sicherheit und Stabilität. Außenbeziehungen der Bundesrepublik zwischen Ölkrise und NATO-Doppelbeschluß, München 1986, S. 54.
[18] Zur Begriffs- und Perzeptionsgeschichte vgl. Frank Deppe: Politisches Denken im 20. Jahrhundert. Bd. 2: Politisches Denken zwischen den Weltkriegen, Hamburg 2009, S. 102-118.
[19] S. u.a. Ulrich Beck: Die Zukunft der Arbeit oder Die Politische Ökonomie der Unsicherheit, in: Berliner Journal für Soziologie, Bd. 9 (1999) 4, S. 467-478; ders.: Schöne neue Arbeitswelt, Frankfurt am Main 2007; Stefan Bender/DirkKonietzka/Peter Sopp: Diskontinuität im Erwerbsverlauf und betrieblicher Kontext, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 52 (2000) 3, S. 475-499; Peter A. Berger/Dirk Konietzka (Hg.): Die Erwerbsgesellschaft: neue Ungleichheiten und Unsicherheiten, Opladen 2002; Edeltraud Hoffmann/Ulrich Walwei: Normalarbeitsverhältnis: ein Auslaufmodell? Überlegungen zu einem Erklärungsmodell für den Wandel der Beschäftigungsformen, in; Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 32 (1998) 3, S. 409-425.
[20] Manuel Castells: Das Informationszeitalter. Teil 1: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Opladen 2004, S. 282–297, s.a. Christopher Freeman/Luc Soete: Work for All or Mass Unemployment? London 1994.
[21] Norbert Reuter: Arbeitslosigkeit bei ausbleibendem Wachstum – das Ende der Arbeitsmarktpolitik?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament (APuZ), B 35 (1997), S. 3–13, hier 5.
[22] Robert Castel: Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit, Konstanz 2000, S. 338f.
[23] Werner Abelshauser: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, München 2004, S. 423.
[24] Franz-Xaver Kaufmann: Normative Konflikte in Deutschland: Basiskonsens, Wertewandel und soziale Bewegungen, in: Peter L. Berger (Hg.): Die Grenzen der Gemeinschaft. Konflikt und Vermittlung in pluralistischen Gesellschaften. Ein Bericht der Bertelsmann-Stiftung an den Club of Rome, Gütersloh 1997, S. 155–197, hier 169.
[25] Ebd., S. 173.
[26] Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 436.
[27] Vgl. Suzanne Berger: Globalisierung und die Zukunft der Arbeit, in: Wilhelm Krull (Hg.): Zukunftsstreit, Weilerswist 2000, S. 87-100; Alain Touraine: Eine unzeitgemäße Vorstellung: Das Ende der Arbeit, in: ebd., S. 101-114.
[28] Alain Touraine: Eine unzeitgemäße Vorstellung: Das Ende der Arbeit, in: Wilhelm Krull (Hg.): Zukunftsstreit, Weilerswist 2000, S. 101-121, hier 107.
[29] Jarausch, Krise oder Aufbruch, S. 334.
[30] Castells, Der Aufstieg, S. 237.
[31] Tatjana Globokar/Michèle Kahn: Zur Beschäftigungsproblematik und Beschäftigungspolitik in Osteuropa, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 15 (1982) 3, S. 325-337.
[32] Dariusz Stola: Das kommunistische Polen als Auswanderungsland, in: Zeithistorische Forschungen 2(2005) 3, S. 345-365, hier 356-361.
[33] Globokar, Beschäftigungsproblematik, S. 326-328.
[34] Ebd., S. 328.
[35] Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an den IX. Parteitag der SED, in: Protokoll der Verhandlungen des IX. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Palast der Republik in Berlin, 18. bis 22. Mai 1976, Bd. 1: 1. bis 3. Beratungstag, Berlin 1976, S. 45, 47.
[36] Castel, Metamorphosen, S. 257-359.
[37] Maria Jahoda/Paul F. Lazarsfeld/Hans Zeisel: Die Arbeitslosen von Marienthal – ein soziographischer Versuch, Frankfurt am Main 1975, S. 83.
[38] Vgl. Ludwig Kaufmann: Ansätze einer Theologie der Befreiung in Europa? M.-D. Chenu (1895-1990), eine notwendige Erinnerung an französische Impulse, in: Heiner Ludwig/Wolfgang Schröder (Hg.): Sozial- und Linkskatholizismus. Erinnerung, Orientierung Befreiung, Frankfurt a. M. 1990, S. 261-284, hier 279: Octogesima adveniens (Paul VI. 1971), in: Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung in Deutschland – KAB (Hg.): Texte zur katholischen Soziallehre. Die sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Mit Einführungen von Oswald von Nell-Breuning SJ und Johannes Schaschning SJ, Kevelaer, 8. Aufl. 1992, S. 457-491.
[39] Ebd., S. 458.
[40] Vgl. Franz-Xaver Kaufmann: Der Sozialstaat als Prozeß - Für eine Sozialpolitik zweiter Ordnung, in: Franz Ruland/Bernd Baron v. Maydell/Hans-Jürgen Papier (Hg.): Verfassung, Theorie und Praxis des Sozialstaates. Festschrift für Hans Zacher zum 70. Geburtstag. Heidelberg 1998, S. 307-322.
[41] Laborem Exercens (Johanes Paul II: 1981), in: KAB, Texte, S. 529-601.
[42] Vgl. Klaus Schmidt: Göbekli Tepe and the Early Neolithic Sites of the Urfa Region: a synopsis of New results and Current Views, in: Neolithics. A Newsletter of Southwest Asian Lithics Research 8 (2001), H. 1, S. 9-11; ders.: Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. Die archäologische Entdeckung am Göbekli Tepe, München, 2. Aufl. 2006, S. 243-255.
[43] Aßländer, S. 154.
[44] Ebd., S. 157; s.a. Dirk Baecker: Archäologie der Arbeit, Berlin 2002; Manfred Bierwisch: Die Rolle der Arbeit in verschiedenen Epochen und Kulturen, Berlin 2003; Darmstädter, Tim: Transformation der Arbeit, Frankfurt/M. 2002; Frieder O. Wolf: Arbeitsglück. Untersuchungen zur Politik der Arbeit, Münster 2003.
[45] Eric L. Jones: The European Miracle, Cambridge 1981, S. 160.
[46] Michael S. Aßländer: Von der vita activa zur industriellen Wertschöpfung. Eine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte menschlicher Arbeit, Marburg 2005, S. 9.
[47] Hubert Treiber/Heinz Steiner: Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen, München 1980; Gerd Mutz: Strukturen einer neuen Arbeitsgesellschaft. Der Zwang zur Gestaltung der Zeit, in: APuZ B 9/1999, S. 3-11.
[48] Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800-1866: Bürgerwelt und starker Staat, München 1998, S. 228.
[49] Hartmut Kaelble: Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart, München 2007, S. 61.
[50] Vgl. Daniel Bell: Die nachindustrielle Gesellschaft, Hamburg 1973; Jean-François Lyotard: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Bremen 1982.
[51] Kaelble, Sozialgeschichte, S. 92; s.a. Donella H. Meadows, et al.: The limits to growth. A report for the Club of Rome’s project on The Predicament of Mankind, New York 1972 [dt.: Die Grenzen des Wachstums. Bericht an den Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart 1972].
[52] Rüdiger Safranski: Romantik. Eine deutsche Affäre, Darmstadt 2007.
[53] Vgl. u.a. Martin Heidenreich: Die subjektive Modernisierung fortgeschrittener Arbeitsgesellschaften, in: Soziale Welt 47 (1996) 1, S. 24-43; Ronald Inglehart: Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt, Frankfurt am Main 1995; ders.: Modernization and postmodernization, Economic and political Change in 43 societies, Princeton 1997; Frithjof Bergmann: Neue Arbeit, Neue Kultur, Freiamt im Schwarzwald 2004.
[54] Jeremy Rifkin: The end of work: the decline of the global labor force and the dawn of the post market-era, New York 1995; [dt.] Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft, Frankfurt/M. 1995, aktualisierte und erw. Neuaufl. 2005.
[55] Francis Fukuyama: The end of history, in: The National interest, Summer 1989, S. 3-18; ders.: The end of history and the last man, New York 1992 [dt. Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München 1992.
[56] „Langfristig wird die Arbeit verschwinden“. Interview Sönke Iwersen mit Jeremy Rifkin, 29.04.2005, aktualisiert 05.06.2008, Stuttgarter Zeitung online.
[57] Vgl. Michael Kittner: Arbeitskampf: Geschichte, Recht, Gegenwart, München 2005, S. 329-332; 615-619.
[58] Bernhard Kellermann: Der Tunnel, Berlin 1913.
[59] Statistisches Bundesamt (Hg.): Statistisches Jahrbuch 2006 für das Ausland, Wiesbaden 2006, S. 309.
[60] Manuel Castells: Das Informationszeitalter. Bd. 3: Jahrtausendwende, Opladen 2004, S. 10.
[61] Kaelble, Sozialgeschichte, S. 81.
[62] Statistisches Bundesamt (Hg.): Statistisches Jahrbuch 2008 für die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2008, S. 683.
[63] Vgl. Dietmar Fink/Thomas Köhler/Stephan Scholtissek: Die dritte Revolution der Wertschöpfung: mit Co-Kompetenzen zum Unternehmenserfolg, München 2004; Christian Ganowski/Johanna Joppe: Die Outsourcing-Falle: Wie die Globalisierung in den Ruin führen kann, Heidelberg 2007.
[64] Vgl. U.S. Bureau of Labor Statistics: International comparisons of annual labor force statistics. 10 countries, 1960-2007. Division of Foreign Labor Staatistics October 21, 2008, bes. S. 9 f. [www.bls.gov/fls].
[65] www.de.wikipedia.org/wiki/Kohle/Tabellen_und_Grafiken. 22.12.2008.
[66] Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2003 (May-July 2005). www.eia.doe.gov/iea/.
[67] www.de.wikipedia.org/wiki/Stahl/Tabellen_und_Grafiken.
[68] Manuel Castells: Das Informationszeitalter. Teil I: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Opladen 2004, S. 233.
[69] Dem liegt nach Jean Fourstié die Annahme zugrunde, daß sich moderne Wirtschaften aus (primären) Agrar- über (sekundäre) Industrie- zu (tertiären) Dienstleistungsgesellschaften entwickeln. Vgl. Jean Fourastié: Le grand espoire du XX siècle. Progrès technique, progress économique, progress social, Paris 1949 [dt. Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts, Köln 1954].f
[70] Zum Konzept der Dienstleistungsgesellschaft ausführlicher: Orio Giarini/Patrick M. Liedtke: Wie wir arbeiten werden. Der neue Bericht an den Club of Rome, Hamburg, 2. Aufl. 1998, S. 37, 135-246.
[71] Stephen Cohen/John Zysman: Manufacturing Matters: the Myth of Postindustrial Economy, New York 1987.
[72] Marcel van der Linden: Was ist neu an der globalen Geschichte der Arbeit, in: Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts 22 (2007) 2, S. 31-44, hier 34.
[73] Willem van Schendel: Neue Aspekte der Arbeitsgeschichtsschreibung: Anregungen aus Südasien, in: Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts 22 (2007) 1. S. 40-70, hier 41.
[74] Ebd., S. 69.
[75] Matthias Kamp: Wie eine Kokerei nach China auswandert, in: www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/wie-eine-kokerei-nach-china-auswandert [Wirtschaftswoche, 02.01.2004].
Zitation
Peter Hübner, Arbeitsgesellschaft in der Krise?. Eine Anmerkung zur Sozialgeschichte der Industriearbeit im ausgehenden 20. Jahrhundert , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/arbeitsgesellschaft-der-krise