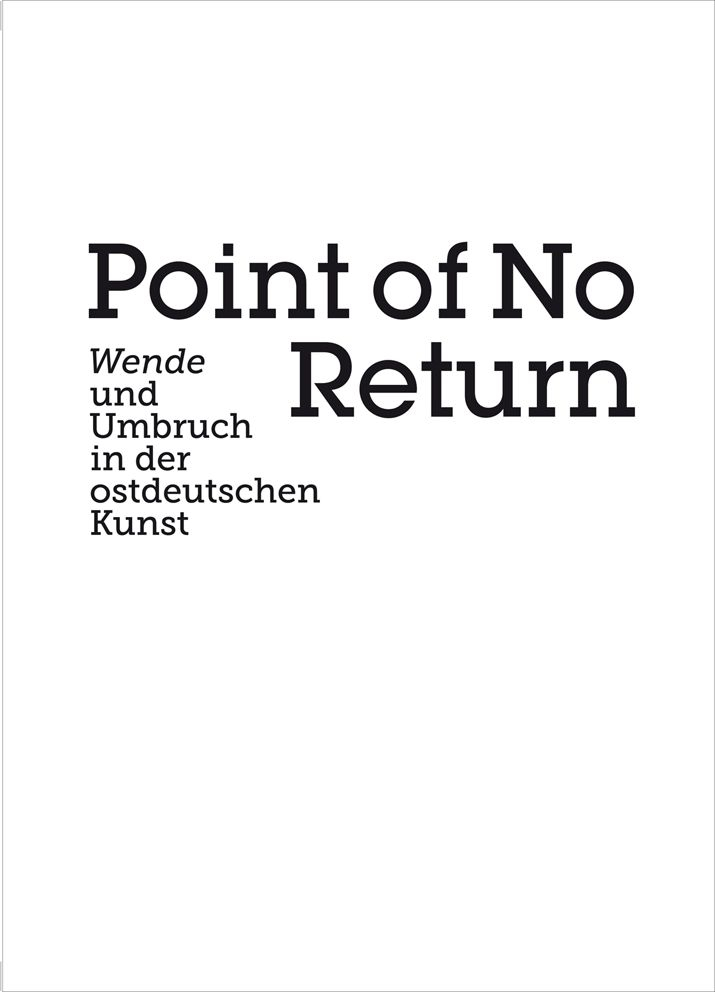Unter dem Titel Point of No Return zeigt das Leipziger Museum der bildenden Künste derzeit eine umfassende Ausstellung ostdeutscher Kunst zum Untergang der DDR. Über dreihundert Werke von mehr als hundert Künstler*innen aus den vergangenen vier Jahrzehnten wurden hierzu zusammengetragen. Es ist eine fulminante Rundschau auf eines der zentralen Ereignisse der Zeitgeschichte. Zudem ist es die erste ihrer Art.
Das Timing könnte kaum treffender sein. Die Ausstellung fällt mitten hinein in einen Herbst, in dem sich eine geballte politische Aufmerksamkeit auf den Osten richtet. Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben abermals einen öffentlichen Gesprächsbedarf bestätigt, der weit über diese und die mit ihnen verbundenen Fragen – Personalien, Koalitionen, Programmatiken – hinausreicht. Der Osten, so viel scheint klar, muss neu verstanden werden.
Was käme da besser gelegen, als eine Ausstellung, die den Mauerfall samt seiner Vorgeschichte und der „alles umfassenden Transformation“[1], die auf ihn folgte, aus der künstlerischen Perspektive derjenigen in den Blick nimmt, die ihn unmittelbar durchlebten? Zumal in vormals derart unbekannten Dimensionen, ausgebreitet über drei Etagen und mehr als 3.000 Quadratmeter? Das Kuratorentrio um den Leiter des Kunsthauses Bethanien, Christoph Tannert, den Kulturwissenschaftler Paul Kaiser und den Direktor des MdbK, Alfred Weidinger ist sich des historischen Moments der Ausstellung – und vor allem der Chance, die sie bietet – durchaus bewusst. Über die Kunst, proklamieren die Kuratoren in der Einführung des Katalogs, ließe sich nichts weniger als das „Maß zeithistorischer Gewissheiten sprengen“[2].
Allein, in der Ausstellung selbst bleibt all dies erst einmal außen vor. Jegliche Bezugnahmen auf die kontemporären Diskurse über Ostdeutschland – Strukturwandel, Rechtsradikalismus, Demokratiedefizite, you name it – sind gänzlich ausgespart. Eine ostdeutsche Geschichtsstunde und Mentalitätsstudie möchte die Ausstellung jedenfalls gewiss nicht sein. Überhaupt: Wenn die Kunst auch wie kein zweites Medium in der Lage sei, „das notwendige Verständnis kultureller, geschichtlicher und politischer Ereignisse mitsamt ihren Folgeprozessen“[3] zu vermitteln, entziehe sie sich ihnen doch zugleich. Vielmehr folge sie spezifischen, eben künstlerischen, ästhetischen „Eigengesetzen […], die sich nur sehr bedingt in die politische Dramaturgie der Zeitenläufe einordnen“[4] ließen.
Sie offenzulegen ist das eigentliche Anliegen der Ausstellung. Der Point of No Return wird so als ausgedehnter Prozess präsentiert, in dem sich die ganze Pluralität ostdeutschen Kunstschaffens wie unter dem Brennglas darstellen lässt. Eine allzu pralle politische Agenda liefe dem zuwider. Aufzeigen und Zuspitzen hieße, weniger öffnen als zu verengen, den Blick zu verstellen für die ungeahnte Wucht und Diversität der Werke selbst. „Die Komplexität des Heterogenen“, schreiben die Kuratoren, sei ohnehin „nicht auf ein Narrativ vermeintlicher Relevanz zu bringen“[5]. Stattdessen ginge es darum, eine „temporäre Arena der unterschiedlichsten Optionen“ zu schaffen und einen „Möglichkeitsraum für einen grenzüberschreitenden Erkenntnisgewinn“.[6]
Die Kunst, mit anderen Worten, gilt es zuerst einmal, als Kunst zu begreifen – und eben nicht als kulturhistorische Zeugnisse. Konsequenterweise sind die Räume und Hallen der Ausstellung dann auch in erster Linie mit den Werken selbst bestückt. Begleitet und gerahmt werden sie nur von knappen Überblickskommentaren. Sie fungieren jedoch mehr als vorsichtige Fingerzeige denn als selbstbewusste Kontextualisierungen, mal auf bestimmte Charakteristika der Werke selbst, mal auf deren Hintergründe. Immer aber scheinen sie darum bemüht, nur nicht zu viel vorzuschreiben, zu erklären, vor allem nicht: zu rechtfertigen. Die ausgestellten Werke, das wird schnell deutlich, sollen allesamt für sich stehen – und bestehen.
Nun ist diese weitestmögliche Absage an jegliche politische Einbettung (oder besser, im Sinne der Kuratoren: Vereinnahmung) selbst nicht minder politisch. Knapp dreißig Jahre, nachdem Georg Baselitz erklärte, in der DDR habe es „keine Künstler“ gegeben – „nicht einmal Jubelmaler“, sondern „ganz einfach Arschlöcher“[7] - steht die Kunst aus dem Osten immer noch unter einem spürbaren Legitimationsdruck. Immerhin schien die deutsche Museumslandschaft dem Starmaler und Fließband-Provokateur lange zuzustimmen. Werke ostdeutscher Provenienz jedenfalls wurden nach dem Zusammenbruch der DDR bald allerorts abgehängt. Erst vor wenigen Jahren – mit dem Abstand einer Generation, die das historische und kulturelle Erbe der DDR noch einmal abseits einer bundesrepublikanischen Siegeserzählung neu verorten möchte – ist auch ein neuerliches Interesse ihrer Kunst aufgekommen.[8]
Die kuratorische Würdigung der in Leipzig ausgestellten Werke steht in eben diesem Zusammenhang. Indem sie unter dem Banner schier grenzenloser künstlerischer Vielschichtigkeit präsentiert werden, bilden sie einen eindrucksvollen Gegenentwurf zu einem öffentlichen Geschichtsbild, das die DDR immer noch und ausschließlich über das Unrechtssystem der Stasi begreift.
Gänzlich neu ist das nicht. Schon vor drei Jahren etwa zeigte der Martin-Gropius-Bau, abermals unter der Leitung von Christoph Tannert, eine Ausstellung der „Gegenstimmen. Kunst in der DDR 1976–1989“ in ganz ähnlicher Weise. Doch dieses Mal ist der Ansatz geglückter. Denn während die Berliner Ausstellung unmittelbar politischen Kriterien gefolgt war – es ging um Dissidenten-Kunst, die zuerst einmal von der Regimeferne der Künstler*innen ausging, nicht der ästhetischen Finesse ihrer Werke – ist der Rahmen dieses Mal ein thematischer.[9] Im Fokus steht die „Wende“ in ihrer ganzen historischen Weite und ihre Repräsentation von Künstler*innen unterschiedlichster politischer Couleur. „Rebellen und Reformer“ treten so neben „Staatskünstler“, „Hiergebliebene“[10] neben Nachgeborene.
Und tatsächlich entfalten die Werke gerade ohne kuratorische Hinführung und Herleitung ein Panorama der Perspektiven, das sich einer Schwarz-Weiß-Wahrnehmung der DDR als bloße Mitläufer- und Oppositionellen-Gesellschaft eindrucksvoll widersetzt. Weitgehend auf sich allein gestellt, ist es an den Besucher*innen, die Bilder und Skulpturen selbst zum Ausgangspunkt eines Verständnisses zu machen. Ein durchaus anspruchsvolles, mitunter frustrierendes Unterfangen. Denn ein ums andere Mal offenbart sich hier eine Bilderwelt, die sich allzu klaren Deutungen zu entziehen scheint. So kann es zwar verlockend sein, Lutz Friedels Adler (Brüder) von 1989 als symbolische Antizipation der nachfolgenden Transformationskonflikte zu lesen. Doch eine solche Lesart muss spekulativ bleiben. Schließlich ist sie mehr dem Arrangement der Ausstellung geschuldet, das die „Wende“ klugerweise als Prozess und nicht als Ereignis fasst. Umso mehr gilt dies für die Kunst der Nachwendejahre. Wie Paul Kaiser in seinem brillanten Beitrag für den Katalog betont, sei es schon wegen der „irritierenden Eigenerschütterung des Kunstsystems“ ein „ großer Irrtum […] zu glauben, dass gerade von den Künsten schnelle Gewissheit über etwas zu erwarten sei, das im alltagskulturellen Verständnis breiter Bevölkerungsschichten auf die nebulöse Formel einer bloßen Wende reduziert wurde“.[11]
Nein, das Walten von Auguren ist in den Werken der Ausstellung nicht zu finden. Jedenfalls nicht im Sinne einer verschlüsselten Bildersprache, die – weiß man sie nur zu lesen – prophetische Einblicke in die Wirkweisen des nahenden Umbruchs ermöglicht. Auch der Blick „Hinter die Maske“, den das Potsdamer Museum Barberini noch im vergangenen Jahr zum titelgebenden Programm einer Ausstellung über DDR-Kunst erhoben hatte, wird in Leipzig nicht anvisiert. In Norbert Wagenbretts Aufbruch etwa sind zwei Personen zu sehen, deren Köpfe und Unterarme durch eine raue Oberfläche drängen. Es ist weder eindeutig auszumachen, ob sie vor- oder zurückdrängen (oder beides), noch, was sich hinter (oder vor) der Schicht verbirgt, durch die sie sich winden. In ganz ähnlicher Weise bestimmt das Unbestimmte auch Trak Wendischs Mann mit Koffer, dessen buchstäbliche Beweggründe gänzlich offenbleiben. Den Kragen hochgestellt und die Augen zusammengekniffen, ist kaum zu sagen, ob der stehende Reisende gerade ankommt oder fortgeht, innehält oder umkehrt.
Nur wenige Werke sind dabei so eindeutig wie Sighard Gilles gigantische Installation Auswildern aus den frühen 1990er Jahren. Zahlreiche Körper hängen hier, in unterschiedlichen Höhen und Positionen, an langen Seilen. Manche klettern empor, andere ringen mit dem Absturz, wieder andere wirken wie gefesselt, einige wenige haben es ganz sein lassen und sich auf den waldigen Boden gesetzt. Gille gab hiermit der für ehemalige DDR-Bürger*innen disruptiven Erfahrung des Systemwechsels ebenso wie den Variationen ihrer Adaptionsvermögen einen künstlerischen Ausdruck. Eindeutig – dabei nicht minder komplex und eindrücklich – ist die Installation aber nicht zuletzt, weil die Grenze zwischen Individuum und System, Körper und Seil, so klar gezogen ist. Ein Großteil der Werke aber scheint eben diese Trennung aufzuheben. In Hans Tichas Agitator etwa sind Mensch und Maschinerie als Pole der Propaganda zu einem einzigen absurden Körper verschmolzen.
Es ist ein immer wiederkehrendes Motiv. Quer durch das zeitliche, ästhetische, auch und gerade das politische Spektrum der Ausstellung hindurch stehen Körper, genauer: abstrahierte, verzerrte, letztlich verfremdete Körper im Mittelpunkt der Werke. Dies mag zufällig sein – die Herausgeber jedenfalls gehen hierauf nicht weiter explizit ein – und scheint es doch wieder nicht.
Betrachtet man den Körper, wie dies der britische Medizinhistoriker und Pionier der body history Roy Porter vorgeschlagen hat, als „Vermittler zwischen Selbst und Gesellschaft“[12], wird erkennbar, wie tiefgreifend die „Wende“, häufig lange vor und nach der Friedlichen Revolution selbst, in weiten Kreisen der ostdeutschen Gesellschaft erlebt wurde. Dabei ist es gerade das Offene, Uneindeutige und Unsichtbare in den Werken, das sie als historische Zeugnisse so spannend macht. Diese existentielle Ungewissheit gerade durch den Verzicht auf jegliche Leitfäden vermittelt zu haben, ist vielleicht der große Verdienst der Kuratoren.
Doch er hat auch eine Kehrseite. Denn so sehr die ausgestellten Werke ihre Wirkung erst außerhalb eines geschichtlichen Kontextes entfalten, sind sie doch daran gebunden. Bilder und Skulpturen, ebenso wie Fotografien, Tagebücher oder Gesetzesverordnungen, erklären sich schließlich nicht aus sich selbst heraus. Immer bedarf es eines Bezugsrahmens, in dem sie entstehen und vor dessen Hintergrund ihre Funktionen und Bedeutungen sichtbar werden. Gerade dies aber spart die Ausstellung bewusst aus. Mit Ausnahme von Frank Rub, dessen Bildnisse seiner eigenen Verhaftung durch ein Schreiben des Ministeriums für Staatssicherheit begleitet werden, bleiben die Werke stets für sich – und ihre Hintergründe verdeckt.
Das ist umso gravierender, da die Kuratoren selbst den ausgestellten Künstler*innen ein mitunter gewichtiges politisches Potential beimessen. Immerhin, so Paul Kaiser, ermöglichte „[e]rst die Existenz einer künstlerischen Gegenkultur […] in den 1970er und 1980er Jahren die lebensweltliche Grundlage, auf der sich dann in der späten DDR politische Initiativen, Gruppen und Programme auszudifferenzieren vermochten.“[13]
Nur sieht man das den Bildern selbst nicht immer an. Wenn die DDR-Bohème auch explizit um das Schaffen einer unabhängigen Kunst und damit gleichsam eines freien Lebens kreiste, waren die Werke, die hieraus entstanden, doch mehr punktuelles Produkt als umfassendes Abbild dieser Suche. Ohne sie ist ihr Wirken kaum zu verstehen. Nur durch sie aber auch nicht. Die „raffinierten, nichthierarchischen und quicklebendigen“[14] Netzwerke einer künstlerischen Dissidenz jedenfalls, denen auch Christoph Tannert in seinem Beitrag für den Katalog nachgeht, bleiben hinter ihren künstlerischen Hervorbringungen verborgen.
Was auf die subversiven Zirkel zutrifft, gilt in gleicher Weise auch darüber hinaus. Von politischer Relevanz, das ist eine der Kernbotschaften der Ausstellung, waren schließlich nicht nur radikal Oppositionelle auf der einen und hoch protegierte Staatsmaler auf der anderen Seite. Vielmehr ist gerade die „Landschaft der Mitte“[15], in der sich „halbdistanzierte Beobachter und zugleich in den Prozess verstrickte Akteure“[16] tummelten, entscheidend für ein Verständnis künstlerischen Lebens in der DDR. Spielte sich doch nicht zuletzt hier, in den flyover states des polarisierten „Bilderstreits“, ein Gros des ostdeutschen Kunstschaffens ab. Durch die Leipziger Ausstellung erfahren ihre Werke nun eine überfällige Rehabilitierung. Die Welten dahinter aber gilt es weiter zu ergründen.
Die Ausstellung Point of No Return läuft vom 23. Juli bis 03. November im Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig. Öffnungszeiten: Di, Do-So 10-18 Uhr, Mi 12-20 Uhr. Eintritt 10 (ermäßigt 7) Euro, Abendkarte 5 Euro.
Begleitkatalog zur Ausstellung Point of No Return:
„Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst“. Herausgegeben von Paul Kaiser, Christoph Tannert und Alfred Weidinger, München 2019: Hirmer Verlag.
[1] Aus dem Einführungstext der Ausstellung
[2] Paul Kaiser, Christoph Tannert, Alfred Weidinger, Einführung der Herausgeber, in: Dies. (Hrsg.): Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, München 2019: Hirmer-Verlag, S. 7-10, hier: S. 9.
[3] Ebd., S. 7.
[4] Ebd.
[5] Ebd., S. 8.
[6] Ebd., S. 8-9.
[7] Georg Baselitz, Ein Meister, der sein Talent verschmäht. Interview in: art. Das Kunstmagazin, Nr. 6/90, S. 54-72, hier: S. 71.
[8] Vgl. Jennifer L. Allen, Against the 1989–1990 Ending Myth, in: Central European History 52 (2019), 125–147.
[9] Vgl. Die „pseudodissidentischen Brummkreisel“ der DDR-„Dissidenz“. Die Ausstellung „Gegenstimmen“ im Berliner Gropius-Bau und ihr sprachliches Begleitprogramm, in: Zeitgeschichte-online, Potsdam, September 2016.
[10] Paul Kaiser, Christoph Tannert, Alfred Weidinger, Einführung der Herausgeber, in: Dies. (Hrsg.): Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, München 2019: Hirmer-Verlag, S. 7-10, hier: S. 9
[11] Paul Kaiser, „1989“ und die ostdeutsche Kunst, in: Ders., Christoph Tannert, Alfred Weidunger: Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, München 2019: Hirmer-Verlag, S. 12-37, hier: S. 15-17.
[12] Roy Porter, History of the Body Reconsidered, in: Peter Burke (Hrsg.): New perspectives on historical writing. University Park, Pa 2001: Penn State University Press, S. 233–260, hier: 236.
[13] Paul Kaiser, „1989“ und die ostdeutsche Kunst, in: Ders., Christoph Tannert, Alfred Weidunger: Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, München 2019: Hirmer-Verlag, S. 12-37, hier: S. 29.
[14] Christoph Tannert, Pflöcke im Niemandsland. Rückblicke auf eine Kunst der Selbstbehauptung in der DDR, in: Ders., Paul Kaiser, Alfred Weidinger: Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, München 2019: Hirmer-Verlag, S. 38-65, hier: S. 63.
[15] Paul Kaiser, Christoph Tannert, Alfred Weidinger, Einführung der Herausgeber, in: Dies. (Hrsg.): Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, München 2019: Hirmer-Verlag, S. 7-10, hier: S. 8.
[16] Paul Kaiser, „1989“ und die ostdeutsche Kunst, in: Ders., Christoph Tannert, Alfred Weidunger: Point of No Return. Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst, München 2019: Hirmer-Verlag, S. 12-37, hier: S. 17.
Zitation
Robert Mueller-Stahl, Das grelle Grau des Untergangs. Über die Ausstellung Point of No Return im Museum der bildenden Künste Leipzig , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/das-grelle-grau-des-untergangs