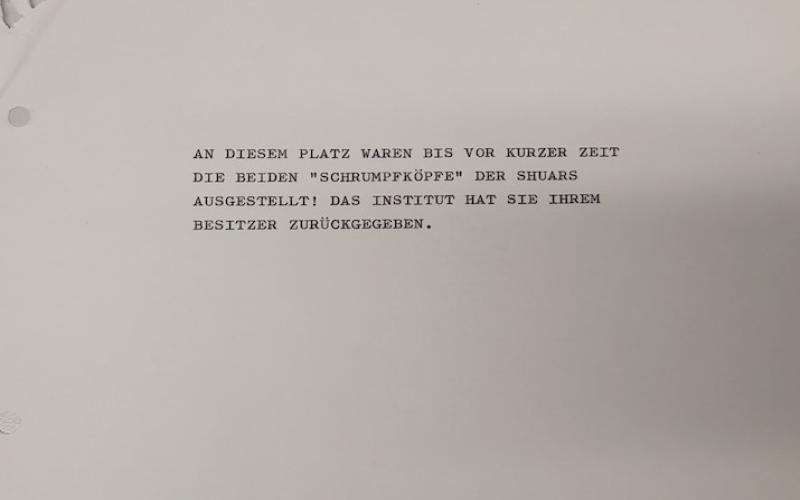Die Vorwürfe gegen den Kameruner und in Südafrika lebenden Historiker Achille Mbembe, er sei Antisemit, „Israel-Hasser“ und habe zudem den Holocaust relativiert, lösten eine kontroverse und verbissene Diskussion aus, die in Feuilletons, sozialen Medien, aber auch auf politischer Ebene insbesondere Mitte letzten Jahres heftig ausgetragen wurde. In diesem Zusammenhang gerieten auch die diversen heterogenen, unter dem Signet „postkoloniale Theorie“ firmierenden Ansätze unter Beschuss, für die Mbembe als wichtigster afrikanischer Repräsentant steht, obgleich er sich mehrfach von ihnen distanziert hat. So beklagte er etwa in seinem Buch „On the Postcolony“ (2000) die Gegenstandsferne postkolonialer Perspektiven auf Afrika, die komplexe Phänomene wie Staat und Macht auf Diskurse und Repräsentationsmodelle reduzieren würden.
Aber der Reihe nach. Es erscheint sinnvoll, sich zunächst kurz die Genealogie postkolonialer Studien in Erinnerung zu rufen und an einige der zentralen kritischen Perspektiven auf gängige eurozentrische Weisheiten zu erinnern, die sie in den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs eingebracht haben. So betonte Edward Said in seinem häufig als Gründungsmanifest der postkolonialen Studien etikettierten Buch „Orientalismus“ von 1978 den Zusammenhang von Wissen und Macht. Eng angelehnt an die Ansätze von Michel Foucault beschrieb er den Diskurs des Orientalismus, die Beschreibung „anderer“ Völker in wissenschaftlichen Texten, nicht als neutrales Unterfangen, sondern als Konstruktion im Kontext ungleicher – kolonialer – Machtverhältnisse.
Said ist zu Recht vorgeworfen worden, Machtpotential und tatsächliche Machtausübung in nahezu essentialistischer Weise bei den Kolonialherren verortet und den Kolonisierten letztendlich jegliche Handlungskompetenz abgesprochen zu haben. Zugleich hat er mit seinem Werk aber jene grundlegende Einsicht gefördert, dass die diskursive Ordnung der kolonialen Epoche mit dem Ende der Kolonialregierungen nicht automatisch vorüber war. Überdies wandte er sich eindringlich gegen dichotomische „der Westen und der Rest“-Unterscheidungen, also gegen Perspektiven, westliche Entwicklungen von den Konstellationen im Rest der Welt kategorisch abzugrenzen.
Insbesondere der indische, in Chicago lehrende Historiker Dipesh Chakrabarty hat Saids Einsichten weitergeführt und in seiner einflussreichen, auch hierzulande gern zitierten Studie „Provincialising Europe“ (2000) darauf verwiesen, dass in der Praxis der Historiker:innen permanent historische Asymmetrien reproduziert werden: Forscher:innen, die Asien und Afrika untersuchen, beziehen sich ständig auf europäische Modelle und Stile der Geschichtsschreibung, während diejenigen, die über Europa schreiben, die Freiheit haben, die Erfahrungen von Asiat:innen und Afrikaner:innen zu ignorieren. Die unreflektierte Anwendung spezifischer, im Westen entstandener Konzepte, Theorien und Methoden habe zu der problematischen Sicht geführt, Europas historische Entwicklung sei „natürlich“, der Rest „abweichend“ und „erklärungsbedürftig“.
Chakrabarty gehörte wiederum zu einer Gruppe indischer Wissenschaftler:innen, die in den siebziger und achtziger Jahren unter der Bezeichnung „Subaltern Studies“ ebenfalls zu den zentralen Ideengebern postkolonialer Ideenbildung zählten. Kritische Verbündete dieser Gruppe war die Literaturwissenschaftlerin Gayatri C. Spivak, deren ebenso berühmter wie umstrittener Text „Can the Subaltern Speak?“ (1985) argumentierte, dass es Subalternen im Kontext bestehender Machtverhältnisse nicht möglich sei, ihre heterogenen Anliegen wahrnehmbar zu machen, sich gleichsam erfolgreich zu repräsentieren. In den letzten Jahren wird zunehmend Frantz Fanon, der früh verstorbene radikale Theoretiker einer antikolonialen Revolution, als eine Art Gründungsvater der postkolonialen Theorie gehandelt. Sein Klassiker „Die Verdammten dieser Erde“ (1961) und andere Werke zeichnen sich durch eine Melange aus außergewöhnlicher, zuweilen prophetischer Luzidität und einer essentialistischen, ahistorischen Deutung der kolonialen Situation aus. Sie sind aber bis heute nicht zuletzt deshalb stimulierend, weil sie jede kulturalistische und identitäre Interpretationen des Politischen ablehnen.
Fanon entgingen jedoch die Ambivalenzen der kolonialen Ordnung, die Versuche und begrenzten Möglichkeiten der Kolonisierten, sich mit den Einmischungen und Zumutungen der Kolonialherren auseinanderzusetzen, sie gelegentlich gar für sich zu nutzen. Er reduzierte den Kolonialismus auf einen binären Antagonismus, machte aus ihm eine manichäische Welt. Auch an Mbembe und andere Autoren im Umfeld der postkolonialen Studien ist – im Übrigen nicht erst durch das deutsche Feuilleton –– mit einiger Berechtigung der Vorwurf herangetragen worden, sich auf einen sehr allgemeinen und folglich wenig aussagekräftigen Kolonialismusbegriff zu stützen, der Besonderheiten in Zeit und Raum, soziale Unterschiede und kulturelle Dynamiken einebnet. Diese Kritik darf jedoch nicht die enorm wichtigen Anstöße postkolonialer Ansätze beiseite schieben, darunter die Einsicht, dass sich die Verflechtung der Welt seit dem 19. Jahrhundert nicht von den kolonialen Bedingungen trennen lässt, unter denen sie sich vollzog, dass Sklaverei, Gewalt, Rassedenken, Rassismus und Kolonialismus konstitutiv für die Gegenwart sind, auch in Deutschland, das lange glaubte, mit Kolonialismus eigentlich kaum etwas zu tun gehabt zu haben.
Gegenwärtig werden die Texte Mbembes und anderer postkolonialer Autor:innen zuvorderst allerdings auf ihre Aussagen zum Judentum, zum Holocaust und zu Israel hin seziert. Das ist selbstverständlich legitim, muss aber wichtige Kontexte im Auge behalten. Einer davon ist es, zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren, dass, wie es die Journalistin Charlotte Wiedemann prägnant benannt hat, viele Menschen in der Welt „nicht unsere Tätergeschichte teilen, einen anderen Blick auf Israel haben“ und ausschließlich des Holocausts zu gedenken, als „weißes Privileg“ betrachten.[1] Bezüge etwa zu Kolonialverbrechen herzustellen, bedeutet keineswegs Relativierung der Shoah oder mindert ihr Gewicht. Zahlreiche schwarze Intellektuelle wie W.E.B. Du Bois und Aimé Césaire etwa, die fortdauernde koloniale Gewalt, den ungebrochenen Rassismus und nicht zuletzt die schändliche Behandlung der vielen schwarzen Soldaten vor Augen führten, die im Zweiten Weltkrieg für die Alliierten kämpften und starben, entwickelten in der Nachkriegszeit ein provozierendes Argument: Der Nationalsozialismus mit seinen ungeheuerlichen Gräueltaten repräsentiere keineswegs das „deutsche Andere“ eines ansonsten zivilisierten Westens. Vielmehr hätten die Deutschen die De-Zivilisierung Europas lediglich auf die Spitze getrieben. Sie wendeten den jahrhundertelang praktizierten Kolonialrassismus des Kontinents gegen diesen selbst.
Bezeichnend für die gegenwärtige Atmosphäre ist die überwiegende Reaktion all jener Institutionen und Personen in Deutschland, die sich gerne im Glanz einiger postkolonialer Denker:innen wie Mbembe sonnten, welche zu Stimmen des „globalen Südens“ auserkoren worden waren. Mit den Antisemitismus- und Relativierungsvorwürfen ist der eben noch chice Postkolonialismus gleichsam über Nacht in die Schmuddelecke geraten. Bis auf wenige Ausnahmen haben sich alle Stiftungen, Universitäten, Verlage, Kultureinrichtungen und Behörden, die mit der Einladung an Mbembe nicht zuletzt die eigene Weltläufigkeit zu demonstrieren suchten, weggeduckt. Die potentiell verheerenden Folgen der „Causa Mbembe“ für den Wissenschaftsstandort Deutschland, aber auch für die auswärtige Kulturpolitik deuten sich bereits an. Und nicht zuletzt offenbart sich erneut die wachsende Unfähigkeit, auch von Wissenschaftler:innen, Publizist:innen und Politiker:innen, Ambivalenzen zu ertragen, wie sie etwa postkoloniale Perspektiven in sich tragen.
Dieser Text erschien erstmals im Rotary Magazin unter dem Titel Postkolonialismus und die Cause Mbembe (Juni 2020) und wurde mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des Rotary Magazins sowie des Autors hier zweitveröffentlicht.
[1] Charlotte Wiedemann: Privileg und Gedenken. Zwischen 8. Mai und Mbembe: Es ist Zeit, eurozentrische Geschichtsbilder zu überwinden – gerade in Deutschland, in: taz, 13.05.2020.
Zitation
Andreas Eckert, Verheerende Folgen für den Wissenschaftsstandort Deutschland?. Postkolonialismus und die Causa Mbembe (Reprint), in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/verheerende-folgen-fuer-den-wissenschaftsstandort-deutschland