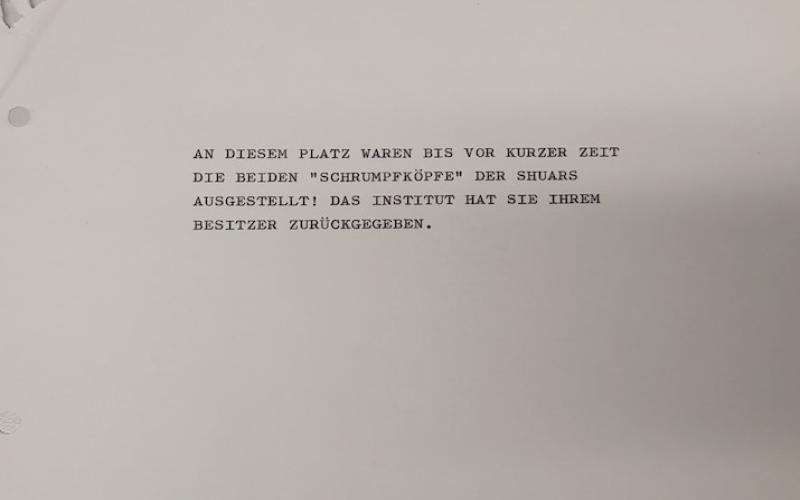Auf dem Höhepunkt der internationalen Auseinandersetzung um postkoloniale Restitutionsfragen tagte im Mai 1980 erstmals ein neuer UNESCO-Ausschuss mit der kuriosen Bezeichnung Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case of Illicit Appropriation. Das kurz ICPRCP genannte Komitee sollte als vermittelnde Instanz zwischen Kulturgüter besitzenden und zurückfordernden Staaten tätig werden. Doch seine Gründung wurde, davon zeugt dieser Name, von heftig geführten Deutungskämpfen über die zentralen Begriffe „restitution“ und „return“ begleitet.
Restitution, Rückgabe, oder auch Transfer gehören heute zum Standardvokabular von postkolonialer Museumspraxis und auswärtiger Kulturpolitik, in der medialen Berichterstattung werden sie oft synonym verwendet. Dabei waren diese Termini ursprünglich eng mit divergierenden Interpretationen der kolonialen Vergangenheit, institutionellen Selbstverständnissen und entwicklungspolitischen Interessen verbunden.
Ein Komitee für Restitutionsfragen
Das ICPRCP war ein Kind der internationalen Konferenzdiplomatie. Im Mai 1980 blickte es bereits auf einen längeren Werdegang zurück. Nach Jahren der internationalen Auseinandersetzung über mögliche Wege des Umgangs mit postkolonialen Restitutionsforderungen war ein von der UNESCO einberufenes internationales Expertentreffen in Venedig 1976 zu der Empfehlung gelangt, offene bilaterale Restitutionsverhandlungen zwischen kulturgutbesitzenden Staaten und jenen, die Kulturgüter zurückforderten, mit Hilfe eines zwischenstaatlichen Ausschusses beizulegen. Die politische Empfindlichkeit des Themas war zu diesem Zeitpunkt offenkundig geworden. Während die UNESCO schon bei der Einladung von Fachleuten Fingerspitzengefühl beweisen musste, warnte der Direktor des Stuttgarter Lindenmuseums, ein Ethnologe mit guten Verbindungen in die Bonner Kulturpolitik, gegenüber der westdeutschen Vertretung in Paris „bei diesen ganzen Gesprächen [...] ein schlechtes Gewissen zu präsentieren und zu dokumentieren.“[1] Seine Haltung beruhte unter anderem auf der Überzeugung, dass der überwiegende Teil der hiesigen Museumssammlungen „völlig legitim erworben“ sei.[2] Ähnlich sah es der Deutsche Museumsbund in einem Thesenpapier vom Januar 1976: Die Sammlungstätigkeit der Industrienationen sei eine „unschätzbare Kulturtat im Interesse der ganzen Menschheit“ gewesen und keinesfalls als Enteignung oder Diebstahl zu bezeichnen.[3] Als der Internationale Museumsrat (ICOM) ein Jahr nach dem Treffen von Venedig im Auftrag der UNESCO eine Studie über die Prinzipien, Voraussetzungen und Mittel der Restitution oder Rückgabe von Kulturbesitz veröffentlichte, nahm die Kategorie mit dem pragmatischen Titel „Hindernisse und Mittel diese zu überwinden“ darin beträchtlichen Raum ein. Mit dem Begriff Restitution, so ist darin zu lesen, seien „psychologische Schwierigkeiten“ verbunden, weil dieser die bisherige Unrechtmäßigkeit von Kulturbesitz impliziere – ein Umstand der in vielen Staaten und auch bei Privatpersonen schwierig zu akzeptieren sei, da er sie zu „Angeklagten“ in einer Sache mache, die diese für völlig gesetzmäßig hielten. Wie schon im Abschlussbericht der Venedig-Tagung wurde in der ICOM-Studie daher immer dann, wenn von Rückgaben die Rede war, die offene Formulierung „restitution or return“ gewählt. Die Regelung galt auch für die Satzung des neu zu gründenden Komitees, dem späteren ICPRCP, die schließlich im Sommer 1978 als erste Entwurfsfassung vorlag und auf der 20. UNESCO-Generalkonferenz im Herbst desselben Jahres verabschiedet werden sollte.
Kein Tribunal der „Dritten Welt“
Im Auswärtigen Amt, der Kultusministerkonferenz und in den Direktionen wichtiger westdeutscher Kulturinstitutionen sah man einer weiteren Institutionalisierung der Restitutionsfrage durch die bevorstehende UNESCO-Generalkonferenz mit einigem Unbehagen entgegen. Zwei Jahrzehnte nach dem „afrikanischen Jahr“ 1960 hatten sich die Organisationen der „Third World UN“ als ein wichtiges Forum dekolonisationspolitischer Debatten etabliert. In Bezug auf die Restitutionsfrage verspürten die Delegationen der westlichen Staaten, aber auch die der DDR[4] seit Beginn der 1970er Jahre wachsenden internationalen Druck. Vor diesem Hintergrund fand einige Wochen vor Beginn der Pariser Sitzungen ein kulturpolitisches Spitzentreffen im Haus der Deutschen UNESCO-Kommission statt.[5] Es sei, so lautete die Einschätzung der dort Anwesenden, „nicht möglich, die Bildung des zwischenstaatlichen Komitees zu verhindern“ und außerdem zu befürchten, dass es „von seiten der Dritten Welt zum Tribunal gemacht wird“. Um „zu vermeiden, daß das Komitee eine effektive Machtstellung erlangt“ erörterte die Runde diverse Änderungen am vorliegenden Satzungsentwurf. Diese betrafen die Zusammensetzung und Beschlussordnung, aber auch neue Aufgaben im Bereich der kulturellen Entwicklungshilfe durch die „der Grundcharakter des Komitees entscheidend verändert“ würde. Keinesfalls etwa solle es auf die Erstellung von Objektverzeichnissen der in westlichen Ländern befindlichen Museumssammlungen hinwirken, denn „[so] würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt“.[6] Die Aufzeichnungen des Treffens zeigen auch, dass eine Lösung der inhaltlichen Fragen vor allem über die Ebene der Sprache angestrebt wurde. Der originale Satzungsentwurf des Komitees wurde umformuliert. Verben und Substantive, die einer dynamischen Handlungserklärung Ausdruck gaben oder auf die Dringlichkeit der dem Komitee zugrundeliegenden Aufgaben verwiesen, fielen dem Rotstift zum Opfer. In den weiteren Verhandlungen müsse insbesondere der Begriff Restitution „abgewehrt werden“, um den „Eindruck juristisch unsauberen Erwerbs“ und eine „moralische Verpflichtung“ zu vermeiden. Als unbedenkliche Alternative zu „Restitution“ wurde der Begriff „Transfer“ ins Gespräch gebracht.
Auf der UNESCO-Generalkonferenz in Paris legten die Delegationen der Bundesrepublik und Frankreichs dann gemeinsam einen umfassenden Änderungsvorschlag für die Satzung des Zwischenstaatlichen Komitees vor. Dieser Entwurf, aus dem das Wort „Restitution“ komplett gestrichen worden war, stieß in der zuständigen Programmkommission auf heftigen Widerstand von Seiten der zurückfordernden Staaten. Letztendlich konnte der umkämpfte Begriff in Titel und Satzungstext des neuen Komitees nur beibehalten werden, weil man sich darauf einigte, ihn durch den Zusatz „in case of illicit appropriaton“ zu ergänzen. „Restitution“ wurde auf diese Weise fest mit Fällen des illegalen Exports von Kulturgütern verknüpft und im Geltungsbereich der UNESCO-Konvention über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut aus dem Jahr 1970 verortet. Kulturgutverlagerungen vor 1970, die nicht im Geltungsbereich der Konvention lagen – entsprechend alle kolonialzeitlichen Sammlungen – fielen damit unter „return“, bzw. „Rückgabe“ oder „Rückkehr“.
Kulturelle Entwicklungshilfe statt Restitution
Warum wehrten sich westliche Staaten wie die Bundesrepublik und Frankreich so vehement gegen den Gebrauch des Restitutionsbegriffs? Während es sich beim Akt des „return“ um einen weitgehend neutralen Vorgang handelt, der das Handeln der gebenden Instanz betont, so ist „Restitution“ ein im Völkerrecht gebräuchlicher Terminus und meint nach allgemeiner Definition die „Wiederherstellung“ oder Wiedergutmachung“ für einen Schaden, der einem Staat durch einen anderen zugefügt worden ist.[7] Die Wendung Restitution von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten impliziert also, dass es sich bei der einstmaligen Kulturgutverlagerung während des Kolonialismus um einen wiedergutzumachenden Schaden für begangenes Unrecht handelt. Diese Vorstellung widersprach jedoch sowohl dem vorherrschenden Selbstverständnis völkerkundlicher Museen wie auch den außenpolitischen Interessen der ehemaligen Kolonialmächte in den 1960er und 1970er Jahren. Sarah von Beurden und Cynthia Scott haben die Verhandlungen zwischen Belgien und der Demokratischen Republik Kongo bzw. den Niederlanden und Indonesien unter diesem Gesichtspunkt betrachtet.[8] Dabei stellten sie fest, dass Brüssel und Den Haag in den ersten Jahren der Dekolonisierung vor allem darum bemüht waren, bilaterale Kulturbeziehungen zu den früheren Überseegebieten zu knüpfen, die es ihnen erlauben würden, ein positives Bild der gemeinsamen Geschichte und ihren Einfluss in der postkolonialen Gegenwart zu sichern. Beide ehemaligen Kolonialmächte gaben im Verlauf 1960er und 1970er Jahre Kulturgüter zurück – allerdings ohne eine Übertragung der Eigentumsrechte (Belgien) und unter ausschließlicher Bezugnahme auf den Begriff „Transfer“ (beide). Auf diese Weise versuchten sie, eine grundsätzliche Diskussion über die kulturelle Ausbeutung während der Kolonialzeit und eine mögliche „Wiedergutmachung“ zu vermeiden. Indem Belgien und die Niederlande „Restitution“ durch den Modus des freiwilligen Transfers ersetzten, konnten sie die Deutungshoheit über die Vorgänge bewahren, die Rückgabe von ausgewählten Artefakten als kulturelle Entwicklungshilfe deklarieren und Kontinuität zum patriarchalen Selbstverständnis der „wohlmeinenden Kolonialmacht“ als legitimer Vormund des kulturellen Erbes der ehemaligen Kolonialgebiete herstellen.
Die Integrationsfähigkeit der kulturellen Entwicklungshilfe in das postkoloniale Modernisierungsparadigma und die eigenen außenpolitischen Interessen blieb in Bonn, aber auch in Ost-Berlin nicht unbemerkt. In der Bundesrepublik bot die bevorstehende Gründung des ICPRCP im Sommer 1978 Anlass zur Überlegung, den sogenannten Entwicklungsländern „mit gezielten Aktionen Unterstützung zuteil werden [zu] lassen, die von der Weltöffentlichkeit positiv zur Kenntnis genommen wird.“[9] Das Ministerium für Kultur der DDR, wo man ebenfalls seit den frühen 1970er Jahren über eine Grundsatzhaltung zur Restitutionsfrage nachdachte, drängte in einem ähnlich klingenden Wortlaut darauf, „Forderungen nach Rückführung (einschließlich der Gebrauch dieses Begriffs)“ nur dann zu unterstützen, wenn diese nach eigener moralischer und rechtlicher Auffassung berechtigt seien. Andernfalls „sollte die DDR die Forderung der Entwicklungsländer unter Verwendung der Begriffe „Überführung“, „Übergabe“, „Zusammenarbeit“, „Hilfe und Unterstützung“ differenziert unterstützen, soweit konkrete außenpolitische Interessen [...] das erfordern.“[10]
Die Beispiele zeigen, dass Ansprüche auf kulturelle Restitution im Verlauf der Debatten durch eine Rhetorik der Entwicklungshilfe entschärft und eingehegt werden sollten. Doch während die sprachliche Ebene Partnerschaftlichkeit suggerierte, bestanden asymmetrische Machtbeziehungen zwischen den Ländern des Globalen Nordens und des Südens weiterhin fort. Diese Strategie machten sich nicht nur die letzten europäischen Kolonialmächte, sondern auch die Bundesrepublik und die DDR im Umgang mit Restitutionsforderungen zu Eigen. Der letztliche Kompromiss über die offizielle Bezeichnung des zwischenstaatlichen Komitees ist Ausdruck dieser Kämpfe um Deutungshoheit und Definitionsmacht. Als das Zwischenstaatliche UNESCO-Komitee vor 40 Jahren seine erste Sitzung eröffnete, war durch die erfolgreiche Eingrenzung des Restitutionsbegriffs die Bedeutungsverschiebung einer anti-kolonialen Frage hin zu einem Gegenstand des aufstrebenden westlichen Entwicklungshilfesystems bereits vollzogen worden.
[1] Schreiben von Dr. F. Kußmaul an die Vertretung der Bundesrepublik bei der UNESCO, z.Hd. E. Weindel, vom 22.3.1976, S. 1, in: PA AA, B91, 642 (ohne Nummerierung).
[2] Ebd.; Für den DMB, siehe: Dr. W. Klausewitz, „Entwurf“ des Deutschen Museumsbund e.V. Frankfurt a.M. den 27.1.1976, S. 1, in: ebd.
[3] Dr. W. Klausewitz, „Entwurf“ des Deutschen Museumsbund e.V. Frankfurt a.M. den 27.1.1976, S. 1, in: ebd.
[4] Hierzu: Pupeter, Ellen: Eine Frage der Glaubwürdigkeit?. Postkoloniale Restitution und DDR-Kulturpolitik in den 1970er und 1980er Jahren, in: Zeitgeschichte-online, März 2020.
[5] Für die nachfolgenden Zitate siehe: Bericht der Arbeitsgruppe „Rückgabe von Kulturgut“ vom 13.9.1978, in: ebd. Zu den 15 Teilnehmern zählten die Präsidenten, Direktoren oder Vorsitzenden der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, des DMB und des Deutschen ICOM Nationalkomitee sowie Vertreter von BMI, Auswärtigem Amt, dem Deutschen Städtetag und der Kultusministerkonferenz der Länder. Museen und Forschungseinrichtungen waren durch die Direktoren des Stuttgarter Linden-Museums sowie des Frankfurter Frobenius Instituts vertreten.
[6] Die Unterstützung bei der Erstellung von solchen Inventarlisten war als ein möglicher Aufgabenbereich des Komitees durch ein weiteres UNESCO-Expertentreffen in Dakar im März 1978 genannt worden.
[7] Prott, Lyndel V. (Hg.): Witnesses to History: A Compendium of Documents and Writings on the Return of Cultural Objects, Paris 2009, S. xxi.
[8] Beurden, Sarah van: Restitution or Cooperation? Competing Visions of Post-Colonial Cultural Development in Africa, in: Global Cooperation Research Papers 12 (2010); Scott, Cynthia: Cultural Diplomacy and the Heritage of Empire. Negotiating Post-Colonial Returns, London 2019.
[9] Siehe FN 4
[10] „Zur Position des Ministeriums für Kultur in Fragen der Rückführung von Kulturgut in die Ursprungsländer“, ca. September 1982, in: PA AA, ZR 134694 (ohne Nummerierung).
Zitation
Ellen Pupeter, Restitution, Rückgabe oder Transfer? . Ein langer Streit um den passenden Begriff , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/restitution-rueckgabe-oder-transfer