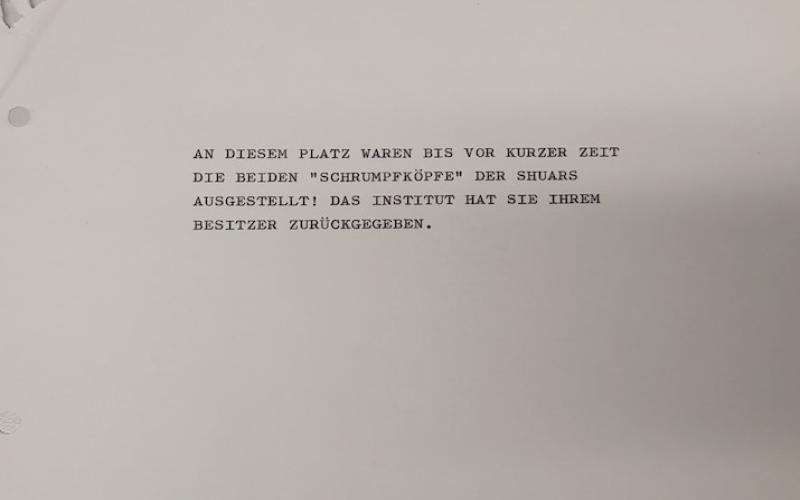Im 20. Jahrhundert fanden es die Deutschen kaum verwunderlich, dass es wenig Zuwanderung aus den (ehemaligen) Kolonien gab.[1] Aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft kam niemand auf die Idee, überhaupt die Frage nach (post-)kolonialer Einwanderung zu stellen. Die ausbleibende Verwunderung lässt sich durch die Selbstverständlichkeit erklären, mit der man annahm, Weiß-Sein sei eine Bedingung für Deutschsein und die deutsche Nation „kein Einwanderungsland” (Zitat Helmut Kohl, 1992). Beim Blick nach Frankreich und Großbritannien hätte man zwar ein Defizit bei der nachkolonialen Einwanderung nach Deutschland feststellen können (1974 gab es in Frankreich regulär über eine Million Menschen allein aus den ehemaligen afrikanischen Kolonien).[2] Das Gegenteil war jedoch der Fall. Man bemühte in Deutschland den Vergleich mit Frankreich und Großbritannien lediglich, um zu behaupten, dass das deutsche Kolonialreich nur kurze Zeit existierte und zeitlich zu weit zurück lag, um einen dauernden Einfluss zu hinterlassen.[3] Kohls Zitat, das deutsche Einwanderungsbehörden schon seit 1945 zum Leitmotiv ihrer Arbeit gemacht hatten, war weniger deskriptiv als präskriptiv gemeint. Bei der Zuwanderung nach Deutschland sollte es weder einen „Kolonialbonus“ für Auswanderungswillige aus den ehemaligen Überseegebieten geben, noch kam die deutsche Regierung auf die Idee, durch Bevorzugung von Migrant:innen oder „Gastarbeiter:innen“-Rekrutierung aus den ehemaligen Kolonien Wiedergutmachungspolitik zu betreiben, wie es zum Beispiel die englische Regierung mit der Einladung an die „Windrush-Generation“ aus karibischen Ländern zwischen 1948 und 1971 getan hatte.
Der kolonialen Amnesie in der Bundesrepublik folgte die Verdrängung (post-)kolonialer Migration. Ebenso wie den kulturellen Einfluss, ignorierten die deutschen Regierungen den demographischen Einfluss der eigenen kolonialen Vergangenheit – oder leugneten ihn sogar. In Statistiken über Ausländer:innen in Deutschland gab es wie selbstverständlich keine Kategorie „Menschen aus den (ehemaligen) Kolonien“. Aber auch ansonsten tauchen Menschen aus Afrika oder Asien selten auf und wurden meist in der Rubrik „Sonstige“ aufgeführt.[4] So schnell wie „die Kolonisierten“ zwischen 1880 und 1914 vom Neologismus zu einer Lieblingskategorie deutscher Demographie geworden waren, so rapide verschwand der Begriff nach 1945 aus dem kollektiven Gedächtnis. Die Kolonialamnesie half den Menschen aus den ehemaligen Kolonien aber nicht, ihren kategorialen Diskriminierungsstatus als angeblich passive Teilnehmer:innen am Weltgeschehen loszuwerden. Denn sie wurden nun auf den mental maps europäischer Demograph:innen einfach zu Bewohner:innen der angeblich unterentwickelten Dritten Welt umdeklariert. Unter diesem Label tauchten sie dann auch meist in den Statistiken auf.
Dabei waren Migrant:innen aus den ehemaligen Kolonien in Deutschland schon immer sehr präsent, wenn nicht numerisch so doch gesellschaftspolitisch. Sie und ihre Nachkommen machten schließlich die Beschäftigung mit der Kolonialvergangenheit auch zu einem Thema in der deutschen Gesellschaft.[5] Allerdings ging es ihnen nicht um eine leicht überwindbare und rein „deutsche Kolonialvergangenheit“, sondern eher um einen globalen Kampf gegen (post-)koloniale Strukturen, Diskriminierung, Rassismus und Ungerechtigkeit. Auch wenn man sie keineswegs auf diese aktivistische Rolle reduzieren kann, soll hier vorrangig gezeigt werden, wie sie die Kolonialvergangenheit als andauernde Gegenwart entlarvten.
Zu Kolonialzeiten traf man in deutschen Städten häufiger Menschen, die in den damaligen deutschen „Schutzgebieten“ aufgewachsen waren. Zum Beispiel lebten 1890 147 Afrikaner:innen in Hamburg und 1903 200 Afrikaner:innen in Berlin. Meist waren es männliche Kinder von Notablen und Kaufleuten wie den Duala aus Kamerun, die ihre Nachkommen zur Ausbildung nach Deutschland schickten. Eine Handvoll arbeitete als Sprachlehrer:innen für zukünftige Kolonialbeamte in Berlin oder Hamburg. Andere wurden nach Deutschland geholt, um in sogenannten Völkerschauen rassistische Klischees über ein zurückgebliebenes Afrika zu inszenieren. Ihre Aufenthaltsgenehmigung war kein rechtlich oder bürokratisch geregelter Akt wie bei einer Visumsvergabe. Vielmehr war eine Einreise nur über Bürgschaften von deutschen Kolonialbeamten und Missionaren oder nach Interessensbekundungen von deutschen Arbeitgebern möglich. Bevor sie in einer Art Gnadenakt den Aufenthalt genehmigten, erkundigten sich die Kolonialbehörden in Berlin über die Loyalität ihrer kolonialen Untertanen. Letztere wurden teilweise explizit bei Pflegefamilien in Kleinstädten untergebracht, um sie besser kontrollieren zu können. Es war Teil der kolonialen Willkürherrschaft, dass der Aufenthalt jederzeit ohne Begründung wieder beendet werden konnte.
Migrantische Lebensrealitäten, Aktivismus und Sichtbarkeit im frühen 20. Jahrhundert
Die Erfahrungen der Migrant:innen mit Menschen aus Deutschland waren ganz unterschiedlich. Rudolf Duala Manga war in Aalen unter Mitschüler:innen beliebt und respektiert, während Alfons Demba von Schulkamerad:innen in Görlitz das Leben schwer gemacht wurde. Paul Messi, ein Sprachlehrer am Hamburger Kolonialinstitut, hatte mit schweren Krankheiten zu kämpfen, während Rudolf Duala Manga auch wegen seiner Fitness Anerkennung fand. Ein Großteil lebte in prekären Verhältnissen, wohingegen manche recht erfolgreiche Unternehmer wurden. Alle erlebten allerdings regelmäßig rassistische Ablehnung und strukturelle Diskriminierung: wenige fanden nach ihrer Ausbildung Arbeit in Deutschland und nicht mehr als sechs konnten ein Studium aufnehmen.[6] Auch die „Assimilierung“ deutscher Sprache und Bildung schuf keine Aufstiegsmöglichkeit. Es gab keinen „deutschen Senghor“ (der als Senegalese im französischen Bildungssystem Karriere machte). Zwar gab es nach dem Ersten Weltkrieg eine kleine Zahl an Studierenden und Intellektuellen aus Britisch-Indien, die kurzzeitig in Deutschland wirkten und teilweise auf Deutsch publizierten, wie zum Beispiel der Soziologe Benoy Kumar Sarkar. Positive Erfahrungen mit einzelnen Deutschen machten aber auch für sie die strukturelle Diskriminierung nicht wett.
Im Gegensatz zu Frankreich, das 600 000 Soldaten und noch mehr Arbeiter:innen aus den Kolonien rekrutierte, war der Erste Weltkrieg in Deutschland kein Immigrationskatalysator. Stattdessen kamen Besatzungssoldaten aus den Kolonien mit der französischen Armee temporär in die Weimarer Republik. In Deutschland selbst hielt sich über den Ersten Weltkrieg bis zu den Protesten gegen diese „Rheinlandbesatzer“ die rassistische Maxime, dass nicht-weiße Menschen nicht nach Deutschland gehörten, nicht einmal als ökonomische oder militärische Ressource. Als soziopolitische Gruppe wurden sie kaum wahrgenommen. In Frankreich gab es hingegen in den 1920er Jahren ein reges politisches Leben unter den 7000 vietnamesischen und algerischen Arbeiter:innen. Letztere bildeten unter anderem eine Partei mit 5000 Mitgliedern (Étoile Nord-Africaine). Zur selben Zeit gab es in der Weimarer Republik nur temporäre Zusammenschlüsse, wie den kurzlebigen Afrikanischen Hilfsverein mit 32 Mitgliedern.
Dennoch lebten 1919 bis zu 3000 Menschen aus den ehemaligen Kolonien und deren Nachkommen in der neu gegründeten Weimarer Republik. Die meisten hielten sich dort allerdings ohne die frühere Patronage und Kontrolle auf, sodass sie auf sich selbst gestellt waren. Auch an ihrem rechtlich prekären Status änderte sich weiterhin nichts: Sie waren keine Staatsbürger:innen, sondern behielten meist ihren Ausweis als Bewohner:innen der „Schutzgebiete“ – die nur noch in der Fantasie deutscher Kolonialrevisionisten fortlebten. Der Verlust der kolonialen Patronage ging oft mit finanziellen Schwierigkeiten einher. Einige konnten durch Heirat mit weißen Frauen neue Verbindungen zur „Mehrheitsgesellschaft“ aufbauen. Von den etwa 80 Kamerunern der ersten Einwanderergeneration heirateten knapp die Hälfte. Damit waren sie aber nicht automatisch den deutschen Staatsbürger:innen gleichgestellt. Anstatt ihren legalen Status zu verbessern, verschlechterte das deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz den legalen Status der Ehefrauen und gemeinsamen Kinder. Diese verloren durch die Heirat mit „Ausländern“ ihre deutsche Staatsbürgerschaft.[7] Der Entzug der Staatsbürgerschaft war kein deutscher Sonderfall, sondern galt in ganz Europa, sodass zum Beispiel im Frankreich der 1920er Jahre 150 000 Frauen durch Heirat mit Ausländern ihre Staatsbürgerschaft verloren.[8]
Das Ende der Patronage und Kontrolle führte gleichzeitig zu mehr Freiheit und zu mehr Prekarität. Beides wiederum beschleunigte die Politisierung der Migrant:innen aus den ehemaligen Kolonien seit 1919. Wie in allen anderen Imperien gab es für die Kolonisierten zwei Möglichkeiten politischer Emanzipation. Entweder die Assimilation und Gleichstellung mit Europäer:innen, oder die politische Eigenständigkeit und staatliche Unabhängigkeit. Beide Forderungen fanden sich in der afrikanischen Community in Deutschland. Auf die Initiative von Martin Dibobe unterstützten Vertreter:innen der kamerunischen und ostafrikanischen Diaspora deutsche Forderungen nach einer Restitution des Kolonialreiches – unter der Bedingung, dass die Bewohner:innen der Kolonien den deutschen Vollbürger:innen rechtlich gleichgestellt wurden. Zur Gleichberechtigung gehörten auch eine rudimentäre demokratische Mitsprache, eine stärkere Kontrolle von Verwaltung und Polizei, Handelsfreiheit und die Garantie des Eigentums. Vor allem war bestimmten Duala-Gruppen die Restitution ihres vor 1914 enteigneten Besitzes ein Anliegen. Es gab also schon seit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg Restitutionsforderungen – die sich aber auf immobilen und nicht unbedingt mobilen Besitz bezogen. Für die Unabhängigkeit plädierte der tansanische Swahili-Lehrer Mdachi bin Sharifu, der auf Vortragsreisen durch ganz Deutschland das Fazit zog, dass die „früheren Herren von Ostafrika sich als unwürdig bewiesen hätten zur Kolonialarbeit“. [9]
Die afrikanische Community in Deutschland war schon früh gut vernetzt, eine Ghettoisierung blieb aber wegen der dezentralen Unterbringung durch die Kolonialbehörden aus (was auch nach 1945 im Gegensatz zu den – gruppenweise einwandernden – „Gastarbeiter:innen“ so blieb). In Berlin bestand die schwarze Community nach Theodor Wonja Michael, dessen Vater aus Kamerun nach Deutschland gekommen war, vorrangig aus Menschen, die in den deutschen Kolonien geboren wurden: „Sie wurden von uns Kindern mit ‘Onkel’ und ‘Tante’ angeredet. Einbezogen waren auch die Abkömmlinge der ‘Landsleute’, die späteren ‘Afro-Deutschen’“, berichtete Michael. Von ihm weiß man auch, dass sich Afrikaner:innen oft gegenseitig unterstützten. Wenn jemand in Not geriet, wurde man von anderen Mitgliedern der Community aufgenommen und „selbstverständlich bewirtet“.[10] Gegenseitige Hilfe war umso nötiger, da eine Aussicht auf gut bezahlte Arbeit selten bestand.
Verfolgung unter den Nationalsozialisten
Die Wirtschaftskrise von 1929 und der aufkommende Nationalsozialismus machten die Situation meist unerträglich. Kwassi Bruce, Pianist und Mitglied einer berühmten togolesischen Schaustellerfamilie, schrieb darum 1932 aus Berlin an seine Schwester Annie in Togo: „[…] dieser Brief ist ein Hilfeschrei in tiefster Not zu Dir, denn mir geht es fürchterlich schlecht. Seit einem halben Jahr bin ich ohne Arbeit und Verdienst. Es ist hier in Deutschland geradezu katastrophal. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Seit Wochen kann ich nicht mehr richtig essen und muss buchstäblich betteln. Hier in Deutschland herrscht jetzt geradezu eine feindliche Stimmung gegen Afrikaner, ganz gleich ob sie aus ehemaligen deutschen Kolonien sind oder nicht.“ Der Grund dafür liege in der „ausgeprägten Rassenfeindschaft gegen die [hier steht in der Quelle das N-Wort].“[11] Obwohl die Nationalsozialisten für Menschen aus Indien offener waren und ihren antikolonialen Kampf gegen die Briten indirekt unterstützten, wandte sich auch die indische Community in Deutschland von ihnen ab. Der Intellektuelle und Antikolonialist Taraknath Das, der Deutschland immer als vorbildliche Zivilisation gepriesen hatte und sogar die frühe NS-Politik verteidigte, wandte sich spätestens nach der Kristallnacht 1938 lautstark gegen ihren Rassismus und Antisemitismus, der auch zu Beleidigungen und tätlichen Angriffen gegen Inder:innen führte.[12] Die meisten Nicht-Weißen Menschen versuchten, Deutschland in den 1930ern zu verlassen. Verbliebene Afrikaner:innen hielten sich jedoch teilweise über Wasser, indem sie rassistische Klischees zur Einkommensquelle machten: Sie arbeiteten für Völkerschauen oder als Schauspieler:innen für glorifizierende NS-Filme zum deutschen Kolonialreich. Kwassi Bruce wurde zunächst Mitarbeiter der NS-„Afrikaschau“, ging aber 1940 zurück nach Togo. Zu der Zeit waren andere schon geflohen oder wurden in Konzentrationslager gebracht.
Kwassi Bruce kam nach 1945 kurzzeitig nach Deutschland zurück und arbeitete als Jazzpianist, ließ sich schließlich aber doch lieber in Paris nieder. In Frankreich, wie auch in England, konnten sich Bewohner:innen aus ehemaligen Kolonien teils bis in die 1980er Jahre ohne rechtliche Hürden niederlassen. Insgesamt schienen bis in die 1980er Jahre wenige Menschen aus ehemaligen Kolonien überhaupt an einer Migration nach Deutschland interessiert gewesen zu sein, so „dachte in Kamerun kaum jemand daran, vollständig zu emigrieren“.[13] Auswanderungswillige aus den ehemaligen deutschen Kolonien bevorzugten meist den Weg nach Frankreich, England, Australien oder Belgien. Diese Länder hatten Deutschland als Bezugsland abgelöst, wenn auch nicht vollständig ersetzt. Denn Deutsche waren in ihren ehemaligen Kolonien weiterhin präsent, vor allem als Unternehmer und Plantagenbesitzer in Tansania, Kamerun und Togo oder Siedler:innen in Namibia, wo sie unter der Schutzherrschaft des Apartheid-Staates Südafrika gleich im Land geblieben waren.
Umgekehrt: Weiße Deutsche in den ehemaligen afrikanischen Kolonien
Kleine germanophile Gruppierungen wie der Bund der Deutschtreuen Togoleute oder die ehemaligen Soldaten (Askari) der deutschen Schutztruppe in Ostafrika meldeten derweil immer wieder Ansprüche an. Sie waren 1919 von den Deutschen im Stich gelassen worden und nur noch für die Geschichtsklitterung kolonialrevisionistischer Propaganda interessant gewesen (zum Beispiel im Bild vom „treuen Askari“). Nach 1945 wären sie einer „entschädigenden“ Einwanderung nach Deutschland sicherlich nicht abgeneigt gewesen. Askari-Vertreter:innen baten ohnehin um die Zahlung von ausstehenden Löhnen aus dem Ersten Weltkrieg und der Togobund sandte bis in die 1980er Jahre Treuebekundungen nach Berlin. Auch nach 1945 wurden beide Gruppen von Kolonialrevisionist:innen zu Propagandazwecken benutzt, aber nie zur Einwanderung animiert. Eine nachkoloniale Evakuierung, wie die von 90 000 algerischen Harkis nach Frankreich, gab es nicht. Nicht einmal bei den regelmäßigen Treffen ehemaliger „Schutztruppler“ in der Bundesrepublik waren afrikanische „Askari“ anwesend. Gemäß ihrem rassistischen Weltbild wollten weder Kolonialrevisionist:innen der 1920er noch Kolonialnostalgiker:innen der 1950er Jahre eine Einwanderung aus den ehemaligen Kolonien – wobei es für die Askari bis in die 1980er Spenden und Vergütungszahlungen gab.
Die gesellschaftliche Aufbruchsstimmung und der wirtschaftliche Aufschwung nach der Unabhängigkeit von Kamerun, Togo oder Tansania machten in den 1960er Jahren das Bleiben in den neuen Staaten attraktiver. Eine massenhafte Auswanderung war auch von Seiten der Unabhängigkeitsregierungen nicht erwünscht. Gleichzeitig verschwanden die ehemaligen Kolonien aus dem kollektiven Gedächtnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Mit der Verdrängung der Kolonialvergangenheit schien eine spezifische Einwanderung aus den „ehemaligen Kolonien“ in Deutschland kaum mehr denkmöglich. Selbst bei der Betrachtung der Einwanderung nach Gesamteuropa und der anderen Kolonialmächte in den 1950ern und 1960ern beschrieben deutsche Expert:innen die Einwanderung aus den Kolonien paradoxerweise vor allem als „weiße“ Einwanderung und „Rückkehr“ europäischstämmiger Siedler:innen aus Indonesien, Kenia, Algerien usw. Danach richtete sich der Fokus postwendend auf „Gastarbeiter:innen“ und „internationale Manager“ als typische Einwanderungsgruppen in Europa. Nur hin und wieder wurden auch die „Flüchtlinge“ aus den ehemaligen Überseegebieten erwähnt.[14] Seit den 1960ern verschwinden sie meist in der Kategorie der Sonstigen.
Migration auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs
Menschen mit Kolonisationserfahrung waren aber in der jungen Bundesrepublik keineswegs eine unbedeutende Gruppe. Vor den großen „Gastarbeiter:innen“-Programmen der 1960er waren Menschen aus Afrika und Asien unter den größten Einwanderergruppen. Mit der Zustimmung der Unabhängigkeitsregierungen kamen tausende von ihnen zur Ausbildung und zum Studium nach Deutschland. Ende der 1960er Jahre waren allein 12 000 Studierende aus Afrika und Asien an westdeutschen Universitäten eingeschrieben.[15] Spätestens seit 1956 hatte der DAAD sie angeworben. Die staatlich bezuschusste Afrika-Gesellschaft und die Carl-Duisberg-Gesellschaft übernahmen ihre Betreuung. Der Anlass dafür war die Angst, man würde Bewohner:innen der sich dekolonisierenden Länder den „Russen in die Arme“ treiben, wenn man ihnen eine Ausbildung in Deutschland verwehren und sie „durch Taktlosigkeit und überhebliches Besserwissen“ abschrecken würde.[16] Der Kalte Krieg erklärte auch teilweise, warum Westdeutschland nach 1945 keinen Visumszwang für Auszubildende und Studierende aus Afrika einführte: Bonn wollte sie nicht an die DDR verlieren. Zwar gerieten viele Studierende in finanzielle Schwierigkeiten – in Frankfurt allein meldeten sich in den 1960er Jahren hunderte Auszubildende aus dem subsaharischen Afrika bei Wohlfahrtsverbänden und baten um Nothilfe – aber eine Einwanderung für Studium und Ausbildung war grundsätzlich für alle möglich.
Im Vergleich zu Frankreich, wo in den 1960er Jahren allein über 400 000 Algerier:innen einwanderten, blieben Afrikaner:innen in der Bundesrepublik im vierstelligen Bereich und nicht dauerhaft im Land. Dass es in Deutschland nicht zu einer Masseneinwanderung kam, war der eingeschränkten Freizügigkeit, den globalen Ungleichheiten und den rassistischen Strukturen in der deutschen Gesellschaft geschuldet. Der gesellschaftliche und institutionelle Rassismus war dabei mit Abstand der wichtigste Einwanderungsverhinderungsgrund, da es ohne Visumszwang zunächst keine rechtliche Barriere gab.[17] Die Migrant:innen konnten also relativ problemlos und individuell einreisen. Dort hatten sie jedoch kaum Chancen auf dem Wohnungs- und noch weniger auf dem Arbeitsmarkt.
Migrant:innen aus den ehemaligen Kolonien protestierten früh und selbstbewusst gegen rassistische Diskriminierung und Vorurteile, unter ihnen auch zunehmend Frauen. Als 1959 „fünf Herren“ aus den USA und der Bundesrepublik auf einer Podiumsdiskussion in München über Entwicklungspolitik diskutierten, ergriff zum Beispiel „eine junge Medizinerin aus Ghana, in München studierend,… die Gelegenheit, den Herren da oben ein paar afrikanische Wahrheiten zu sagen. Ihr Plädoyer“, berichtete die Süddeutsche Zeitung, sei „so gut gelungen, dass sie nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die Lacher auf ihrer Seite hat.“ Es sei eine Anmaßung, beklagte sich die Ghanaerin, dass man von der „Erziehung der Afrikaner“ spreche: „Behandelt uns doch bitte nicht wie Schüler, sondern bemüht euch, unsere Lage besser zu verstehen. Und wenn ihr Amerikaner und Bundesdeutschen so gern auf eure nichtkoloniale Vergangenheit hinweist, so rechnet euch das nicht zu hoch an — denn, nicht wahr, im Grunde finanziert ihr doch den Krieg der Franzosen gegen Afrikaner.“[18] Für sie sei es egal, ob man in London, Paris, Bonn oder Moskau sei, koloniale Denkmuster gebe es überall. Ihre Position war sicherlich repräsentativ für viele Menschen aus den ehemaligen Kolonien, die sich nicht nur an den Kolonialismus erinnerten, sondern auch seine Gegenwart täglich spürten. Die Bundesrepublik – wie auch die DDR – versuchten sich hingegen als kolonial unbelastet darzustellen und erwarteten dafür Anerkennung.
Vor allem Menschen aus ehemaligen Kolonien in Afrika waren in globalen Netzwerken der antikolonialen und panafrikanischen Solidarität organisiert. Dementsprechend waren ihre Themen auch stärker vom Kampf gegen strukturellen Rassismus und Neokolonialismus geprägt als auf die spezifisch deutsche Kolonialvergangenheit einzugehen. Der Aktivismus zahlreicher afrikanischer und afro-asiatischer Studierendenvereine in Deutschland inspirierte auch die 68er-Bewegung an den Universitäten, zum ersten Mal bei den Protesten anlässlich der Ermordung des kongolesischen Unabhängigkeitsführers Patrice Lumumba und gegen den Staatsbesuch der daraufhin installierten neokolonialen Marionettenregierung unter Moise Tshombe 1964 teilzunehmen.[19] 1969 gründete sich in Köln die Pan African International, deren Netzwerk sich nach Afrika sowie Süd- und Nordamerika erstreckte. Die Pan African International knüpfte geistig an ältere emanzipatorische und panafrikanistische Projekte an, die schon vor 1933 von den Afroamerikanern W.E.B. Du Bois und George Padmore (u.a. von Hamburg aus) organisiert worden waren. Die marxistisch-sozialistische Pan African International berief sich auf Helden der Unabhängigkeit, wie Kwameh Nkrumah, Gamal Abdel Nasser und Frantz Fanon.[20] Die Motive ihrer politischen Organisation waren also neben den praktischen Anliegen der Migrant:innen in Deutschland vor allem ein übergreifender (globaler) Antikolonialismus, Antirassismus und Panafrikanismus. Deutsche Aktivist:innen bemängelten allerdings, dass diese Stoßrichtung für die konkreten „Ausländerbegehren“ in Deutschland oft wenig effizient war.
Antikoloniale Positionen rückten mit dem Anwerbeabkommen der 1960er bei der westdeutschen Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund oder gerieten ganz in Vergessenheit. Die Gastarbeiter:innen aus Griechenland, Jugoslawien, der Türkei, Italien, Spanien, und Marokko standen fortan im Mittelpunkt der politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und medialen Aufmerksamkeit in der Bundesrepublik.[21] Sie waren numerisch weit überlegen und bildeten im Laufe der Zeit eine staatlich kontrollierte (und teilweise verordnete) Lobby. So gab es „Gastarbeiter:innen“-Programme in Radio und Fernsehen sowie ein Mitwirken in Gewerkschaften. Obwohl sie in (Kultur-)Vereinen und im öffentlichen Leben sehr präsent waren, kamen Migrant:innen aus den ehemaligen Kolonien seltener als die Gastarbeiter:innen mit dem deutschen Arbeitsrecht, Tarifverhandlungen und Arbeitskampf in Berührung. Ausgenommen von marokkanischen Gruppen waren sie auch nicht im Internationalen Forum ausländischer Arbeitnehmervereinigungen vertreten, einer Art Dachverband von 15 verschiedenen Gastarbeiter:innen-Communities. Es gab aber Anknüpfungspunkte, wie zum Beispiel in den Songtexten der afrodeutschen Liedermacherin Fasia Jansen, die den antikolonialen Freiheitskampf mit den Zielen der Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet verband.[22]
Mit den „Gastarbeiter:innen“ teilten Migrant:innen aus den ehemaligen Kolonien zudem das Schicksal, nur temporär in Deutschland bleiben zu können. Eine „Integration“ war von deutschen Behörden bis zu den 1980ern selten erwünscht und wurde durch fehlende Einstiegshilfen (Sprachkurse, Arbeitsvermittlung, Zugang zu Schulen) und verwehrte Aufstiegschancen (Zugang zu höherer Bildung und zu mittleren Positionen in Wirtschaft und Wissenschaft) verhindert. Vor allem sollten beide Gruppen um jeden Preis entfernt werden, sobald sie den Sozialstaat in Anspruch nahmen.
Der sich verdichtende Diskurs über den Missbrauch des Sozialstaats durch Zuwandernde hatte zum Resultat, dass die Bundesrepublik konsekutiv einen Visumszwang für Tourismus, Studium und Ausbildung einführte. Dadurch scheint die Einwanderung aus den ehemaligen Kolonien noch einmal zurückgegangen zu sein. Es gab jedoch immer noch das theoretisch offene Asylrecht im westdeutschen Grundgesetz, welches dem Wortlaut nach jeder politisch-verfolgten Person Schutz gewährte. Afrikaner:innen, die in Deutschland ihre Ausbildung oder ihr Studium begonnen hatten und dann aufgrund der rassistischen Ablehnung keine Arbeit finden konnten, stellten immer häufiger Asylanträge. Die Anerkennungsquoten lagen jedoch meist unter einem Prozent.
Die Zahlen von Migrant:innen aus den ehemaligen Kolonien blieb darum weiterhin gering. 1982 waren in der Bundesrepublik offiziell 653 Menschen aus Kamerun, 674 aus Togo, 188 aus Ruanda, und 173 aus Burundi gemeldet. Tansania taucht in den Statistiken gar nicht auf. Aus nichtdeutschen ehemaligen Kolonien waren die Zahlen weitaus höher. Aus Ghana kamen zu der Zeit an die 14 000 Personen. Unter den „Gastarbeiter:innen“ waren 25 000 aus Tunesien und 42 000 aus Marokko.[23] Eine Bestandsaufnahme ergibt also ein etwas gewichtigeres Bild. 1985 waren in der Bundesrepublik 133 456 Menschen aus Afrika (vorrangig Algerien, Marokko, Tunesien, Nigeria und Ghana), sowie 295 459 aus Asien (vorrangig Indien, Pakistan, Sri Lanka und Vietnam). [24] Ökonomische Notwendigkeiten spielten außerhalb von „Gastarbeiter:innenprogrammen“ eine geringe Rolle, führten aber in Einzelfällen zur unsystematischen Vergabe von Staatsbürgerschaft. Der aus Kamerun stammende Mitautor dieses Texts bekam zum Beispiel 1980 im Eilverfahren die deutsche Staatsbürgerschaft, da er in Bayern als Sonderschullehrer gefragt war. Auch Mediziner:innen hatten teilweise die Möglichkeit, länger in Deutschland zu bleiben. Die geringe Anerkennungsquote von Asylbewerber:innen änderte sich dagegen auch nicht in den 1980er Jahren, als die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds den Sozialstaat im subsaharischen Afrika unterminierten und diktatorische Regime jegliche Opposition brutal unterdrückten. Dass Armut und politische Unterdrückung um sich griffen, ließ die Behörden in der Bundesrepublik kalt. Auch nach der Wende blieb die Anerkennungsquote für Asylsuchende aus dem subsaharischen Afrika auf geringem Niveau, 1994 lag sie bei lediglich 0,7%. Diese Zahlen erscheinen vernachlässigbar.
Anders war die Lage in der DDR, wo Migrant:innen aus (ehemaligen) Kolonien und Vertragsarbeiter:innen größtenteils kongruent waren. 1986 gab es 8 500 vietnamesische Vertragsarbeiter:innen in der DDR, deren Zahl bis 1989 rapide anstieg. Kurz vor der Wende waren insgesamt nur 190 000 Ausländer:innen in der DDR (sowjetische Truppen nicht mitgezählt), darunter 15 000 aus Mosambik und 60 000 aus Vietnam als größte Gruppen.[25] Da letztere aus einer Postkonfliktzone einwanderten, die durch den Vietnamkrieg als längstem Kolonialkonflikt des 20. Jahrhunderts geprägt war, brachten sie auch ein Bewusstsein für koloniale Situationen mit. In der DDR prägten sie aber weniger den öffentlichen Diskurs als es die seit 1975 in die Bundesrepublik kommenden vietnamesischen „Boat People“ in Westdeutschland getan hatten. Eine solidarische Erinnerungskultur an koloniale Zeiten hatte die vietnamesische Präsenz in der DDR also nur bedingt zur Folge. Sowohl in der Bunderepublik als auch in der DDR, verortete sich die Debatte um Vietnam rhetorisch im Kalten Krieg.[26]
In der DDR waren klassische antikoloniale Themen u.a. durch die Rekrutierung von Vertragsarbeiter:innen aus Angola und Mosambik naheliegender. Zusammen mit den Kindern von SWAPO-Aktivist:innen, die in der DDR zu Freiheitskämpfer:innen für Namibia ausgebildet werden sollten, personifizierten sie die gelebte Solidarität mit antikolonialen Bewegungen. Rassistische Denkweisen und eine staatlich verordnete Ghettoisierung und Kontrolle sorgten aber dafür, dass sie ihre antikoloniale Erfahrung nicht zum gesamtgesellschaftlichen Thema machen konnten. Ihr migrantischer Antikolonialismus schien durch die Angst des Staates vor dem Kontrollverlust über die Diskurshoheit nicht zum greifbaren Thema in der Mehrheitsgesellschaft zu werden. Vielmehr löste sich der konkrete Antikolonialismus „aus erster Hand“ in den leer gewordenen SED-Phrasen vom Antiimperialismus und Antifaschismus auf. Die ebenfalls zur Phrase gewordene internationalen Solidarität verdeckte, dass Vertragsarbeiter:innen in der DDR isoliert wurden (was nicht immer klappte), und Fremdenfeindlichkeit bis hin zu pogromartigen Verfolgungen auch in dem sozialistischen Land für sie eine Alltagserfahrung war.
Dreißig Jahre „Sch-Einheit“
Nach der Wiedervereinigung verschlechterte sich die Situation für Vertragsarbeiter:innen und Geflüchtete in Deutschland eklatant. Menschen aus Angola, Mosambik, Namibia und Vietnam mussten das Land größtenteils verlassen. Fast alle afrikanischen und zwei Drittel der vietnamesischen Vertragsarbeiter:innen mussten 1990 ausreisen, die Verbliebenen bekamen erst 1997 eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung.[27] Der sogenannte Asylkompromiss von 1993 schaffte das Grundrecht auf Asyl faktisch ab. Just in dieser Zeit flohen aus Togo zum Beispiel 500 000 Menschen vor dem repressiven Regime des Generals Gnassingbé Eyadema. In den Jahren 1993 und 1994 wurden mindestens 3000 Menschen von Eyademas Todesschwadronen ermordet. Diejenigen Togoles:innen, die dieser Situation entkommen wollten, bekamen in Deutschland selten Asyl.[28] Viele von ihnen blieben trotz eines negativen Asylbescheids und lebten mehrere Jahre lang in der Illegalität. Eine Handvoll von Togoles:innen ging ins Kirchenasyl, falls sie eine der raren aufnahmebereiten Gemeinden fanden. Erst nach kosten- und zeitintensiven Klageprozessen erhielten einige von ihnen den Asylstatus.[29] Insgesamt stieg die Zahlen der Migrant:innen aus Westafrika seit Mitte der 1990er Jahre stärker an.
Es brauchte schließlich ein gewisses Maß an langfristiger Integration und den Aktivismus der „zweiten Generation“, um die koloniale Amnesie der Deutschen zu durchbrechen und Themen wie Rassismus einer breiteren Öffentlichkeit ins Bewußtsein zu bringen. Eine Hauptrolle spielte in der Bundesrepublik dabei das 1986 erschienene Buch “Farbe bekennen”, das u.a. die afrodeutschen Autorinnen May Ayim und Katharina Oguntoye herausgegeben haben. Es war zunächst nur einer kleineren Gruppe von Aktivist:innen bekannt, wird aber heute als Ursprung der afrodeutschen Bewegung gesehen. Die Autorinnen wählten darin ebenfalls eine sehr breite Herangehensweise, die vor allem Rassismus und Sexismus in Deutschland anprangerte und der Kolonialerfahrung keinen gesonderten, davon getrennten Status zuschrieb. Aus dieser Initiative entstand auch die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und der Verein ADEFRA – Schwarze Frauen in Deutschland. .[30]
Der frühe afrodeutsche Aktivismus der 1980er Jahre entstand im Spannungsfeld verschärfter Diskriminierung und einer sich entwickelnden pro-migrantischen Infrastruktur. Während sich Gesetzesverschärfungen, gesellschaftliche Ablehnung und rechtsradikale Übergriffe in den 1980er Jahren häuften, bauten Kirchen, Friedensaktivist:innen und Linksautonome ein Unterstützungsnetzwerk für Migrant:innen auf. Dieses Netzwerk war aber oft stark von weißen deutschen Mitarbeiter:innen geprägt. Afrikanische und afrodeutsche Aktivist:innen griffen im Gegensatz zu dem sich bildenden Netzwerk von Flüchtlingshelfer:innen auf ein eigenes und etabliertes Empowerment-Repertoire zurück, das aus antikolonialer Theorie und der globalen Emanzipationspraxis einer panafrikanistischen Diaspora entwickelt wurde. Es gründete auf einer kollektiven Diskriminierungserfahrung, die spezifisch für diese Gruppe war und historisch in die Zeit des Sklavenhandels, der Kolonisierung und der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung extrapoliert wurde. In der Bundesrepublik konnten pro-migrantische Aktivist:innen beider Seiten aber konkret erreichen, dass Ausländerräte und teilweise das Wahlrecht auf kommunaler Ebene eingeführt wurde. Dies hatte zur Folge, dass Politiker:innen potenziell auf Ausländer:innen als Wähler:innen eingehen mussten.
Wie bereits angedeutet, erschien das Jahr 1989 vielen Migrant:innen in Deutschland als Beginn eines Rückschritts gegenüber dieser Politik. May Ayim beschrieb nicht nur darum die Wiedervereinigung als „Sch-Einheit“. „Als die Mauer fiel“, erklärte sie, „hatte ich zeitweilig die Befürchtung, erschlagen zu werden...Wir spürten, dass mit der bevorstehenden innerdeutschen Vereinigung eine zunehmende Abgrenzung nach außen einhergehen würde“[31]. Die Gefahr, „erschlagen“ zu werden, konnte man in den „Baseballschläger-Jahren“ der frühen 1990er ganz wörtlich nehmen. Neben Brandanschlägen und Hetzjagden kam es auch zu Ermordung von Schwarzen, wie zum Beispiel des ehemaligen Vertragsarbeiters Amadeu Antonio Kiowa im Dezember 1990 in Eberswalde. Der Asylbeschluss von 1993 spiegelte dann auch den staatlichen und gesellschaftlichen Willen, mit dem bedingungslosen Asylrecht auch in der gesetzlichen Theorie zu brechen.[32]
Migrant:innen gingen aber weiter ihre eigenen Wege und schrieben vor und nach 1990 trotz aller Schwierigkeiten Erfolgsgeschichten. Die Zahl der Menschen aus Gegenden mit Kolonialgeschichte stieg in den späten 1990er Jahren stark an. Im Jahr 2004 lebten in Deutschland 12 099 Togoles:innen und 13 834 Kameruner:innen. Ihr privater oder öffentlicher Kampf gegen die andauernde Diskriminierung im Alltag konnte in Teilen der Gesellschaft antirassistische Positionen populär machen. Zivilgesellschaftliche Agency konnten vor allem diejenigen entfalten, die nicht mehr existentiell bedroht waren, sowie ihren Status in Deutschland legalisiert und wirtschaftlich konsolidiert hatten. Nachdem 1990 der bewaffnete antikoloniale Widerstand genauso vorüber war wie Nachfolgekonflikte im Kalten Krieg, konnten sie ihre Ressourcen auf die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit richten, die noch in den Diskriminierungsstrukturen der Gegenwart weiterlebt. Postkoloniale Initiativen, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und transnationale Vereine wie AfricAvenir versuchen heuteForderungen durchzusetzen, die teils schon mehr als ein Jahrhundert alt sind. Duala-Notablen forderten beispielsweise bereits 1914 die Restitution ihres von Kolonialbehörden enteigneten Landbesitzes. Als Reaktion auf die Forderungen ließen deutsche Beamte ihren Anführer, Rudolf Duala Manga Bell, hinrichten.
Seine Rehabilitation lässt bis heute auf sich warten. Der Mitautor dieses Textes ist Rudolf Manga Bells Großneffe und begann in den 1990er Jahren das Schicksal seines Großonkels aufzuarbeiten. Er engagierte sich daraufhin auch in den Debatten um die Restitution des Tangue (Kameruner Schiffsschmuck mit spiritueller und herrschaftlicher Funktion), der 1884 im Rahmen einer „Strafexpedition“ gestohlen und nach Deutschland gebracht wurde.
Nach mehr als hundert Jahren wurde durch die andauernde Restitutionsdebatte Migration aus den ehemaligen Kolonien auch sichtbarer. Obwohl kaum mehr eine Kontinuität zwischen Kolonisierung und Migration besteht, so machen doch Migrant:innen deutlich, wie hartnäckig sich das koloniale Erbe in der deutschen Gesellschaft hält. Sie tun dies aber schon lange nicht mehr nur als Migrant:innen sondern als verantwortungsbewusste Bürger:innen, die ein Stück globale Gerechtigkeit herstellen wollen.[33]
* Die Bilder in diesem Essay spiegeln meist den externen Blick auf Migrant:innen wider und reproduzieren Klischees und Vorurteile. Sie sollten darum kritisch analysiert werden, was im Rahmen dieses Essays nicht möglich war.
[1] Das hier vorgebene Format eines Kurzessays kann keine umfassende Wiedergabe der einschlägigen Literatur leisten. Für einen Gesamtüberblick über die Forschungsliteratur verweisen wir auf die Bibliographien der im Verlauf zitierten Werke.
[2] Patrick Weil: How to be French. Nationality in the Making since 1789 (Durham 2008), 152.
[3] Zur komparativen Migrationsgeschichte Jenny Pleinen: Die Migrationsregime Belgiens und der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg (Göttingen 2012).
[4] In Standardwerken zur Migrationspolitik spielen sie kaum eine Rolle, z.B. Jochen Oltmer: Migration und Politik in der Weimarer Republik (Göttingen 2005); Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge (München 2001); Christiane Reinecke: Grenzen der Freizügigkeit Migrationskontrolle in Großbritannien und Deutschland, 1880–1930 (München 2010); Präsenter sind sie in: Patrice Poutrus: Umkämpftes Asyl. Vom Nachkriegsdeutschland bis in die Gegenwart (Berlin 2019).
[5] Fatima el-Tayeb: Schwarze Deutsche: Der Diskurs um" Rasse" und nationale Identität 1890-1933 (Frankfurt 2001); Marianne Bechhaus-Gerst und Reinhard Klein-Arendt (Hg.): AfrikanerInnen in Deutschland und schwarze Deutsche - Geschichte und Gegenwart (Köln 2004).
[6] Robbie Aitken und Eve Rosenhaft: Black Germany. The Making and Unmaking of a Diaspora Community, (Cambridge 2013), 2.
[7] Aitken und Rosenhaft, Black Germany, 88 und 101.
[8] Weil: How to be French, 195.
[9] “Die öffentliche Meinung Deutschlands über die koloniale Frage und der Friedensvertrag im Spiegel des Camille Martin”, DKZ 38,2 (1921), 14.
[10] Theodor Michael: Deutsch sein und Schwarz dazu. Erinnerungen eines Afro-Deutschen (München 2014), 12.
[11] Florian Wagner: “Regards Croisés sur le Togo. Les Enjeux du Débat Franco-Allemand dans L’Entre-Deux Guerres (1919-1939)” RAHIA 25 (2007-2008), 90.
[12] Maria Framke: “Shopping Ideologies for Independent India? Taraknath Das’s engagement with Italian Fascism and German National Socialism” Itinerario 40,1 (2016), 55-81.
[13] Zitat Jean-Pierre Félix Eyoum.
[14] Klaus J. Bade: Das Manifest der 60. Deutschland und die Einwanderung (München 1994), 106.
[15] Quinn Solobodian: Foreign Front. Third World Politics in Sixties West Germany (Durham 2012), 28.
[16] “‘Eigentlich müßte Deutschland ein Paradies sein’: Die Afrika-Gesellschaft diskutiert mit Studenten aus dem Schwarzen Erdteil” Süddeutsche Zeitung (29.1.1960).
[17] Zur Rolle der bürokratischen Migrationsverhinderung siehe Alexis Spire: Étrangers à la carte. L'administration de l'immigration en France (1945-1975) (Paris 2005).
[18] “Eine Junge Dame aus Ghana” Süddeutsche Zeitung (28.2.-1.3.1959).
[19] Slobodian: Foreign Front, 61-73; Siehe auch: Peggy Piesche: “Mehr als Pro Choice”, Nicola Lauré al-Samarei: “Ich muss doch erzählen” und Thembi Wolf: “Eine schwierige Liebe” im Dossier Decolonize 68; Priscilla Layne: White Rebels in Black. German Appropriation of Black Popular Culture (Ann Arbor 2018).
[20] Franz J.T. Lee: Africa, Humania Quo Vadis? The Twilight of the Wretched of the Earth, (Online-Publikation 2012), 11.
[21] Jochen Oltmer, Axel Kreienbrink und Carlos Sanz Diaz (Hg.): Das ‚Gastarbeiter‘-System. Arbeitsmigration und ihre Folgen in der Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa (München 2012);
[22] Fasia: Freedom, Freiheit, Liberté.
[23] Slobodian: Foreign Front, 32.
[24] Bade, Manifest, 69-70.
[26] Poutrus: Umkämpftes Asyl, 85-88; Frank Bösch: “Engagement für Flüchtlinge. Die Aufnahme vietnamesischer ‚Boat People‘ in der Bundesrepublik” Zeithistorische Forschungen 14,1 (2017), 13-40; Mike Dennis und Karin Weiss (Hg.): Erfolg in der Nische? Die Vietnamesen in der DDR und in Ostdeutschland (Münster 2005).
[27] Weiss und Dennis: Erfolg in der Nische.
[28] “Letzte Zuflucht Kirche Regensburger Gemeinde bietet Togolesen Asyl” Junge Welt (12.3.1996).
[29] Interview mit geflüchteten Togolesen in Deutschland, Hamburg, 23.Dezember 2020.
[30] Eine Pionierin war in den 1970ern die Afrodeutsche Vera Heyer, die in den 1970er Jahren begann, afrikansche, afroamerikanische und Diaspora-Literatur zu sammeln.
[31] May Ayim: “Das Jahr 1990: Heimat und Einheit aus afro-deutscher Perspektive”, in: Ika Hügel (Hrsg.), Entfernte Verbindungen: Rassismus, Antisemitismus, Klassenunterdrückung (Berlin 1993), 206-220.
[32] Diese Periode aus afrodeutscher Sicht: Philipp Khabo Koepsell: Sankofa BRD. Eine Dokumentation Schwarzer deutscher Kulturproduktion zur Zeit des Mauerfalls (Epubli 2017).
[33] Eines der größten Projekte unter Leitung von Jeff Bowersox: Black Central Europe. Aus europäischer Sicht: Johnny Pitts: Afropäisch - Eine Reise durch das schwarze Europa (Berlin 2020) und Afropean.
Zitation
Jean-Pierre Félix-Eyoum, Florian Wagner, Das verdrängte Politikum. (Post-)Koloniale Migration nach Deutschland, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/das-verdraengte-politikum