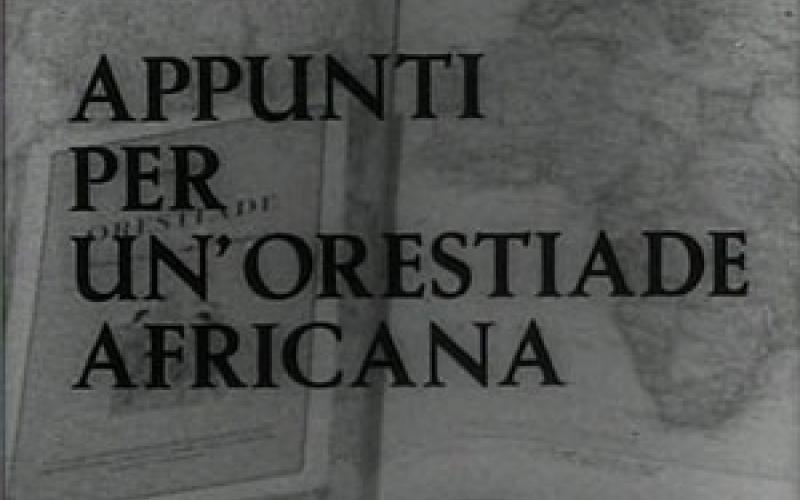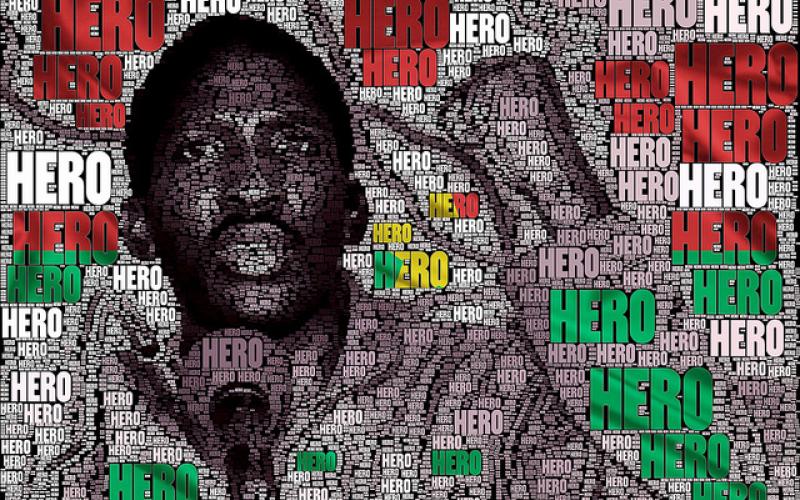Fünfzig Jahre nach dem „Afrika-Jahr“ 1960, als 17 Staaten vor allem in West- und Zentralafrika ihre politische Unabhängigkeit erreichten, ist die Betrachtung Afrikas allseits von Enttäuschungen geprägt.[1] Die Euphorie des „Afrika-Jahres“, die in vielen Unabhängigkeitsfeiern zum Ausdruck kam, bekam schon sehr bald erste Risse – zuerst im Kongo, wo schon Ende 1960 der erste Ministerpräsident und Hoffnungsträger Patrice Lumumba gestürzt und einige Monate später ermordet wurde;[2] wenige Jahre später in Nigeria, wo nach Putsch und Gegenputsch im Jahr 1966 der Südosten des Landes einen Sezessionsversuch unternahm, der zum sogenannten Biafra-Krieg von 1967 bis 1970 führte, an dessen Ende das nigerianische Militär die Sezession beendete und in dessen von der Weltöffentlichkeit durchaus beachteten Verlauf vermutlich zirka 500.000 Zivilisten in den Kampfhandlungen und vor allem an Hunger starben.[3] Spätestens seit Mitte der 1970er Jahre, seit den Kriegen im südlichen Afrika,[4] der Herrschaft von Despoten wie Idi Amin in Uganda[5] und der großen Hungersnot in Darfur und in Äthiopien in den 1980er Jahren[6] gilt Afrika als Kontinent der Hoffnungslosigkeit und des Chaos. Im Vergleich zum rasanten wirtschaftlichen Aufstieg Ost- und Südasiens in den letzten Jahren gilt Afrika heute aus europäischer Sicht – sofern es überhaupt noch wahrgenommen wird – als gescheitert und als ein Kontinent, dem man mit Ungeduld und Unverständnis gegenübertritt und dem man die Summe der gezahlten Entwicklungshilfegelder der vergangenen Jahrzehnte vorhält – als hätten die AfrikanerInnen den EuropäerInnen versprochen, sich zu entwickeln und dieses Versprechen nicht gehalten.[7]
Der von außen allseits gestellte Diagnose, Afrika sei bei der Einlösung des Entwicklungsversprechens und vor allem auch bei Herausbildung demokratisch verfasster Nationalstaaten vermutlich endgültig gescheitert, gilt es jedoch gleich zu Anfang relativierende Überlegungen gegenüberzustellen. So vergessen gerade EuropäerInnen hierbei nicht nur, wie lange Prozesse der Nationenbildung und der Demokratisierung in Europa gedauert haben, sondern auch und besonders, wie extrem gewaltreich die europäische Geschichte der vergangenen hundert Jahre war – so dass man sicherlich behaupten kann, dass der Kriegs- und Chaoskontinent des 20. Jahrhunderts nicht Afrika, sondern Europa war.
Ebenso verdrängt wird die direkte Beteiligung, ja Mitverantwortung Europas und der USA an Kriegen und Konflikten in Afrika, besonders im Zeitalter des Ost-West-Gegensatzes bis 1989. Während damals Nelson Mandela und sein African National Congress (ANC) als Terroristen betrachtet wurden, unterstützten westliche Demokratien aktiv Rebellenbewegungen wie die UNITA in Angola und die RENAMO in Mosambik, die für ihre Gräueltaten an der Zivilbevölkerung berüchtigt waren.[8]
Außerdem verstellt die Betrachtung von Afrika als Ganzes oft den Blick auf die enormen sozialen und politischen Unterschiede in den verschiedenen Staaten und auch auf die positiven (und stillen) Entwicklungen. Anders als in Somalia hat in Mosambik in den 1990er Jahren nach vielen Jahren Krieg eine bemerkenswerte Phase des friedlichen Wiederaufbaus begonnen.[9] Im politisch stabilen Tansania hat es seit der Unabhängigkeit trotz Ressourcenarmut im Gegensatz zu den Nachbarländern Burundi, Ruanda und Kongo weder Krieg noch Völkermord gegeben.[10] In Ghana und im Senegal haben sich politische Strukturen herausgebildet, in denen nach Wahlen geordnete Machtwechsel stattfinden konnten.[11] Botswana hat anders als Angola oder der Sudan die im Lande vorhandenen Bodenschätze zum Aufbau eines stabilen politischen Systems genutzt.[12] In Südafrika ist der von vielen Anfang der 1990er Jahre erwartete Bürgerkrieg aufgrund der Versöhnungspolitik des ANC ausgeblieben und das Land ist bei der Aufarbeitung von Rassismus und Apartheid auf einem bisher viel erfolgreicheren Weg als zum Beispiel Simbabwe.[13] Die Beschreibung historischer Prozesse in Afrika erfordert ein großes Ausmaß an Differenzierungen. Wenn dieser Beitrag allgemeine Aussagen über politische Entwicklungen in Afrika treffen will, so wird er zwangsläufig in weiten Teilen aus thesenhaften Verkürzungen bestehen.
Von zentraler Bedeutung ist außerdem trotz des Abstands von zirka fünfzig Jahren die koloniale Vorgeschichte der unabhängigen afrikanischen Staaten, denn obwohl eine spürbare und durchdringende Kolonialherrschaft in vielen Gebieten Afrikas nicht länger als zwei Generationen andauerte, war der Kolonialismus – wie ich in diesem Beitrag andeuten möchte – vermutlich in keinem Feld so prägend wie bei der Herausbildung neuer politischer Strukturen. Ziel dieses Textes ist es nicht, monokausale, in der Kolonialgeschichte angesiedelte Schuldzuweisungen vorzunehmen, sondern vielmehr den historisch geprägten Handlungsrahmen der politischen Eliten des postkolonialen Afrikas zu bestimmen, in dem sich ihre Erfolge oder ihr Scheitern an der Aufgabe zeigen, die eigenen Handlungsspielräume sukzessive zu vergrößern. Dies geschieht in dem Verständnis, dass AfrikanerInnen auch und gerade während des Kolonialismus nicht nur Objekte der Geschichte und deren europäischen Protagonisten waren. Der Kolonialismus war, wie noch zu zeigen sein wird, in gewissem Ausmaß das Ergebnis einer – freilich sehr hierarchisierten – historischen Interaktion zwischen den verschiedensten afrikanischen und europäischen Akteuren.
Ein erster Hinweis auf die Dauerhaftigkeit der durch den Kolonialismus geprägten politischen Strukturen lässt sich schon aus der Überlegung ableiten, dass beim Aufbau administrativer Strukturen und politischer Institutionen im Rahmen des kolonialen Staates nicht „Modernisierung“ oder „Entwicklung“ die leitenden Kategorien waren, sondern der Begriff der „Tradition“. Die Berufung auf (reale, veränderte oder erfundene) Traditionen[14] war die zentrale Legitimation für politische Akteure in der Kolonialzeit, viel mehr als der Verweis auf Modernisierung, Zivilisation, Recht oder Gott. Damit wurde der Sinn der während der Kolonialherrschaft geschaffenen Strukturen in Afrika selbst verortet, während der zentrale Begriff der europäischen Politik des späten 19. Jahrhunderts, der Begriff der Nation, vorerst keine Rolle spielte. Erst im Laufe der Dekolonisation wurde der Begriff des Nation Building auf Afrika bezogen und dort als zentrale Aufgabe der neuen unabhängigen Staaten aufgefasst.
Ende des 19. Jahrhunderts, als die europäischen Kolonialmächte den ganzen Kontinent untereinander aufteilten, legte niemand unter den neuen Kolonialherren Wert auf die Herausbildung nationaler Identitäten bei AfrikanerInnen, sei es mit dem jeweiligen „Mutterland“ oder mit den neuen kolonialen Territorien als Referenzpunkt. Vorrangiges Ziel der Kolonialmächte war vorerst die Anerkennung der eigenen Ansprüche in Afrika durch die anderen europäischen Mächte, die Sicherung der wichtigsten Handelsrouten und der Abschluss einer Vielzahl von sogenannten Schutzverträgen mit afrikanischen Chiefs und Königen, sofern diese nicht mit Kriegszügen unterworfen werden mussten, wie in den 1890er Jahren im heutigen Simbabwe[15] oder im Königreich Ashanti[16] im heutigen Ghana.
Das anfängliche Desinteresse europäischer Regierungen an den inneren Strukturen der afrikanischen Gesellschaften lässt sich auch daran erkennen, dass einige Kolonien zu Beginn von Handelskompanien verwaltet oder sogar erschaffen wurden, wie das heutige Kenia von der Imperial British East Africa Company[17] oder die Festlandgebiete des heutigen Tansanias von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft[18] – eine kostengünstig scheinende Variante der Verwaltung der neu erworbenen Gebiete, die schon bald aufgegeben werden musste und durch einen von den Kolonialbehörden der Metropolen eingesetzten Verwaltungsapparat ersetzt wurde.
Dieser Verwaltungsapparat bestand gerade in den ersten Jahrzehnten aus wenigen Verwaltungsbeamten und kleineren bewaffneten Verbänden, in denen häufig nur die Offiziere Europäer waren und die sowohl eventuellen Widerstand der afrikanischen Bevölkerung bekämpfen als auch die Fixierung eines kolonialen Territoriums durchsetzen sollten.[19] Die Etablierung einer Kolonialherrschaft als Aufbau eines rudimentären Staatsapparats, der – wenigstens formal – ein Territorium mit eindeutigen Grenzen verwaltete, war ein Prozess, der in Teilen Afrikas bis in die 1920er Jahre dauern konnte.
In den 1880er Jahren waren die Grenzen zwischen den kolonialen Gebieten häufig nur an den Küsten klar geregelt, während im Hinterland vielerorts Unklarheit über den Grenzverlauf herrschte.[20] Noch 1910 hätte in der Nähe des Ruwenzori-Gebirges im Zentrum des Kontinents wahrscheinlich kaum jemand sagen können, ob er in der belgischen Kolonie Kongo oder im britischen Protektorat Uganda lebt. Vielleicht wäre den Menschen mangels kolonialstaatlicher Präsenz noch nicht einmal klar gewesen, dass sie überhaupt in einem Kolonialstaat leben. Näher am Meer war die politische Lage weniger missverständlich. Fast überall in Afrika wurden die Küstengebiete um die Seehäfen zu den wirtschaftlichen und politischen Zentren. In Westafrika führte der Kolonialismus so zu einer Neuordnung der politischen Geografie mit neuen Machtzentren an den Küsten und neuen Peripherien im Inland, die es in dieser Form vor dem Ende des 19. Jahrhunderts trotz der europäischen (Sklaven-)Handelsstützpunkte an der Küste nicht gegeben hatte.
Mit der Wende zum 20. Jahrhundert setzte eine langsame Festigung der kolonialen Herrschaft und eine Etablierung des Kolonialstaates ein, obwohl es auch nach der Phase der kolonialen Machtergreifung teilweise massiven afrikanischen Widerstand gab, vor allem in den deutschen Kolonien (der Krieg der Herero und Nama 1904-1907 im heutigen Namibia,[21] der „Maji Maji-Aufstand“ 1905-1907 im heutigen Tansania[22]), aber auch in den britischen und französischen Kolonien (z.B. der sogenannte „Hüttensteuerkrieg“ in Sierra Leone 1898/99,[23] der Chilmbwe-Aufstand 1915 im heutigen Malawi[24] oder der langjährige Widerstand im Baoulé-Gebiet in der Elfenbeinküste[25]). Langfristig führte diese sogenannte secondary resistance, der Widerstand gegen eine bereits errichtete Kolonialherrschaft, zu einer Ausweitung und Festigung des kolonialen Staates. Das Kolonialmilitär wurde ausgebaut und die Kolonialverwaltung wurde breiter gefächert und sukzessive professioneller. Auch die im Rückblick oft romantisierend betrachteten Abenteurer auf einem einsamen Posten in entlegenen Gebieten wurden nach und nach durch ausgebildete Verwaltungsfachleute ersetzt.[26]
Der sich entwickelnde koloniale Staat basierte nicht auf politischer Teilhabe, sondern auf Ausschluss, Macht und Kontrolle. Die Kolonialherren reklamierten ein Staatsterritorium und eine auf ihren Rechtsvorstellungen basierende Staatsverwaltung, aber sie gingen nicht davon aus, dass sie ein Staatsvolk regierten und hatten auch kein Interesse, ein solches zu schaffen oder zu seinem Entstehen beizutragen. Dementsprechend wurden die AfrikanerInnen der Kolonien auch nicht als BürgerInnen oder gar StaatsbürgerInnen wahrgenommen, sondern als Untertanen – sie waren not citizens but subjects, um einen Buchtitel des ugandischen Anthropologen und Politikwissenschaftlers Mahmood Mamdani abzuändern.[27] Eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, waren die wenigen Angehörigen der afrikanischen Bildungsschichten in den französischen Kolonien, die paternalistisch als assimilierungsfähige „évolués“ bezeichnet wurden und das französische Wahlrecht erhalten hatten.[28]
Ab wann kann davon gesprochen werden, dass ein kolonialer Staat etabliert war? Und welche Rolle wurden den afrikanischen „Untertanen“ – die im kolonialen Sprachgebrauch noch lange „natives“ („Eingeborene“) blieben – im kolonialen Staat zugewiesen?
Die Besteuerung der afrikanischen Bevölkerung war ein erstes, entscheidendes Kriterium für die Durchsetzungsfähigkeit des kolonialen Staates. Diese Steuern wurden in der Regel als pauschale Kopf- oder Hüttensteuern erhoben und ähnelten weniger einem modernen Steuersystem als vielmehr der Tributpflicht in vormodernen Gesellschaften – ein Vergleich, den auch viele AfrikanerInnen zogen, die auf vielfältigste Art versuchten, sich der Besteuerung zu entziehen.[29] Die Steuererhebung des kolonialen Staates geriet zunehmend ins Zentrum der Kolonialpolitik, weil sie direkt oder indirekt auf ökonomische und soziale Veränderungen der afrikanischen Gesellschaften zielte. So war für die Kolonialverwaltung neben der Summe der erhaltenen Steuern auch wichtig, dass diese mit Geld und nicht mittels Sachleistungen beglichen wurden, denn nur so konnte die afrikanische Bevölkerung zumindest teilweise aus einer familiären Ökonomie herausgezogen und in eine vom Kolonialstaat und europäischen Privatleuten und Firmen dominierte, monetarisierte Marktwirtschaft eingebunden werden, entweder als Marktproduzenten oder – aus Sicht der Kolonialverwaltung noch erstrebenswerter – als Lohnarbeiter. In einigen Kolonien konnte daher auch die Steuerlast durch Vorlage einer Arbeitsbescheinigung verringert werden. Besonders in den Siedlerkolonien des südlichen Afrikas und in Kenia ging es dem Kolonialstaat darum, vor allem die afrikanischen Männer in einen vom Kolonialstaat reglementierten Lohnarbeitsmarkt zu zwingen,[30] in dem die Löhne auch deshalb niedrig bleiben konnten, weil in der Regel die Lohnarbeit der Männer durch eine von in den Dörfern zurückbleibenden Frauen betriebene landwirtschaftliche Subsistenzproduktion ergänzt wurde. Hieraus wird auch deutlich, dass die Besteuerung auch Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse innerhalb der afrikanischen Gesellschaften hatte. Da besonders in den ersten Jahrzehnten der Kolonialherrschaft zumeist nur Männer besteuert wurden, konnten sich für Frauen vielleicht vorübergehend Gelegenheiten ergeben, unbelasteter als die Männer in der kolonialen Geldökonomie zu agieren, wenn sie zum Beispiel auf den Märkten von den Steuereintreibern unbehelligt blieben. Langfristig aber trug die koloniale Besteuerung maßgeblich dazu bei, dass afrikanische Männer analog zur bürgerlichen Kleinfamilie Europas jener Zeit zu alleinigen Familienoberhäuptern auch im ökonomischen Sinne wurden und die starke eigenständige Rolle von afrikanischen Frauen in der Ökonomie vor allem ideologisch in Frage gestellt wurde. Diese Entwicklung entsprach auch dem von den christlichen Missionen propagierten Familienmodell.[31]
Eng verbunden mit der Besteuerung war ein weiterer „Leistungsnachweis“ des Kolonialstaates, der Ausbau und die Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur. Wichtig für die Exportökonomie waren hierbei die Eisenbahnlinien zur Küste. Für die Durchsetzung kolonialer Herrschaft noch entscheidender waren aber die unzähligen Straßen und Wege, die bis in die abgelegensten Gebiete häufig in schwerer körperlicher Arbeit mit einfachen Werkzeugen gebaut und befestigt wurden. Hierfür mussten der Kolonialstaat und seine afrikanischen Helfer auf Zwangsarbeit zurückgreifen. Die Bereitstellung von genügend Zwangsarbeitern für öffentliche Aufgaben war eine zentrale Aufgabe der lokalen Repräsentanten der Kolonialverwaltung. Von einem auch nur ansatzweise modernen Arbeitsmarkt konnte hierbei nicht die Rede sein. Diese Arbeit wurde vor allem in französischen Kolonien als corvée bezeichnet, ein Begriff der auf Frondienste im Feudalismus verweist. Um den Zwangscharakter dieser Arbeit etwas zu bemänteln, wurden hierfür oft Begriffe für Gemeinschaftsarbeit, Nachbarschaftshilfe oder Tributpflicht aus den unterschiedlichsten afrikanischen Sprachen verwendet. Dies ist ein weiteres Beispiel für eine koloniale Herrschaftstechnik, die versuchte, Zwangsmaßnahmen des kolonialen Staates durch Verweise auf vorkoloniale Begebenheiten als traditionell zu legitimieren und gesellschaftlich zu verankern. Bei der corvée führte dies allerdings in den meisten Fällen nicht zu einer breiten Akzeptanz in der afrikanischen Bevölkerung.[32]
Hüttensteuern und Zwangsarbeit sind ohne Zweifel als Elemente vormoderner Herrschaftsausübung zu bewerten. Der Moderne zuzuordnen wären hingegen eher die Bereiche der Bildung und der medizinischen Versorgung. Staatliche Leistungen in diesen beiden Feldern gehören bis heute zu den Haupterwartungen von AfrikanerInnen an einen Staat. Ebenso ungebrochen ist unter europäischen Apologeten des Kolonialismus bis in die heutige Zeit die Vorstellung, der Bau von Schulen und Krankenhäusern gehöre unbestreitbar zu den großen Verdiensten der europäischen Kolonialherrschaft.[33] Dem lässt sich entgegnen, dass die Leistungen des kolonialen Staates in diesen beiden Feldern gerade in der ersten Hälfte der Kolonialzeit sehr dürftig ausfielen. Bildung und Gesundheit wurden als „soziale Frage“ eher an die Missionsgesellschaften delegiert. Die Leistungen des Staates in diesen Feldern bestanden nicht aus Angeboten an die AfrikanerInnen, sondern aus einer ganzen Reihe von Maßnahmen und Anordnungen in den Bereichen Gesundheit, Hygiene und auch schon bald Natur- und Tierschutz, die bis hin zu umfangreichen Umsiedlungen und Kriminalisierungen gehen konnten.[34] Diese Maßnahmen griffen mitunter massiv in das Leben der Menschen ein und mussten ebenso wie der Straßenbau oft mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden.
Widerstand oder Verweigerung gegen diese Maßnahmen, gegen Besteuerung oder Zwangsarbeit führten besonders in ersten Jahrzehnten der Kolonialzeit zu Strafexpeditionen des Kolonialmilitärs oder anderer bewaffneter Verbände, die oft mit großer Brutalität durchgeführt wurden und aus Sicht der AfrikanerInnen den Raubzügen der war-bands oder der Sklavenjäger der vorkolonialen Zeit ähnelten.[35] Im Umgang mit Dissens gab es gerade zu Beginn der Kolonialzeit mehr Kontinuität zur vorkolonialen Zeit als Erneuerung. Wenngleich das Ausmaß der Gewaltausübung gerade in den 1940er und 1950er Jahren in den stark segregierten Siedlerkolonien des südlichen Afrikas sicherlich größer war als zum Beispiel in den meisten Kolonien Westafrikas, gehörte körperliche Gewalt – zumindest deren Androhung – doch zum Kern kolonialer Herrschaft und umfasste unterhalb der Ebene militärischer Einsätze auch alltägliche Gewaltformen wie die Prügelstrafe oder den „Einsatz“ der Nilpferdpeitsche.[36] Es gehört auch zum Wesen von Kolonialstaaten, dass selbst Gewaltexzesse von Beamten oder staatlichen Sicherheitskräften nur in den seltensten Fällen bestraft wurden.[37]
Innenpolitisches Ziel des Kolonialstaates war der koloniale Gehorsam. Rebellionen sowie jeglichen aktiven Widerstand galt es zu vermeiden und zu unterbinden. Dabei bedienten sich die Kolonialherren stets afrikanischer Gehilfen, ohne die das koloniale System in der gegebenen Form kaum funktioniert hätte. Besonders institutionalisiert war diese indirekte Herrschaft über AfrikanerInnen in den britischen Kolonien, zum Beispiel in Nigeria, wo der Begriff der indirect rule durch den Gouverneur Frederick Lugard geprägt wurde.[38] Indirect rule war ein Herrschaftssystem, das lokale Herrscher (fast nie Herrscherinnen) integrierte oder neue Chiefs/Headmen einsetzte. Häufig konnten die Kolonialherren lokale Herrscher auf ihre Seite ziehen, indem sie in interne lokale Konflikte eingriffen. Chiefs hatten die Aufgabe der lokalen Gerichtsbarkeit und waren gegenüber den höheren Stellen der Kolonialverwaltung verpflichtet, eine bestimmte Summe an Steuern abzuliefern und öffentliche Arbeiten wie den bereits erwähnten Straßenbau durchzuführen. Wenn diese Vorgaben erfüllt wurden, kümmerten sich höhere Stellen selten darum, wie dies geschehen war. Dies bedeutete, dass für die meisten AfrikanerInnen, gerade in den ländlichen Gebieten, der koloniale Staat konkret im Alltag durch einen afrikanischen Chief repräsentiert wurde.[39]
Die europäischen Kolonialherren versprachen sich von diesem System eine kostengünstige Lokalverwaltung, in der unter der Aufsicht europäischer Distriktbeamter die Mühsal der Regelung alltäglicher Konflikte den Einheimischen überlassen wurde. Der koloniale Chief hatte eine Verwaltungsposition auf lokaler Ebene inne, deren Aufgaben von den übergeordneten Stellen festgelegt wurden. Im Vergleich zu vorkolonialen afrikanischen Chiefs waren die Aufgaben der kolonialen Chiefs in fast allen Fällen neu definiert. Dennoch wurden die Chiefs als „traditionelle Herrscher“ bezeichnet, deren Amt aus der vorkolonialen Zeit stamme und somit historisch gewachsen sei, eine Legende, die nicht nur die europäischen Kolonialbeamten, sondern – durchaus nachvollziehbar – auch die Chiefs selbst propagierten.[40] Die Vorstellung einer herrschaftlichen Kontinuität und ein besonderes Verhaftetsein in der Tradition gehört daher auch zu den erfolgreichen Erfindungen des Kolonialismus, weil diese Chiefs selbst und auch ihre Klientel ein Interesse am Erfolg dieser Erfindung und damit an der Beibehaltung ihrer Machtposition hatten. Dieser Macht als Steuereintreiber, Staatsanwalt und Richter in Personalunion konnte sich die Bevölkerung kaum entziehen, denn es gab kaum mehr die „checks & balances“ der vorkolonialen politischen Systeme, mit denen in unterschiedlichster Weise die Macht durch das Volk begrenzt oder beeinflusst werden konnte. Mamdani bezeichnet daher die Herrschaft der von den Kolonialherren eingesetzten Chiefs als eine Art „dezentralisierte Despotie“.[41]
Der Distrikt war die politische Kerneinheit des kolonialen Staates. Im Distrikt versuchte ein District Commissioner oder ein Commandant de Cercle allgemeine Vorgaben des Gouverneurs und dessen Beamten in konkrete Politik umzusetzen und stützte sich dabei auf afrikanische Chiefs. Diese Trennung verschiedener Verwaltungsebenen entsprach häufig auch eine Trennung der Rechtssysteme, denn neben einem geschriebenen Recht mit Bezug auf europäische Rechtsnormen gab es verschiedenste Formen von sogenanntem traditionellen oder Gewohnheitsrecht, das für AfrikanerInnen galt.[42]
Distrikte waren Neugründungen der Kolonialverwaltung, die auf drei Prinzipien basierten: Sie sollten handhabbare Verwaltungsgrößen sein; sie sollten möglichst eine ethnisch homogene Bevölkerung haben; und diese ethnisch homogene Bevölkerung sollte traditionelle politische Führer haben, die als Chiefs der Kolonialverwaltung dienen konnten. Die Umsetzung dieses Verwaltungsdesigns stieß – aus heutiger Sicht kaum überraschend – auf große Probleme. So konnten die von den Kolonialherren identifizierten ethnischen Gruppen so groß sein, dass sie auf mehrere Distrikte verteilt werden mussten. Oder in einem Distrikt lebten Menschen, die sich unterschiedlichen ethnischen Gruppen zugehörig fühlten und sich mit guten Gründen gegen eine ethnische Homogenisierung wehrten – ein Problem, dass auch in Europa bis in die jüngste Zeit hinein anzutreffen ist. In einigen Gebieten des kolonialen Afrikas ließen sich ethnische Gruppen kaum identifizieren oder die Bevölkerung äußerte sich zu Fragen ihrer ethnischen Zugehörigkeit widersprüchlich und irreführend. In vielen Distrikten sahen sich die europäischen Kolonialbeamten mit Ansprüchen rivalisierender afrikanischer Autoritäten konfrontiert und mussten hier häufig Partei ergreifen, was die Etablierung einer Kolonialverwaltung zumeist verkomplizierte. Auch unumstrittene politische Autoritäten konnten sich als problematisch erweisen, wenn sie sich als rebellisch oder renitent erwiesen und der Kolonialstaat die Vorstellung von „traditionell legitimierter“ Herrschaft dem Primat des Machterhalts unterordnen und an manchen Orten de facto neue Dynastien einsetzen musste.
Als Reaktion auf all diese Probleme hat der koloniale Staat nicht nur das mit spezifischen Funktionen ausgestattete Amt des Chiefs geschaffen, sondern mitunter auch die dazu passenden ethnischen Gruppen. So war der Kolonialismus die Zeit einer invention of tradition und auch einer invention of tribes. Diese „Stämme“ wurden im kolonialen Kontext verstanden als eine quasi natürliche und abgeschlossene soziale Gruppe, die letztlich auf einer biologischen Abstammung basierte, als eine geschlossene kulturelle und auch sprachliche Einheit, mit eindeutig identifizierbaren und ererbten Traditionen und Organisationsformen, in deren Rahmen das Zusammenleben, kulturelle und religiöse Praktiken und teilweise auch die Wirtschaftsweise geregelt wurden.[43] Der so verstandene „Stamm“ oder tribe war in der von den Kolonialherren propagierten Vorstellung eine Primordialkategorie, die eine traditionelle, geschlossene und stagnierende Gesellschaftsformation beschrieb, die – im impliziten Gegensatz zu den dynamischen Gesellschaften Europas – aus sich heraus keine historische Dynamik entfalten könne. Ähnliche Vorstellungen sind auch in der Gegenwart noch verbreitet. So sagte der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy im Jahr 2007 ausgerechnet vor einem universitären Publikum im senegalesischen Dakar:
„Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès.”[44]
In der Kolonialzeit beinhalteten derartige Vorstellungen nicht nur eine Abwertung afrikanischer Gesellschaften, sondern auch eine grobe Vereinfachung und Vereinheitlichung ihrer Organisationsformen. Im vorkolonialen Afrika fanden sich die verschiedensten sozialen und politischen Ordnungen: von Gesellschaften, die in kleinen Gruppen basierend auf realer oder fiktiver Verwandtschaft lebten und in mehr oder weniger lockeren Verbindungen und Allianzen zu anderen Gruppen standen, bis hin zu zentralisierten Königreichen mit einer ausgeprägten Verwaltungsstruktur. Auch afrikanische Vorstellungen von ethnischen Gruppen, ihrer Bedeutung und ihren Funktionen, waren höchst unterschiedlich. Dabei war besonders das 19. Jahrhundert von raschen und tiefgreifenden Veränderungen geprägt: von umfangreichen Migrationsbewegungen, von gravierenden religiösen und kulturellen Veränderungen, von der Notwendigkeit weitgehender ökonomischer Neuausrichtung, von politischen Zentralisierungsprozessen, aber auch vom Zerfall größerer politischer Einheiten.[45]
Nicht nur die Organisationsformen waren ständigen Veränderungen unterworfen. Da sich auch in Afrika Menschen auf unterschiedlichen Ebenen als Angehörige von sozialen Gruppen verstanden – Familien, Clans, Alters-, Geschlechts- oder Berufsgruppen und auch von ethnischen Gruppen – gab es mehr Formen selbst wahrgenommener sozialer Zugehörigkeit als die von Europäern einseitig in das Zentrum gestellte, notorische „Stammesidentität“. Die Kolonialherren glaubten dagegen daran, dass für AfrikanerInnen die ethnische Zugehörigkeit die zentrale soziale Kategorie sei, die soziale Leitdifferenz afrikanischer Gesellschaften schlechthin.
Somit erschien es der Kolonialverwaltung nahe liegend, „Stämme“ im oben definierten Sinn zu identifizieren und zu bestimmen, die Menschen in diese Stammeskategorien einzuordnen und ihre „Traditionen“, Sprachen und kulturellen Praktiken festzustellen. Unterstützt wurde sie hierbei einerseits von Missionaren, die sich – getrieben von dem Interesse, die Bibel in afrikanische Sprachen zu übersetzen – als Linguisten betätigten, Sprachen klassifizierten und von Dialekten unterschieden.[46] Andererseits entwickelte sich die Ethnologie zur klassischen Herrschaftswissenschaft des Kolonialismus. Ethnologen, mitunter als Regierungsethnologen fest angestellt, erforschten die kulturellen, sozialen und politischen Praktiken der AfrikanerInnen und trugen dazu bei, eindeutig abgrenzbare ethnische Gruppen zu definieren und fest im kolonialen und postkolonialen Bewusstsein zu verankern. Dieses Interesse von Kolonialbeamten und Ethnologen konfrontierte die AfrikanerInnen mit dem Problem, dass sie in der Vorstellung der Europäer in festen „Stämmen“ lebten und dass nur diese als soziale Einheit vom Kolonialstaat akzeptiert wurde.
Gleichzeitig bot der Kolonialstaat mit dem Amt des Chiefs einigen wenigen Afrikanern Einfluss, Macht und – über die Möglichkeit an Steuereinnahmen und Gerichtsgebühren zu partizipieren – auch einen gewissen materiellen Wohlstand und die einzige Möglichkeit politisches Gehör zu finden sowie eine – wenngleich paternalistische – Anerkennung für das „Eigene“. Dies hatte zur Folge, dass nicht nur Kolonialbeamte, Missionare und Ethnologen „Stämme“ und „Traditionen“ suchten und (er)fanden, sondern auch viele Afrikaner – oder wie der Historiker John Iliffe schrieb: „Europeans believed Africans belonged to tribes; Africans built tribes to belong to.“[47]
Hieran beteiligten sich besonders jene Afrikaner, die glaubten, vom Kolonialstaat zum Beispiel durch die Ernennung zum Chief oder ganz allgemein durch Unterstützung bei der Lösung jedweder innerafrikanischer Konflikte profitieren zu können. Es ist leicht vorstellbar, dass dieses Suchen und (Er)finden oft widersprüchliche und konkurrierende Ergebnisse brachte. So zog sich zumindest durch die erste Hälfte der Kolonialzeit eine permanente, oft hitzige Debatte zwischen AfrikanerInnen und Europäern, aber auch nur unter EuropäerInnen oder nur unter AfrikanerInnen darüber, welche Menschen zu welchem „Stamm“ gehörten, was Sprachen und was Dialekte sind und worin genau die sozialen und kulturellen Traditionen bestehen – die Traditionen, die angeblich seit Menschengedenken unveränderlich das Sozialgefüge und den Alltag der in „Stämmen“ lebenden Menschen bestimmten.
Die Erfindung von „Stämmen“ im kolonialen Sinne war letztlich eine Gemeinschaftsproduktion von europäischem Kolonialstaat und AfrikanerInnen, vor allem von afrikanischen Eliten.[48] Tradition war der zentrale Begriff, zugleich Ziel und Legitimation dieser Politik. Es ging nicht um die Herausbildung einer Nation. Die Kolonialbehörden hatten nicht das Ziel, in dem von ihnen verwalteten Territorium ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern, aus dem sich ein Nationalgefühl hätte entwickeln können. Betont wurden die trennenden, angeblich unveränderlichen ethnischen Grenzen, die als vorzugsweise ethnisch homogene Verwaltungsdistrikte mit sich auf Tradtionen berufenden Chiefs ihren politischen Ausdruck fanden. Wie schon die Chiefs waren auch die „Stämme“ keine pure Fiktion. Es gab Anknüpfungspunkte an Ämter, soziale Strukturen und kulturelle Zusammenhänge der vorkolonialen Zeit. Doch die vom Kolonialstaat definierten „Stämme“ und aufgebauten Strukturen hatten in der Regel wenig, oft sehr wenig mit den Inhalten, der sozialen und kulturellen Substanz sowie der Bedeutung vorkolonialer Gesellschafts- und Sozialformen zu tun.
Das Bild der seit Urzeiten in „Stämmen“ lebenden Afrikaner und Afrikanerinnen ist bis heute in Europa präsent. Während des Kolonialismus fürchteten viele Kolonialbeamte eine „Detribalisierung“ der afrikanischen Bevölkerung. Sie waren skeptisch gegenüber zu weit reichenden Bildungsangeboten oder gegenüber einem zu schnellen ökonomischen Aufstieg der AfrikanerInnen. Besonders ablehnend waren die Kolonialbehörden gegenüber nationalen Vereinigungen, die die „Stammesgrenzen“ überwanden, die eventuell sogar versuchten, das „natürliche Stammesdenken“ durch einen fremden und gefährlichen Nationalismus zu ersetzen. Dies betraf besonders Vereinigungen mit politischer Zielsetzung. Zwar wurde in Südafrika schon 1912 mit dem South African Native National Congress, ab 1923 African National Congress (ANC), eine nicht-ethnisch orientierte politische Organisation gegründet, doch im restlichen Afrika war an die Bildung kolonieweiter, quasi nationaler politischer Vereinigungen lange Zeit nicht zu denken. Nationale Parteien entwickelten sich gegen den Widerstand der Kolonialherren zumeist erst ab den späten 1940er Jahren. Ihre Vorläufer waren in der Regel Gruppen, die sich auf eine ethnische Gruppe bezogen und häufig auch ein Ethnonym im Namen trugen, wie zum Beispiel die Mitte der 1920er Jahre in Kenia gegründete Kikuyu Central Association.[49] Derartige Gründungen vorgeblich ethnischer Organisationen fanden bei den Kolonialbehörden größere Akzeptanz, vor allem dann, wenn sie ihre Aktionen auf die Ebene der Distrikte beschränkten, wo sie als inner-ethnische Politik aufgefasst wurden. So begann die Phase afrikanischer Politik in vielen afrikanischen Kolonien in ethnisch orientierten Gruppierungen, die in ethnisch definierten Distrikten operierten. Ethnische Zughörigkeit – in dem in der Kolonialzeit entwickelten Sinne – erhielt so eine politische Dimension.[50]
So ist es nicht verwunderlich, dass viele nationale Parteien im Afrika der 1950er Jahre – bei aller nationaler Rhetorik – nicht nur aus diesen ethnischen Organisationen hervorgegangen waren, sondern auch häufig einen eindeutig ethnischen oder zumindest regionalen Schwerpunkt hatten, der teilweise noch mit der Anbindung an eine bestimmte Religion oder Konfession verbunden war, wie dies zum Beispiel für die drei großen politischen Parteien Nigerias galt.[51] Breite nationalistische Bewegungen ohne ethnische Fokussierung, wie die Tanganyika African National Union (TANU) von Julius Nyerere,[52] waren selten. In den meisten Anfang der 1960er Jahre unabhängig gewordenen Staaten gab es anfangs zwar ein Mehrparteiensystem, doch diese Parteien unterschieden sich weniger programmatisch oder ideologisch als vielmehr durch ihre ethnische oder regionale Ausrichtung. So wurden Wahlsiege als Siege bestimmter ethnischer Gruppen oder Regionen betrachtet, die nun die Macht im Zentralstaat auf Kosten anderer Gruppen erobert hatten. Die daraus resultierende politische Unzufriedenheit und Instabilität führte in vielen Staaten zu Einparteiensystemen oder Militärputschen.[53]
AfrikanerInnen haben das Gefäß des Nationalstaates geerbt, allerdings ohne Nation. Die koloniale Erfindung von Distrikten und „Stämmen“ führte zur Herausbildung politischer Ethnizität, die als koloniale Erblast auch nach 1960 die formal unabhängigen afrikanischen Staaten prägte, ein Nation Building erschwerte und in einer ganzen Reihe von Staaten innere Konflikte bis hin zu Kriegen und zum Zusammenbruch staatlicher Strukturen verschärfte.[54]
[1] Überblickswerke zur afrikanischen Geschichte in deutscher Sprache: John Iliffe, Geschichte Afrikas, 2. Aufl. München 2003 (1. Aufl. 1997); Franz Ansprenger, Politische Geschichte Afrikas im 20. Jahrhundert, 3., neubearb. und erw. Aufl. München 1999 (1. Aufl. 1992); Gerhard Hauck, Gesellschaft und Staat in Afrika, Frankfurt am Main 2001; Christoph Marx, Geschichte Afrikas. Von 1800 bis zur Gegenwart, Paderborn 2004; Winfried Speitkamp, Kleine Geschichte Afrikas, Stuttgart 2007; Als Einführung in die Geschichte des Kolonialismus: Jürgen Osterhammel, Kolonialismus: Geschichte – Formen – Folgen, München 2002 (1. Aufl. 1995); Andreas Eckert, Kolonialismus, Frankfurt am Main 2006. (Bei Literaturhinweisen wurden in diesem Beitrag – wenn möglich – deutschsprachige Werke ausgewählt.)
[2] Vgl.: Thomas Kacza, Die Kongo-Krise 1960-1965, Pfaffenweiler 1990; Ludo De Witte, Regierungsauftrag Mord. Der Tod Lumumbas und die Kongo-Krise, Leipzig 2001; Albert Wirz, Krieg in Afrika. Die nachkolonialen Konflikte in Nigeria, Sudan, Tschad und Kongo, Wiesbaden 1982, S. 509–560.
[3] Zum „Biafra-Krieg“ vgl. Wirz, Krieg in Afrika, S. 118–171. Axel Harneit-Sievers/Jones O. Ahazuem/Sydney Emezue, A Social History of the Nigerian Civil War, Enugu – Hamburg 1997.
[4] Frederick Cooper, Africa Since 1940. The Past of the Present, Cambridge 2002, S. 133–155. Vgl. unter anderem die entsprechenden Beiträge in Rolf Hofmeier/Volker Matthies (Hg.), Vergessene Kriege in Afrika, Göttingen 1992.
[5] Vgl. Samuel Decalo, Psychoses of Power. African Personal Dictatorships, London 1989.
[6] Vgl. Volker Matthies, Äthiopien, Eritrea, Somalia, Djibouti. Das Horn von Afrika, München 1992; Gerard Prunier, Darfur – der „uneindeutige Genozid“, Hamburg 2007; Alexander de Waal, Famine that Kills – Darfur, Sudan, 2. Aufl. Oxford 2005 (1. Aufl. 1989); Robert D. Kaplan, Surrender or Starve. Travels in Ethiopia, Sudan, Somalia, and Eritrea, 2. Aufl. New York 2002 (1. Aufl. 1988).
[7] Vgl. zur aktuellen Kritik an der Entwicklungspolitik des Westens: William Easterley, The White Man’s Burden. Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, London 2006. Zur afrikanischen Kritik den „Klassiker“ von Axelle Kabou, Weder Arm noch ohnmächtig. Eine Streitschrift gegen schwarze Eliten und weisse Helfer, Basel 1995. Aktuell der prominenteste und provokanteste Kritiker ist der ugandische Journalist Andrew Mwenda, vgl. das Interview „Zivilcourage und politische Auseinandersetzung“, in: Entwicklung & Zusammenarbeit 50 (Dezember 2009), S. 452f. Große Aufmerksamkeit findet auch Mwendas Blog zu allgemeinen politischen Themen: <http://andrewmwendasblog.blogspot.com/> (letzte Überprüfung am 07.08.2013)
[8] Victoria Brittain, Death of Dignity. Angola’s Civil War, London 1998; Assis Malaquias, Angola – How to Lose a Guerilla War, in: Morton Bøås/Kevin C. Dunn (Hg.), African Guerillas – Raging Against the Machine, Boulder, CO 2007, S. 199–220; Alex Vines, RENAMO – Terrorism in Mozambique, London – Bloomington, IND 1991; Carolyn Nordstrom, Leben mit dem Krieg. Menschen, Gewalt und Geschäfte jenseits der Front, Frankfurt am Main 2005.
[9] Zu Somalia vgl.: Ioan M. Lewis, Making and Breaking States in the Horn of Africa: the Somali Experience, Trenton, NJ 2008. Zur Debatte um den politischen und ökonomischen Wiederaufbau in Mosambik vgl.: Bernhard Weimer, Demokratisierung, Staat und Verwaltung in Mosambik, in: Afrika Spectrum 35 (2000), S. 5–29; Jeremy M. Weinstein, Mozambique: A Fading U.N. Success Story, in: Journal of Democracy 13 (2002), S. 141–156.
[10] Zu Tansania vgl.: Elke Grawert, Departures from Post-Colonial Authoritarianism. Analysis of a System Change with a Focus on Tanzania, Frankfurt am Main 2009. Zu den Konflikten im Kongo, in Ruanda und in Burundi vgl.: Gerard Prunier, Africa’s World War. Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe, Oxford 2009. Zum Völkermord in Ruanda vgl. die deutschsprachigen Monographien: Leonhard Harding, Ruanda – der Weg zum Völkermord. Vorgeschichte – Verlauf – Deutung, Münster/Hamburg 1998; Alison des Forges, Kein Zeuge darf überleben. Der Genozid in Ruanda, Hamburg 2002 (1. engl. Aufl. 1999).
[11] Zu einer Debatte der jüngsten Wahlen in Ghana vgl.: Heinz Jockers/Dirk Kohnert/Paul Nugent, The Successful Ghana Election of 2008: A Convenient Myth?, in: Journal of Modern African Studies 48 (2010), S. 95–115. Zum Senegal vgl.: Linda J. Beck, Brokering Democracy in Africa: The Rise of the Clientelist Democracy in Senegal, New York 2008. Starke Bezüge zum Senegal hat auch ein Standardwerk zu politischen Systemen im nachkolonialen Afrika: Jean-François Bayart, L’Etat en Afrique: la politique du ventre, Paris 1989 (engl.: The State in Africa: The Politics of the Belly, London 1996).
[12] Zu Botswana vgl.: James Clark Leith, Why Botswana Prospered, Montreal 2005; Kenneth Good, Diamonds, Dispossession and Democracy in Botswana, Rochester, NY 2008. Zu Angola vgl.: Tony Hodges, Angola: From Afro-Stalinism to Petro-Diamond Capitalism, Bloomington, IND 2001. Zum Sudan vgl.: Ruth Iyob/Gilbert M. Khadiagala, Sudan: The Elusive Quest for Peace, Boulder, CO 2006; Ina Richter, Öl – Sudans Fluch und Segen. Strategien zur Konfliktlösung im Erdölförderland Sudan, Marburg 2008.
[13] Christoph Marx, Gedenken, Geschichte und Versöhnung in Südafrika und Zimbabwe, in: Afrika Spectrum 41 (2006), S. 155–174. Aus der sehr umfangreichen Literatur zu Südafrika: Albrecht Hagemann, Kleine Geschichte Südafrikas, 3. Aufl. München 2007 (1. Aufl. 2001); Neville Alexander, Südafrika: Der Weg von der Apartheid zur Demokratie, München 2001. Zu Simbabwe vgl. den Erfahrungsbericht: Michael Auret, From Liberator to Dictator. An Insider’s Account of Robert Mugabe’s Descent into Tyranny, Claremont (Südafrika) 2009.
[14] Der Begriff der Tradition, seine Bedeutung und seine historische Wirkungsmacht, hat lange im Zentrum afrikawissenschaftlicher Debatten gestanden, ausgehend von dem Aufsatz: Terence Ranger, The Invention of Tradition in Colonial Africa, in: Eric Hobsbawm/Terence Ranger (Hg.), The Invention of Tradition, 13. Aufl. Cambridge 2005 (1. Aufl. 1983). Eine sehr gute deutschsprachige Zusammenfassung von Rangers Positionen dieser Zeit ist: Terence Ranger, Kolonialismus in Ost- und Zentralafrika. Von der traditionellen zur traditionalen Gesellschaft – Einsprüche und Widersprüche, in: Jan-Heeren Grevemeyer (Hg.), Traditionale Gesellschaften und europäischer Kolonialismus, Frankfurt am Main 1981, S. 16–46. Zehn Jahre später hat Ranger die Debatte zusammengefasst und seine Vorstellungen präzisiert: Terence Ranger, The Invention of Tradition Revisited. The Case of Colonial Africa, in: Ders./Olufemi Vaughan (Hg.), Legitimacy and the State in Twentieth-Century Africa. Essays in Honour of A.H.M. Kirk-Greene, Basingstoke 1993, S. 62–111.
[15] Terence Ranger, Revolt in Southern Rhodesia, 1896–7, London 1967; D.N. Beach, ‘Chimurenga’: The Shona Rising of 1896-97, in: Journal of African History 20 (1979), S. 395–420.
[16] Robert B. Edgerton, The Fall of the Asante Empire: The Hundred-Year War for Africa’s Gold Coast, New York 1995; David Killingray, Colonial Warfare in West Africa, 1870–1914, in: J.A. de Moor/H.L. Wesseling (Hg.), Imperialism and War. Essays on Colonial Wars in Asia and Africa, Leiden 1989, S. 146–167, insbes. S. 158–167. Das Königreich Ashanti wurde erst 1896, nach vier sogenannten Ashanti-Kriegen von den Briten erobert, doch noch 1900 gab es Widerstand gegen die koloniale Eroberung, vgl.: A. Adu Boahen, Yaa Asantewaa and the Asante–British War of 1900–01, Accra/Oxford 2003.
[17] Zu den Anfängen der britischen Kolonialherrschaft in Kenia vgl.: John Lonsdale, The Conquest State of Kenya, in: de Moor/Wesseling (Hg.), Imperialism and War, S. 87–120.
[18] Michael Pesek, Koloniale Herrschaft in Deutsch-Ostafrika. Expeditionen, Militär und Verwaltung, Frankfurt am Main 2005, insbes. S. 179–185.
[19] Vgl.: Myron Echenberg, Colonial Conscripts. The Tirailleurs Sénégalais in French West Africa, 1857–1960, Portsmouth, NH 1991; Anthony Clayton/David Killingray, Khaki and Blue. Military and Police in British Colonial Africa. Athens, OH 1989. Eine stark sozialhistorisch ausgerichtete Arbeit zur britischen Kolonialarmee in Ostafrika: Timothy Parsons, The African Rank-and-File. Social Implications of Colonial Military Service in the King’s African Rifles, 1902–1964, Portsmouth, NH 1999.
[20] Zu den Kolonialgrenzen vgl. den Sammelband: Paul Nugent/A.I. Asiwaju (Hg.), African Boundaries: Barriers, Conduits, and Opportunities, London 1996.
[21] Aus der sehr umfangreichen Literatur: Gesine Krüger, Kriegsbewältigung und Geschichtsbewußtsein. Realität, Deutung und Verarbeitung des deutschen Kolonialkriegs in Namibia 1904 bis 1907, Göttingen 1999; Jürgen Zimmerer/Joachim Zeller (Hg.), Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonialkrieg (1904-1908) in Namibia und seine Folgen, Berlin 2003; Andreas Heinrich Bühler, Der Namaaufstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Namibia 1904–1913, Frankfurt am Main 2003.
[22] Vgl.: Felicitas Becker/Jigal Beez (Hg.), Der Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika, 1905–1907, Berlin 2005; Jigal Beez, Geschosse zu Wassertropfen. Sozio-religiöse Aspekte des Maji-Maji-Krieges in Deutsch-Ostafrika (1905–1907), Köln 2003.
[23] Vgl.: Joe A.D. Alie, A New History of Sierra Leone. Basingstoke 1990, S. 133–149; Arthur Abraham, Bai Bureh, The British, and the Hut Tax War, in: The International Journal of African Historical Studies 7 (1974), S. 99–106.
[24] Vgl. einen der „Gründungstexte“ der modernen Afrika-Geschichtsschreibung: George Shepperson/Thomas Price, Independent African. John Chilembwe and the Origins, Setting and Significance of the Nyasaland Native Rising of 1915, Edinburgh 1987 (1. Aufl. 1958); Alice Petersen, Livingstones schwarze Erben. Kolonialherrschaft und afrikanische Elite – das Beispiel Malawi, Unkel/Rh. 1990, S. 132–148.
[25] Vgl.: Catherine Coquery-Vidrovitch mit Odile Goerg, L’Afrique occidentale au temps des français. Colonisateurs et colonisés, c. 1860–1960, Paris 1992, S. 289–304; Jean Noël Loucou, Côte d’Ivoire: Les résistances à la conquête coloniale, Abidjan 2007.
[26] Vgl. Anthony H.M. Kirk-Greene, Britain’s Imperial Administrators, 1858–1966, Basingstoke 2000, insbes. S. 128–163. Siehe auch Studien zur deutschen Kolonialherrschaft: Bettina Zurstrassen, „Ein Stück deutscher Erde schaffen“: Koloniale Beamte in Togo 1884–1914. Pesek, Koloniale Herrschaft in Deutsch-Ostafrika, insbes. S. 266–299.
[27] Mahmood Mamdani, Citizen and Subject. Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism, Princeton, NJ 1996.
[28] Erster bekannter Vertreter dieser Schicht war der aus dem Senegal stammende Blaise Diagne, der 1914 als Abgeordneter der „Vier Gemeinden“ Senegals in die französische Nationalversammlung gewählt wurde. In der nachfolgenden Generation waren Léopold Sédar Senghor (der erste Präsident des Senegal) und Félix Houphouët-Boigny (der erste Präsident der Elfenbeinküste) ihre berühmtesten Vertreter, vgl.: James E. Genova, Colonial Ambivalence, Cultural Authenticity, and the Limitations of Mimicry in French Ruled West Africa, 1914–1956, New York 2004.
[29] Die Weigerung Steuern zu zahlen, war eine weit verbreitete Form des in der Regel unbewaffneten, deswegen aber kaum passiven Widerstands von AfrikanerInnen während der Kolonialzeit. Zu allgemeinen Formen bäuerlichen Widerstands vgl.: James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven/London 1985.
[30] Vgl.: Wolfgang Döpcke, Das koloniale Zimbabwe in der Krise. Eine Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1929–1939, Münster/Hamburg 1992, insbes. S. 211–244; Bruce Berman/John Lonsdale, Crisis of Accumulation, Coercion and the Colonial State. The Development of the Labor Control System in Kenya, 1919–1929, in: Canadian Journal of African Studies 14 (1980), S. 55–81. Ein frühes Standardwerk zu dieser Thematik: Charles van Onselen, Chibaro: African Mine Labour in Southern Rhodesia, 1900–1933, London 1976.
[31] Vgl.: Catherine Coquery-Vidrovitch, Les Africaines. Histoire des femmes d’Afrique noire du XIXe au XXe siècle, Paris 1994 (engl.: African Women. A Modern History, Boulder, CO 1997); Jean Allman/Susan Geiger/Nakanyike Musisi (Hg.), Women in African Colonial Histories. Bloomington, IND 2002; Elizabeth Schmidt, Peasants, Traders, and Wives. Shona Women in the History of Zimbabwe, 1870-1939, Portsmouth, NH 1992; Jean Allman/Victoria Tashijian, „I will not eat stone.“ A Women’s History of Colonial Asante, Portsmouth, NH 2000.
[32] Eine gute Zusammenfassung zu den diversen Formen kolonialer Zwangsarbeit bietet Mamdani, Citizen and Subject, S. 148–165.
[33] In diesem Zusammenhang steht auch der – letztlich gescheiterte – Versuch der französischen Regierung im Februar 2005 per Gesetz die positiven Auswirkungen des französischen Kolonialismus im Schulunterricht und in den Schulbüchern festzuschreiben, vgl.: Medard Ritzenhofen, Schattenbeschwörung und Schönfärberei. Koloniales Erbe und historische Wahrheiten, in: Dokumente/Documents. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog 2/2006, S. 54–59.
[34] Vgl.: Megan Vaughan, Curing their Ills. Colonial Power and African Illness, Stanford CA 1991; Wolfgang U. Eckart, Medizin und Kolonialimperialismus, Paderborn 1997; William Beinart/Lotte Hughes, Environment and Empire, Oxford 2007; Edward I. Steinhart, Black Poachers, White Hunters: A Social History of Hunting in Colonial Kenya, Oxford 2006.
[35] Vgl.: Killingray, Colonial Warfare in West Africa, insbes. S. 146–158; Kirsten Zirkel, Military Power in German Colonial Policy: The Schutztruppen and Their Leaders in East and South-West Africa, 1888-1918, in: David Killingray/David Omissi (Hg.), Guardians of Empire. The Armed Forces of the Colonial Powers c. 1700–1964, Manchester/New York 1999, S. 91–113. Zum Begriff „warbands“ vgl.: Donald A. Low, Warbands, and Ground-Level Imperialism in Uganda, 1870-1900, in: Historical Studies (Melbourne) 16 (1975), S. 584–597.
[36] Vgl.: Albert Wirz, Körper, Raum und Zeit der Herrschaft, in: Ders./Andreas Eckert/Katrin Bromber (Hg.), Alles unter Kontrolle. Disziplinierungsprozesse im kolonialen Tansania (1850–1950), Köln 2003, S. 5–34; Trutz von Trotha, „One for the Kaiser“. Beobachtungen zur politischen Soziologie der Prügelstrafe am Beispiel des „Schutzgebietes Togo“, in: Peter Heine/Ullrich van der Heyden (Hg.), Studien zur Geschichte des deutschen Kolonialismus in Afrika. Festschrift zum 60. Geburtstag von Peter Sebald, Pfaffenweiler 1995, S. 521–555.
[37] Ein Beispiel aus der deutschen Kolonialgeschichte ist Carl Peters, der nicht nur mittels sogenannter Schutzverträge entscheidenden Anteil an der Eroberung der deutschen Kolonien in Ostafrika hatte, sondern auch durch willkürliche und brutale Gewalt bekannt wurde. Im Kaiserreich „in Unehren entlassen“ und in den 1920er und 1930er Jahren von Deutsch-Nationalen und Nationalsozialisten zum Kolonialhelden erhoben, sorgte er noch bis in die Gegenwart für kontroverse Diskussionen, vgl.: Winfried Speitkamp, Deutsche Kolonialgeschichte, Stuttgart 2005, S. 138f.; Uwe Wieben, Carl Peters. Das Leben eines deutschen Kolonialisten, Rostock 2000; Arne Perras, Carl Peters and German Imperialism, 1856–1918: A Political Biography, Oxford 2004.
[38] Nach Ende seiner Dienstzeit in den britischen Kolonien schrieb Lugard ein Buch, das eine Art Handbuch für die britische Kolonialverwaltung wurde: Frederick D. Lord Lugard, The Dual Mandate in Tropical Africa, London 1922.
[39] Vgl.: Andreas Eckert, Herrschen und Verwalten. Afrikanische Bürokraten, staatliche Ordnung und Politik in Tanzania, 1920–1970, München 2007, insbes. S. 39–62 und 80–95; Sara Berry, Chiefs Know Their Boundaries: Essays on Property, Power and the Past in Asante, 1896–1996, Portsmouth, NH 2001. Vgl. auch sehr frühe Standardtexte: Michael Crowder/Obaro Ikime (Hg.), West African Chiefs. Their Changing Status under Colonial Rule in West Africa, New York 1970; Lloyd A. Fallers, The Predicament of the Modern African Chief. An Instance from Uganda; in: American Anthropologist 57, 1955, S. 290-305. Abgesehen von den Chiefs gab eine Vielzahl weiterer Afrikaner (selten Afrikanerinnen), die für den Kolonialstaat arbeiteten, vgl.: Benjamin N. Lawrance/Emily Lynn Osborn/Richard L. Roberts (Hg.), Intermediaries, Intepreters and Clerks. African Employees in the Making of Colonial Africa, Madison, WI 2006.
[40] Vgl.: John Iliffe, A Modern History of Tanganyika, Cambridge 1979, S. 325–334.
[41] Mamdani, Citizen and Subject, S. 37–61.
[42] Vgl.: Kristin Mann/Richard Roberts (Hg.), Law in Colonial Africa, Portsmouth NH/London 1991. Martin Chanock, Law, Custom and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia, Cambridge 1985.
[43] Aus der sehr umfangreichen Forschungsliteratur zu Fragen der (politischen bzw. politisierten) Ethnizität in Afrika möchte ich hier nur die meines Erachtens beste deutschsprachige Zusammenfassung zitieren; Carola Lentz, „Tribalismus“ und Ethnizität in Afrika – ein Forschungsüberblick, in: Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft 23 (1995), S. 115–145. Wesentlich kürzer, aber ein guter Text zur Einführung: John Lonsdale, Staatsgewalt und moralische Ordnung. Die Erfindung des Tribalismus in Afrika, in: Der Überblick 29 (2003) H. 3, S. 5–10.
[44] Le Monde, 4. September 2004. Ins Englische übersetzt von Sally Price, Silences in the Museum. Reflections on the European Exotic, in: Historische Anthropologie 18 (2010) H. 2, S. 176-190: „The tragedy of Africa is that the African has not sufficiently taken part in History. For centuries the African peasant has been living according to the seasons, trying only to remain in harmony with nature, and knowing only the eternal cycle of time, and the endless rhythmic repetition of the same actions and the same words. In such an imaginaire where everything repeats itself without end, there is no possibility for engaging in the human adventure, and no place for human progress.“
[45] Zur vorkolonialen Geschichte Afrikas, besonders zur Geschichte des 19. Jahrhunderts vgl.: Marx, Geschichte Afrikas, S. 19–86. Außerdem den Abschnitt „Regionale Vielfalt im 19. Jahrhundert“ in: Iliffe, Geschichte Afrikas, S. 214-250.
[46] Vgl. zur Definition der Shona-Sprache in Simbabwe: Herbert Chimhundu, Early Missionaries and the Ethnolinguistic Factor during the ‚Invention of Tribalism’ in Zimbabwe, in: Journal of African History 33 (1992), S. 87–109.
[47] Iliffe, Modern History of Tanganyika, S. 324.
[48] Vgl.: Ranger, Invention of Tradition Revisited, insbes. S. 75–82; Steven Feierman, Peasant Intellectuals. Anthropology and History in Tanzania, Madison, WI 1990, insbes. S. 3–9 und S. 134–145.
[49] Vgl.: John Lonsdale, The Moral Economy of Mau Mau: Wealth, Poverty & Civic Virtue in Kikuyu Political Thought, in: Bruce Berman/John Lonsdale (Hg.), Unhappy Valley. Conflict in Kenya and Africa, Vol. 2: Violence and Ethnicity, London 1992, S. 315–504.
[50] Vgl. die Beiträge in: Bruce Berman/Dickson Eyoh/Will Kimlicka (Hg.), Ethnicity & Democracy in Africa, Oxford/Athens, OH 2004. Ein früher, aber sehr guter allgemeiner Einführungstext: Robert H. Bates, Ethnic Competition and Modernization in Contemporary Africa, in: Comparative Political Studies 6 (1974), S. 457–484.
[51] Das waren der Northern Peoples Congress, die Action Group und der National Council of Nigeria and the Cameroons, vgl.: Toyin Falola/Matthew Heaton, A History of Nigeria, Cambridge 2008, S. 136–157.
[52] Vgl. eine aktuelle Debatte über die TANU und ihre Geschichte: James L. Giblin/Gregory H. Maddox (Hg.), In Search of a Nation. Histories of Authority and Dissidence in Tanzania, Athens, OH 2006.
[53] Aus der ebenfalls sehr umfangeichen Literatur hierzu zwei Hinweise: Patrick Chabal/Jean-Pascal Daloz, Africa Works. Disorder as Political Instrument, Oxford/Bloomington IND 1999; William Reno, Warlord Politics and African States, Boulder, CO 1998.
[54] Als Überblick geeignet: Frederick Cooper, Africa Since 1940. The Past of the Present, Cambridge 2002; Anna-Maria Brandstetter/Dieter Neubert (Hg.), Postkoloniale Transformation in Afrika. Zur Neubestimmung der Soziologie der Dekolonisation, Hamburg 2002.
Zitation
Frank Schubert, Das Erbe des Kolonialismus – oder: warum es in Afrika keine Nationen gibt, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/das-erbe-des-kolonialismus-oder-warum-es-afrika-keine-nationen-gibt