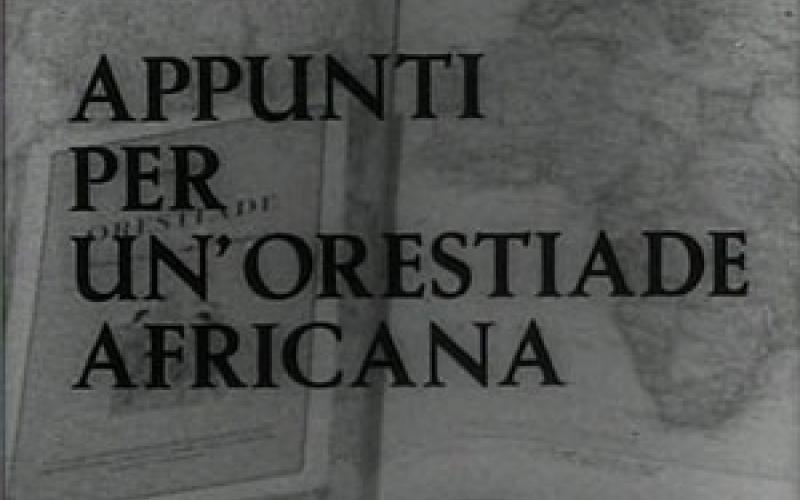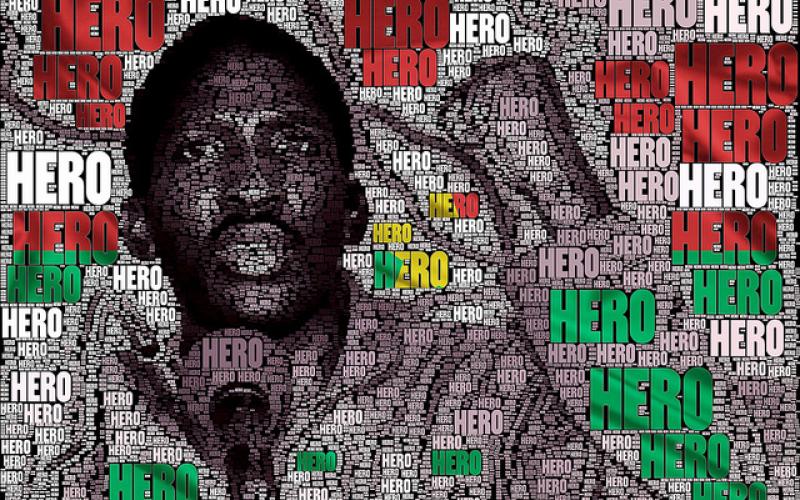1. Prolog
Unter dem Banner des Erhalts von Biodiversität wird seit Jahrzehnten eine öffentliche Debatte geführt, in der weitgehend Einmütigkeit darüber besteht, daß der Erhalt der botanischen und zoologischen Vielfalt schon allein aufgrund des noch weitgehend unerforschten Potentials der sich darin manifestierenden genetischen Ressourcen eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben der Menschheit ist. Erstaunlicherweise hat es die parallele Debatte über den Erhalt von kultureller und sprachlicher Diversität der Menschheit schwer, eine vergleichbare Öffentlichkeit zu erreichen, obwohl der Kern der Debatte ebenfalls die noch weitgehend unerforschten Potentiale indigener Wissens- und Wertesysteme für die gesamte Menschheit sind, die sich in linguistischer Vielfalt manifestieren und die im Zuge von sich kontinuierlich verstärkenden Globalisierungstendenzen in ständig steigendem Maße von Assimilation und Annihilierung bedroht sind. Es geht aber auch um den drohenden Verlust des Erkennens und Verstehens spezifisch menschlicher intellektueller und kultureller Leistungen, die sich allein über eine wissenschaftliche Analyse der in den Sprachen der Welt genutzten linguistischen Enkodierungsstrategien erschließen lassen. Philosophisch und evolutionshistorisch extrem bedauerlich ist dabei, daß angesichts der Tatsache, daß Sprache als solche das evolutionsgeschichtlich wohl bemerkenswerteste biologische Spezifikum der Menschwerdung darstellt, dieses Faktum wenig dazu beiträgt, eine breite Diskussion oder gar verstärkte Forschungsförderung zu initiieren – von wenigen Ausnahmen abgesehen, so die relativ rezenten Programme zur Dokumentation bedrohter Sprachen (z. B. bei der Volkswagen-Stiftung und der Hans Rausing Foundation). Zu nennen ist hier auch die Einrichtung eines Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig mit einer starken Abteilung für Linguistik.
Kaum aufgegriffen wird auch die noch wenig erklärte Korrelation zwischen Biodiversität und Sprachenvielfalt, bezogen auf dieselben geographischen Räume, nämlich die zu beobachtende Tatsache, daß dort, wo in hohem Maße Biodiversität anzutreffen ist, in der Regel auch eine hohe Diversität hinsichtlich sprachlicher und kultureller Varianz auszumachen ist.[1] Der geschilderte weltweite Befund gilt in verstärktem Maße für Afrika, den Mutterkontinent der Menschheit und deren linguistischer Diversität.[2] Von den ca. 6.000 heute noch gesprochenen Sprachen finden wir gut ein Drittel, nämlich 2.000 oder mehr Sprachen, auf dem afrikanischen Kontinent. Diese indigenen afrikanischen Sprachen sind das vorrangige und zumeist auch ausschließliche Kommunikationsmedium der dort lebenden mehr als 600 Millionen Menschen, allen postkolonialen politisch-ideologischen Vernebelungen zum Trotz, die sich hinter Schlagwörtern wie „Frankophonie“, „Anglophonie“, und „Lusophonie“ verbergen.[3] Damit stellt sich zugleich die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Ausmaß die „Sprachenfrage“ als möglicherweise lang übersehener oder gar bewußt negierter Faktor eine entscheidende Rolle für „Entwicklung“ bzw. Zementierung von „Unterentwicklung“ in Afrika spielt. Mit dem vorliegenden Essay wird der Versuch unternommen nachzuweisen, daß und warum durchaus gut gemeinte Strategien, Englisch, Französisch, Portugiesisch etc. als „nationale Einheitssprachen“ mit dem Ziel der Förderung „nationaler Entwicklung“ in Afrika einzusetzen, in ihr Gegenteil umschlagen, nämlich Unterentwicklung und Massenarmut eher zementieren als zu beseitigen helfen.
Faktum ist, daß SPRACHE ein entscheidender Faktor beim Aufbau effizienter Bildungssysteme und demokratischer Strukturen ist, die einer Mehrheit der Bevölkerung in Afrika die politische Teilhabe und Mitsprache (im wahrsten Sinne des Wortes) in allen Angelegenheiten von lokaler, regionaler und nationaler Bedeutung garantieren können – oder, im Gegenteil, genau dieses verwehren. Faktum ist auch, daß SPRACHE fundamentale Menschenrechte berührt, denn SPRACHE ist die Basis für die kognitive, kulturelle und soziale Selbstverwirklichung des Einzelnen und für die Herausbildung und den Erhalt der Identität von sozialen und kulturellen Gruppen. Verwehrt man zumal jungen Menschen den Gebrauch ihrer Sprache, beschneidet man ihr individuelles, kulturelles, soziales, politisches und ökonomisches Entwicklungspotential mit dem Ergebnis massenhafter Mediokrität und Neo-Apartheid.[4]
Das Schicksal Afrikas und seiner Menschen wird mitbestimmt von Rolle und Funktionen, die den indigenen afrikanischen Sprachen in Rivalität und Konflikt mit importierten Fremdsprachen und in Reaktion auf die sich seit der Kolonialisierung verstärkenden Globalisierungstendenzen, mit einer zu erwartenden weiteren Dynamisierung im 21. Jahrhundert, zugebilligt wird, d. h. von der Angemessenheit von Strategien zur Lösung der SPRACHENFRAGE IN AFRIKA. Um so überraschender ist, daß im entwicklungstheoretischen mainstream-Diskurs der Welt- und Entwicklungsökonomen, Politologen und Konfliktforscher, Soziologen, aber auch Pädagogen oder Ethnologen, diese Frage weitgehend verwaist ist. Es bleiben die „klassischen“ Afrikanisten zumal der deutschsprachigen akademischen Tradition, die sich ganz ähnlichen Problemen schon einmal, allerdings im Dienste der deutschen Kolonialadministration, zugewandt und diese Tatsache lange erfolgreich verdrängt hatten. Kaum beachtet im nationalen entwicklungspolitischen Diskurs, umso deutlicher wahrgenommen im innerafrikanischen Diskurs, hat sich gleichsam aus der erkalteten Asche der kolonialen Vergangenheit der Phönix einer modernen und praxisorientierten „angewandten afrikanistischen Soziolinguistik“ erhoben: zunächst in der Folge der Unabhängigkeit vieler afrikanischer Staaten ab 1960 und unter hochgradig ideologisierten Vorzeichen in der ehemaligen DDR (konzentriert am Standort Leipzig, wo 1960 die „Afrikanistik“ nach dem Bruch von 1936 quasi neu begründet wurde und eine bis 1895 zurückreichende Tradition wieder aufnahm), später auch in der alten Bundesrepublik in der Folge ebenso ideologisch motivierter Kapitalismus- und Kolonialismuskritik durch „Jungafrikanisten“ im politischen Umfeld der Studentenunruhen um 1968/69, die nebenbei in die ursprünglich als gesellschaftspolitische Alternative konzipierte Gründung der bis heute fortbestehenden „Vereinigung von Afrikanisten in Deutschland (VAD)“ mündete. Die Angewandte Afrikanistische Soziolinguistik ist Teil einer sich multidisziplinär verstehenden Afrikanistik, wie sie bereits seit gut 100 Jahren in Deutschland akademisch beheimatet ist. Sie thematisiert die hochgradige Komplexität der SPRACHENFRAGE IN AFRIKA in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und verbindet diese mit wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen, Methoden und Theorien zur Analyse, Beschreibung, Vergleich und Standardisierung der mehr als 2 000 afrikanischen Sprachen.
2. Einleitung
Irgend etwas muß nachhaltig falsch sein an den bisherigen Konzepten der sogenannten Ersten Welt, die Unterentwicklung in der sogenannten Dritten Welt, hier insbesondere in Afrika, verringern, wenn nicht gar beseitigen zu helfen. Der weitverbreitete „Afrika-Pessimismus“ findet sich auch in einem Memorandum zur deutschen Afrikapolitik, im Jahre 2000 verfaßt von deutschen Afrikawissenschaftlern, nämlich in der Voraussage, daß „Entwicklung im Sinne nachhaltiger Armutsreduzierung ... für die meisten Länder Afrikas auch in den nächsten 30 bis 50 Jahren nicht möglich sein“ wird.[5] Eine dagegen gesetzte optimistische Einstellung geht davon aus, daß es konkrete Strategien und Potentiale in Afrika gibt, mit denen die Unterentwicklung aus eigener Kraft auf der Basis bislang ungenutzter indigener Ressourcen zu überwinden ist. Eine dieser Strategien soll in diesem Essay vorgestellt werden. Der Autor wird darlegen, daß die bisherige Diskussion über die Gründe der afrikanischen Unterentwicklung – und damit auch die Strategiediskussion zu deren Überwindung – ein wesentliches thematisches Defizit aufweist, das auf Fehlwahrnehmungen und Vorurteilen beruht, deren Wurzeln bis in die von zumindest unterschwelligem Rassismus nicht freie Epoche des Kolonialismus zurückreichen. Dies verbindet sich mit dem Vorwurf von Neokolonialismus und Kulturimperialismus, der in Afrika von oppositionellen Intellektuellen schon bald nach der Unabhängigkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erhoben wurde. Die als Neokolonialismus und Kulturimperialismus gegenüber Afrika wahrgenommenen Attitüden betreffen nicht nur Vertreter der ehemaligen Kolonialmächte, der Weltbank und internationalen „Gebergemeinschaft“ etc., sondern werden durch viele Entscheidungsträger und Multiplikatoren in Afrika selbst befördert. Dieser Essay macht dies an den formalen Bildungssystemen in Afrika und den Grundannahmen der dahinter liegenden Bildungspolitik fest. Diese muß sich dem Vorwurf aussetzen lassen, jahrzehntelang falschen politischen Zielen gefolgt zu sein und den Kontinent bildungs- und damit entwicklungspolitisch nicht nur in die Krise, sondern nachgerade in eine weitere Katastrophe geführt und damit möglicherweise Unterentwicklung und Massenarmut zementiert zu haben.
Erst in jüngster Zeit setzt sich eine Sichtweise durch, und dies auch längst nicht in allen internationalen Expertenzirkeln und afrikanischen Führungsetagen, sondern eher unter aufgeklärten Linguisten und Sprachsoziologen insbesondere in Afrika selbst, die die Hoffnung birgt, eine der wesentlichen Ursachen der Unterentwicklung und Massenarmut in Afrika identifizieren und beseitigen zu können. Dies wäre mit einer drastischen Transformation bzw. Neubegründung der formalen Bildungssysteme verbunden. Diese Hoffnung gründet auf der Analyse der sogenannten Sprachenfrage in Afrika, und so wird sich dieser Essay denn auch ausführlich mit verschiedenen Aspekten dessen beschäftigen, was wir die Sprachenfrage in Afrika nennen und wie diese mit den dramatischen Defiziten der bestehenden Bildungssysteme und deren Auswirkungen auf Unterentwicklung und Massenarmut zusammenhängt.
Kommen wir zu den Gründen für die zu beklagenden Fehlwahrnehmungen, auf denen die monierten Fehlentscheidungen der Vergangenheit beruhen: Wie schon zur Kolonialzeit die Kolonialverwaltungen, sind auch heute die am Entwicklungsdiskurs Beteiligten zumeist davon überzeugt, daß im Prinzip in Afrika das beste aller möglichen Bildungssysteme frühzeitig installiert wurde: nämlich im Wesentlichen das der (Ex-)Kolonialmacht selbst. Man hatte im kolonialen Mutterland ein gut funktionierendes System, das ganz natürlich auf einer einzigen Sprache, etwa Englisch oder Französisch, beruhte (nota bene: es handelt sich dabei ursprünglich um die gemeinsame Muttersprache aller Schüler). Dieses System wurde in zivilisatorischer Mission übertragen in eine völlig andere Kulturen- und Sprachenlandschaft. Die meisten Mitglieder der neuen Führungseliten in den afrikanischen Staaten folgten den Kolonialherren in der unkritischen Übernahme des kolonialen Bildungssystems, d. h. eines Systems, das allein oder zumindest weitestgehend auf der importierten Kolonialsprache basiert. Sie tun dies überzeugt, weil sie selbst in diesem System reüssiert haben, gemessen an ihren heutigen Positionen an den Schalthebeln der Macht.[6] Sie schließen von ihrer eigenen Erfolgsgeschichte auf deren Verallgemeinerbarkeit. Sie vergessen dabei die Statistik bezüglich der Hunderttausende, die die Schule abgebrochen oder gar nicht erst besucht haben, weil sie einer verfehlten Bildungspolitik zum Opfer und damit durch den Rost geltender Minimalanforderungen an eine erfolgreiche Mitwirkung in der postkolonialen Gesellschaft gefallen sind.
Es wird übersehen, daß in Afrika in der Regel Bildung mit Aussicht auf Erfolg nur im Rahmen eines multilingualen Ansatzes überhaupt Sinn hat, d. h. daß eine effektive schulische Bildung in einer den Schulanfängern bereits bekannten Sprache beginnen muß und allenfalls später, und dann auch nur in einer mit adäquaten Methoden zuvor eingeführten Fremdsprache, weitergeführt werden kann. Es ist – unter den vorherrschenden Bedingungen in Afrika – keinesfalls trivial, die Forderung aufzustellen, daß Schüler überhaupt erst einmal verstehen müssen, was Lehrer sagen. Lernen zu lernen in einer Sprache, die man gar nicht oder höchstens rudimentär beherrscht, ist praktisch unmöglich – jedenfalls für die meisten Kinder.[7]
Multilingualismus als Ausdruck von kultureller und ethnischer Pluralität einer „Nation“ (oder zumindest auf dem Territorium eines sich am „Nationalstaat“ orientierenden politischen Gemeinwesens) ist den meisten am Entwicklungsdiskurs Beteiligten ein Greuel. Zum einen glauben sie, und sie sind sich darin mit vielen Vertretern der jeweiligen afrikanischen Führungseliten einig, würde dies latente „tribale“ Konflikte schüren und damit dem Ziel der nationalen Einheit zuwider laufen.[8] Sie sehen Multilingualismus als Problem und die Lösung in einer scheinbar „neutralen“ Einheitssprache, die wie selbstverständlich die der ehemaligen Kolonialmacht ist und in der auch die old boys’ networks funktionieren. Diese Lösung scheint zugleich zu garantieren, daß die jungen Staaten Afrikas sprachlich (und kulturell) an die westliche Zivilisation assimiliert und an den Welthandel angeschlossen würden. Außer acht bleibt bei dieser nur scheinbar optimalen Lösung zweierlei, nämlich daß (a) die Idee von einer in dieser Hinsicht „neutralen“ Sprache ein Widerspruch in sich ist und der Gebrauch einer fremden Sprache, zumal wenn er von deren Sprechern einer anderen Gruppe verordnet wird, immer zugleich Ausdruck und Ausübung von Macht und Herrschaft ist, und (b) daß die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von den kommunikativen Bedürfnissen der Globalisierung unmittelbar gar nicht betroffen ist, sondern primär in lokalen ökonomischen und damit auch regionalsprachlichen Zusammenhängen aktiv ist. Zum anderen ist täglich praktizierter Multilingualismus nur ein Problem für jemanden, der, wie die meisten internationalen Entwicklungsexperten, aus nicht-afrikanischen Ländern stammt, in denen (funktionaler) Multilingualismus, insbesondere kindliche Mehrsprachigkeit, als soziales Defizit gesehen wird, das charakteristisch ist für marginalisierte Gruppen, wie z. B. Gastarbeiter, Einwanderer der ersten und zweiten Generation, „fahrendes Volk“, grenzüberschreitende Mischehen usw. Diese kulturell tief verwurzelten Vorurteile gegenüber alltäglicher Mehrsprachigkeit – es geht hier nicht um akademisch erworbene Mehrsprachigkeit über das offizielle Bildungssystem – verstellen vielen Experten aus den typisch monolingualen Geberländern Europas und den USA den Blick auf die Normalität von ethnischer, kultureller und sprachlicher Pluralität, wie sie seit Jahrhunderten in Afrika besteht. Sie sehen hierin Hindernisse, keine Chancen oder gar Ressourcen. Die Menschen in Afrika hingegen sehen in der Regel ihren Multilingualismus als „normal“ und äußerst funktional an – das Problem ist ein im Wesentlichen ideologisches und beginnt bei der Konzeption sprachpolitischer Optionen.[9]
Unter Entwicklungsexperten ist zudem eine wenig reflektierte Auffassung weit verbreitet, nach der Multilingualismus hinderlich für die Entwicklung moderner Staatswesen sei. Ein vermeintliches Axiom lautet demnach, daß linguistisch homogene Gesellschaften in der Regel ökonomisch entwickelter, bildungsmäßig fortschrittlicher, politisch moderner und ideologisch stabiler seien; in den Worten Pools: „… a country that is linguistically highly heterogeneous is always underdeveloped and a country that is developed always has considerable linguistic uniformity.“[10] Hier wird übersehen, daß nicht notwendig die linguistische Heterogenität als solche ursächlich ist, sondern viel eher die Tatsache, daß linguistisch heterogene Staaten es ihren Staatsbürgern zumeist versagen, vom Kindergarten bis zur Hochschule in der jeweiligen Erstsprache bzw. einer Sprache, die sie bei Bildungsbeginn bereits beherrschen, ausgebildet zu werden. In den sogenannten entwickelten Staaten ist aber genau dies der Fall. Joshua Fishman, der Vater der modernen Sprachsoziologie, muß in einer späteren und genaueren Analyse der Fakten einräumen, daß Mehrsprachigkeit sogar das ökonomische Potential z. B. in Indien und Afrika zu erhöhen geeignet ist.[11]
Wenn es um Sprachen geht, sind zunächst Sprachwissenschaftler gefragt. Wenn es um afrikanische Sprachen und die Rolle von Sprache allgemein in Afrika geht, ist eine besondere Spezies von Sprachwissenschaftlern gefragt, nämlich die klassischen Afrikanisten (Afrikalinguisten) mit ihrem transdisziplinären Ansatz, Sprache(n) und deren Beziehungen zu Kultur und Gesellschaft in Afrika zu erforschen. Nun gehören allerdings Linguisten und Sozialwissenschaftler, aber auch Erziehungswissenschaftler, in der Regel völlig unterschiedlichen Diskurszusammenhängen an, besuchen unterschiedliche Kongresse und publizieren in unterschiedlichen Organen. Es fehlt weitgehend der interdisziplinäre Dialog zwischen Sozialwissenschaften wie Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie auf der einen, und Sprach- und Kulturwissenschaften wie Afrikalinguistik und Ethnologie auf der anderen Seite, selbst der Dialog zwischen Linguisten und Ethnologen ist nicht problemlos.[12] Es geht darum, einander den komplementären Nutzen der jeweiligen methodischen und theoretischen Ansätze zu vermitteln und damit Fehlwahrnehmungen und Vorurteile hinsichtlich der komplexen Ursachen von Unterentwicklung in Afrika bewußt zu machen und zu überwinden. Dies gilt besonders für den Beitrag der Angewandten Afrikanistischen Soziolinguistik, die sich per definitionem als interdisziplinäre Sprachplus Gesellschaftswissenschaft verstehen muß.
3. Wissenschaftsgeschichtlicher Exkurs
Die institutionalisierte Erforschung der afrikanischen Sprachen beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts damit, daß sich das kaiserliche Deutschland durchaus nicht zum Vergnügen des Reichskanzlers Bismarck (aber für die anstehenden Wahlen möglicherweise entscheidend) in die Reihe der Kolonialmächte einzureihen mehr oder minder genötigt sah. Ohne die kolonialen und missionarischen Praxisanforderungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts hätte die „Afrikanistik“ als eigenständige akademische Disziplin im wissenschaftlichen Umfeld der etablierten „Orientalistik“ an den Universitäten zunächst in Berlin (ab 1887), dann in Leipzig (ab 1895) und später in Hamburg (ab 1909 bzw. 1919) nie das Licht der Welt erblickt. Protestantische Missionen in Afrika setzten in der Tradition Martin Luthers auf die Übersetzung der Bibel in die sogenannten Eingeborenensprachen. Dazu mußten die sogenannten Eingeborenen alphabetisiert werden. Die Alphabetisierung verlangte eine gründliche Erforschung der Einzelsprachen, die Übersetzungsproblematik eine ernsthafte und in zunehmendem Maße objektive Beschäftigung mit den traditionellen afrikanischen Kulturen, die in diesen Sprachen quasi verschlüsselt waren. Die Missionen waren die Vorhut der kolonialen Aneignung der überseeischen Territorien, verstärkt durch die ökonomischen Interessen deutscher Reedereien und Handelshäuser (nach dem Motto „Erst kommt der Missionar, dann der Konsul, dann die Armee“). In jedem Falle stellte sich die Frage der Kommunikation zwischen „Eingeborenen“ und Kolonialisten: Sollten die einen die Sprache der Kolonialherren erlernen mit dem Risiko, daß sie dann auch „Zeitungen mit vaterlandsloser und revolutionärer Gesinnung“ wie den sozialdemokratischen Vorwärts lesen könnten (wie anläßlich des Kolonialkongresses in Berlin im Jahre 1905 tatsächlich befürchtet wurde), oder sollte Deutsch die Sprache des kolonialen Herrenvolkes bleiben mit der Konsequenz, daß dann die Deutschen die „Negersprachen“ ihrer Domestiken und Arbeiter wenigstens rudimentär erlernen müßten? Es wurde sogar erwogen, eine stark vereinfachtes „Kolonialdeutsch“ zu erfinden, nicht zuletzt auch deshalb, weil, wie es in einer tatsächlich ernst gemeinten Auseinandersetzung über die Sprachenfrage in den Kolonien hieß, die Afrikaner mit ihrer „weichen Zunge“ prinzipiell Probleme mit den „harten Konsonanten“ der deutschen Sprache hätten![13] Da man sich uneinig blieb, ging jede Kolonie des Deutschen Reiches in Afrika ihren eigenen Weg. In Deutsch-Ostafrika beschritt man den endoglossischen Weg, d. h. man bediente sich einer einheimischen Sprache: des Kiswahili, was der weiteren regionalen und funktionalen Verbreitung dieser Sprache zu einer der bedeutendsten language of Inter-African communication durchaus zugute kam, auch wenn Bedenkenträger die sprachliche (durch beträchtliche lexikalische Anreicherung) und religiöse Nähe zum Arabischen (und damit auch zum Islam) dagegen ins Feld führten mit der Wirkung, daß durch Runderlaß (vom 7.2.1901 und 30.8.1902) der Gebrauch der arabischen Schrift für das Kiswahili zugunsten der lateinischen Schrift verboten wurde.[14] In Deutsch-Südwestafrika setzte sich das Deutsche auch bei Teilen der einheimischen Bevölkerung durch, in Kamerun blieb die Sache bis zum Ende der deutschen Kolonialherrschaft praktisch unentschieden. In Togo bot sich das Ewe als indigene Lösung an, in die sprachpolitisch beträchtlich investiert wurde. Allgemein galt jedoch, daß außerhalb Ostafrikas, wo das Kiswahili als präkoloniale Verkehrssprache bereits etabliert war, vor allem in weiterführenden Schulen überwiegend Deutsch als Unterrichtssprache eingesetzt wurde.
Die Sprachenfrage bestimmte also von Beginn an die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Afrika. Die Soziolinguistik und die Sprachsoziologie waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht erfunden, und doch waren soziolinguistische Fragestellungen schon früh an der afrikanistischen Tagesordnung: Welches war die geeignete Sprachpolitik für die Kolonien? Wie ließen sich die indigenen Sprachen modernisieren für den Einsatz in der formalen Erziehung? Was waren die Ursachen für die Entstehung, Funktionen und Dynamik der großen afrikanischen Verkehrssprachen? Was waren die soziokulturellen Bedingungen von Sprach- und Kulturwandel, Mehrsprachigkeit und Sprachmischung? Die Beschäftigung mit der „Sprachenfrage in Afrika“ ist demnach so alt wie die Afrikanistik selbst.
4. Die Sprachenfrage in Afrika
Der Begriff Sprachenfrage bedeutet in der Praxis fast immer „Sprachenproblem“ oder „Sprachenkonflikt“ im Sinne von Herrschaft und Kontrolle. Eine Sprachenfrage entsteht, wenn es Sprachenprobleme oder -konflikte gibt, die nach einer Lösung verlangen. In diesem Sinne gibt es kaum einen Staat auf dieser Welt, der nicht mit einer Sprachenfrage konfrontiert wäre. Wenn ein Staat in seinen Grenzen nur eine einzige Sprache aufweist – dies gilt für die wenigsten Staaten der Welt – können dennoch soziale Probleme und Konflikte aufbrechen, die mit den regionalen Varietäten der Sprache (Dialekte) zusammenhängen, oder die sich auf soziale Varietäten (Soziolekte) innerhalb der Sprache beziehen – in jedem Falle also auf die unvermeidbare Tatsache, daß sich Sprecher durch signifikante Abweichungen (ggf. von einer als Norm akzeptierten und standardisierten Hochsprache) regional oder sozial verorten lassen und damit z. B. Opfer von Diskriminierungen jeglicher Art werden können.[15] In Afrika sind die wenigen sprachlich eher homogenen Staaten kaum vom Elend interner Wirren und Bürgerkriege verschont geblieben: Beispiele sind Somalia (Sprache: Somali, die den sich bekriegenden Clans der verschiedenen Warlords gemeinsam ist) und Rwanda (Sprache: Kinyarwanda, die den verfeindeten Gruppen der Tutsi und Hutu gemeinsam ist).[16]
Ist ein Staat von Anfang an durch das Nebeneinander mehrerer Sprachgemeinschaften auf seinem Territorium charakterisiert, tritt die Sprachenfrage sogleich in einer verschärften Form auf. Es entsteht Handlungsbedarf nicht nur im Erziehungssystem, sondern es betrifft die Formulierung einer offiziellen Sprachen- und Minderheitenpolitik, gegebenenfalls zur Regelung von kultureller Autonomie von anerkannten sprachlichen Minderheiten. Regelungsbedarf besteht in allen Fragen der offiziellen Kommunikation, bis hin zur Notwendigkeit von Übersetzungen und Dolmetschereinsatz bei allen öffentlichen Debatten im Parlament, der Veröffentlichung von Gesetzestexten und Verordnungen, der Einstellungsvoraussetzungen für Staatsdiener und Funktionsträger. In Afrika tritt die Sprachenfrage in verschärfter Form auf. Die überwiegende Zahl der Staaten in Afrika, vor allem südlich der Sahara, ist in höchstem Maße multilingual. Im rechnerischen Mittel verteilen sich auf jeden Staat in Afrika ca. 40 Sprachen, teilweise so verschieden wie Deutsch, Türkisch, Arabisch und Chinesisch. Die Bandbreite reicht von seltenen Fällen von überwiegendem Monolingualismus in Ländern wie Botswana, Burundi, Lesotho, Madagaskar, Rwanda, Somalia und Swaziland bis zu Sprachgiganten wie Nigeria mit mehr als 400 verschiedenen Sprachen.
Nicht genug damit: Durch die religiöse Expansion von Islam und Christentum, vor allem aber durch die Entdeckungs- und Kolonialgeschichte, wurden weitere Sprachen nach Afrika importiert mit teilweise herausragender Verbreitung über mehrere der heutigen Staaten hinweg, wie Arabisch, Englisch, Französisch, Spanisch, aber auch Italienisch, Deutsch, Niederländisch und Flämisch, Griechisch, Urdu, Hindi, Gujerati, Malaiisch usw., bis hin zur Herausbildung eigenständiger afrikanischer Varietäten europäischer Sprachen, wie dem Afrikaans oder den afrikanischen Varietäten des Englischen und Französischen, zusätzlich zu den auf afrikanischem Boden entstandenen Pidgin- und Kreolsprachen.[17] Hierdurch entstanden nicht nur neue sprachliche Minderheiten, sondern das über Jahrhunderte verfestigte Verhältnis von zahlenmäßig dominanten afrikanischen Sprachen und sprachlichen Minoritäten wurde dramatisch und teilweise traumatisch verändert.[18] Nur von wenigen Kolonialisten und keinem Einheimischen als Muttersprache gesprochen, erhielten die importierten Sprachen ein übermäßiges Prestige und Macht aufgrund ihres Verständigungsmonopols auf nationaler Ebene in öffentlicher Kommunikation, Verwaltung und Erziehung von der Grundschule bis zur Universität. Ursprünglich äußerst bedeutsame afrikanische Verkehrs-und Verwaltungssprachen wurden damit zugleich in ein vernakuläres Ghetto verwiesen.
Die unmittelbare Konsequenz war die Spaltung der afrikanischen Gesellschaften in eine zahlenmäßig unbedeutende Elite, die das formale Bildungssystem erfolgreich absolviert hatte und der importierten Fremdsprache mächtig war, und die breite Bevölkerung, die überwiegend analphabetisch und der offiziellen Sprache nicht mächtig war. Die Crux der Sprachenfrage in Afrika ist die Wahl zwischen exoglossischer und endoglossischer Sprachpolitik. Endoglossische Sprachpolitik bedeutet Wahl zugunsten einer oder mehrerer indigener afrikanischer Sprachen. Exoglossische Sprachpolitik bedeutet die möglichst umfassende Einführung einer importierten Sprache, natürlich die der ehemaligen Kolonialmacht, die zudem, wie im Falle des Englischen oder Französischen, den Vorteil hat, eine sogenannte Weltsprache zu sein. Gerade der letzte Gesichtspunkt hat zur großen Popularität der exoglossischen Varianten beigetragen.
Halten wir fest: Die Sprachenfrage in Afrika stellt sich extrem verschärft dar durch zwei wesentliche Faktoren: (1) den charakteristischen Multilingualismus, und (2) das koloniale sprachpolitische Erbe. Betrachten wir zunächst diese beiden Faktoren etwas genauer und wenden uns dann einigen Spezifika der Sprachenfrage in Afrika zu.
4.1 Multilingualismus in Afrika
Anhand einer selektiv zusammengestellten Tabelle zeigt sich, daß Bevölkerungszahlen nicht mit dem Grad der Sprachenvielfalt korrelieren müssen:[19]
| Staat | Bevölkerung | Zahl der bekannten Sprachen |
| Botswana | ca. 1,5 Mio | (28) |
| Kongo (Brazzaville) | ca. 3 Mio | 31 (62) |
| Somalia | ca. 8 Mio | (13) |
| Angola | ca. 11 Mio | 29 (41 + 1 ausgestorben) |
| Kamerun | ca. 16 Mio | 183 (282 + 4 ausgestorben) |
| Elfenbeinküste | ca. 17 Mio | 58 (78 + 2 ausgestorben) |
| Ghana | ca. 21 Mio | 57 (79) |
| Kenia | ca. 32 Mio | 35 (61) |
| Tansania | ca. 37 Mio | 113 (127 + 1 ausgestorben) |
| Sudan | ca. 39 Mio | 133 (134 + 8 ausgestorben) |
| Dem. Rep. Kongo | ca. 58 Mio | 206 (214 + 1 ausgestorben) |
| Äthiopien | ca. 68 Mio | 92 (84 + 5 ausgestorben) |
| Nigeria | ca. 137 Mio | 410 (512 + 9 ausgestorben) |
Die eigentliche Komplexität der Mehrsprachigkeit in Afrika wird in diesen Zahlen jedoch noch gar nicht deutlich: So handelt es sich im Falle Nigerias bei 397 der 410 Sprachen um sogenannte Minoritätensprachen – allerdings machen diese Minoritäten zusammen etwa 60 % der Bevölkerung aus. Eine soziolinguistische Untersuchung zur individuellen Mehrsprachigkeit in Nigeria brachte folgende Ergebnisse: 60 % der Befragten nutzen 2 Sprachen; 30 % der Befragten nutzen 3 Sprachen; 10 % nutzen 4 und mehr Sprachen.[20] Der Autor selbst hat in Afrika mit Menschen zu tun gehabt, die 8 und 9 Sprachen aktiv nutzen konnten, wenn auch nicht alle mit gleicher Kompetenz.
4.2 Sprachpolitisches Kolonialerbe
Hinsichtlich des kolonialen Erbes stellen wir im Wesentlichen zwei diametral entgegengesetzte Politikstrategien fest: die romanische Assimilationspolitik vor allem Frankreichs und Portugals, und die germanische hier bewußt so genannte Apartheidpolitik, vor allem Englands und Belgiens, teilweise auch Deutschlands, und vor allem in Südafrika, die im Gegensatz zur Assimilationspolitik auf Dissimilation bzw. fortgesetzte „Trennung“ abzielte. Die romanische Assimilationspolitik setzte im Sinne eines selbst erteilten Zivilisationsauftrags ausschließlich auf die eigene Sprache als offizielle Sprache auch in den Kolonien. Dies ließ absolut keinen Raum für die indigenen afrikanischen Sprachen. Ziel des Zivilisationsauftrages z.B. im Falle Frankreichs war die Herstellung quasi „schwarzer Franzosen“ im sog. überseeischen Frankreich (La France d’Outre Mer). Die germanische Apartheidpolitik ließ hingegen Raum für „getrennte Entwicklung“, so die ursprüngliche Bedeutung des Wortes apartheid. Afrikanische Sprachen erhielten ihren Platz im Schulsystem, ursprünglich für mindestens die ersten drei Jahre, mancherorts auch länger (sogenannte early exit Modelle, subtraktiver Bilingualismus). Erst dann erfolgte der Wechsel der Unterrichtssprache in die sogenannte offizielle Sprache, also z. B. Englisch. Zum System der britischen indirect rule gehörte die Zulassung der lokalen Gerichtsbarkeit (in den sogenannte native courts), bei denen natürlich alle Verhandlungen in den afrikanischen Sprachen geführt wurden.[21]
Beide Politikstrategien führten in ihrer Konsequenz in die heute zu konstatierende Bildungskatastrophe Afrikas: Die Assimilationspolitik zielte auf eine flächendeckende Zwangszivilisierung ab und nahm dafür kulturelle Entwurzelung und sprachliche Entfremdung in Kauf. Sie blieb im Falle des Französischen in ihrer Breitenwirkung stecken und ist gescheitert. Die Apartheidpolitik z. B. der Briten zielte auf die Herstellung einer schmalen Elite, der es dann überlassen bleiben sollte, mit der Masse der Bevölkerung in den indigenen Sprachen zu kommunizieren. Diese koloniale Sprachpolitik schuf „…two national groups, a linguistic division which has been based on the fact that one group knows better the colonial language, has got access to an education considered better, whereas the other group in fact the majority, only knows the national African languages, which by government decision, give it no right of access to useful and valuable education, and consequently condemns it to remain always an ignorant class, dominated.”[22] Beide Politikstrategien hatten dieselbe negative Konsequenz: Sie förderten die Herausbildung einer schmalen Elite, die sich weitgehend sprachlich definiert. Diese Elite wacht eifersüchtig darüber, wer Zugang zum Privileg der exoglossischen Bildung und damit zu den Fleischtöpfen der (post-)kolonialen Verwaltungsapparate hat. Der überwiegende Teil der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung in Afrika bleibt ohne Aussicht auf adäquate Bildung – nicht zuletzt, weil für sie die sprachliche Hürde zu hoch ist.[23] Dennoch halten fast alle befragten Eltern, Schüler und Lehrer an der Ansicht fest, daß Schulbildung unauflösbar mit der ex-kolonialen Fremdsprache verbunden sei. Hierin äußert sich eine sprachsoziologische Grunderkenntnis: Sprache ist Macht; „Beherrschung“ der Amtssprache bedeutet zugleich Zugang zu politischer Macht und Kontrolle über nationale Ressourcen. Afrikanische Eltern geben als einziges Erziehungsziel für ihre Kinder oft an, gute Kenntnisse in der offiziellen Sprache zu erwerben, unabhängig davon, ob es sich um eine importierte oder eine indigene Sprache handelt, denn nur dies eröffne die erhofften Berufsperspektiven.
Aus der geschilderten Situation leitet sich eine erste These ab, nämlich daß die Unterentwicklung Afrikas ursächlich, aber natürlich nicht monokausal, mit der afrikanischen Bildungskatastrophe zusammenhängt. Eine zweite These ist, daß die afrikanische Bildungskatastrophe wiederum auf das Engste mit der Sprachenfrage verknüpft ist, auch hier wiederum nicht monokausal, aber mit einer herausragenden Bedeutung der Rolle der afrikanischen Muttersprachen. Um gleich klarzustellen: Es geht in keinem Fall darum, die ex-kolonialen offiziellen Sprachen wie Englisch, Französisch oder Portugiesisch aus dem Schulsystem zu verbannen. Dies wäre unsinnig und kontraproduktiv.[24] Es geht vielmehr darum, ein der jeweiligen Situation angepaßtes mehrsprachiges System zu etablieren und in allen Schultypen vom Kindergarten bis in die Universität umzusetzen. In diesem multilingualen System finden sowohl die indigenen Sprachen als auch die sogenannten Weltsprachen, gerade wegen ihrer Bedeutung auch für die nationale Kommunikation, ihren angemessenen Platz. Ein solches Bildungssystem wird begründet mit den Ergebnissen weltweit durchgeführter multilingualer Schulexperimente. Dieses angepaßte multilinguale System wäre das von fast allen ausgewiesenen Experten favorisierte additiv-bilinguale Modell. In einigen Fällen wäre in Afrika ein additiv-trilinguales Modell angemessen, sofern neben der offiziellen (importierten) Sprache es aus Gründen der optimierten nationalen Kommunikation geboten ist, zusätzlich eine regionale oder nationale Verkehrssprache in den Unterricht einzuführen. Daneben ist nicht auszuschließen, daß in urbanen Agglomerationen monolinguale Lösungen in der offiziellen Sprache vorzusehen sind, soweit dort mehrheitlich Kinder mit Varietäten der Amtssprache bereits als Erstsprache aufwachsen (in der Regel sind jedoch auch die afrikanischen Großstädte sprachlich und räumlich gegliedert, d. h. deutlich abgrenzbare Stadtviertel sind durch charakteristische Sprachwahl definiert.) Bi- und trilinguale Bildungssysteme sind, entgegen weit verbreiteten Annahmen, wesentlich effektiver und effizienter, auch im Sinne von Kosten-Nutzen-Relationen, als die maroden überkommenen einsprachigen oder subtraktiv-bilingualen Systeme, die durch early exit aus dem mutter- bzw. erstsprachlichen Unterricht und deren vollständigen Ersatz durch die ex-koloniale Fremdsprache als Unterrichtssprache charakterisiert sind.[25]
4.3. Die Spezifika der Sprachenfrage in Afrika
Unablässig wird afrikanischen Eltern und Schülern vermittelt, daß ihre Muttersprachen und die vorrangig über dieses Medium vermittelten Kulturen quasi unter unheilbaren Erbkrankheiten leiden: Die als sogenannte „Stammessprachen” diskreditierten afrikanischen Sprachen werden als statisch, hinterwäldlerisch, den Erfordernissen der modernen Zeit nicht angepaßt und auch nicht anpaßbar dargestellt; das in diesen Sprachen transportierte kulturelle Erbe als nutzloser Ballast und sogar Hindernis für Entwicklung und Fortschritt. Hieraus leitet sich eine dritte These ab: Die Sprachenfrage in Afrika wird in ihrer extrem verschärften Form solange weiter bestehen, wie (a) derartige diskriminierende Aussagen seitens der Vertreter der früheren Kolonialmächte und der der eigenen Kultur entfremdeten neuen Funktionärskaste erhoben und leider von vielen afrikanischen Eltern, Schülern und Lehrern auch geglaubt werden; (b) afrikanische Kinder systematisch ihres Grundrechts beraubt werden, Bildung in der eigenen Sprache (oder zumindest in einer Sprache, mit der sie bei Schulbeginn bereits hinlänglich vertraut sind) zu erwerben; und (c) afrikanische Regierungen, überregionale Organisationen, führende Politiker und Experten allenfalls Lippenbekenntnisse ablegen zur Förderung afrikanischer Sprachen in offiziellen Funktionen, und d. h. vor allem hinsichtlich ihres adäquaten Einsatzes im Bildungssystem, aber keine konkreten Schritte unternehmen, die teilweise durchaus bemerkenswert aufgeklärt formulierten sprachpolitischen Verfassungsaufträge in der Praxis umzusetzen.
Hinzu kommen in Afrika einige Besonderheiten der historischen Situation, die die Sprachenfrage in ihren sozialen, politischen und wirtschaftlichen Dimensionen noch zusätzlich verschärfen. Als erstes ist zu nennen das ungeklärte Verhältnis von „Muttersprache“ (besser: Erstsprache, L1) und „Fremdsprache“ (L2). In Afrika scheint die aus pädagogischen und politischen Gründen wichtige Unterscheidung von L2 (z. B. der als Amtssprache mit Verfassungsrang festgeschriebenen Ex-Kolonialsprache) und L1 (bzw. vielen L1 nebeneinander) im allgemeinen Bewußtsein aufgehoben zu sein bzw. bewußt negiert zu werden. So wird etwa in Kenia heftig diskutiert, ob Englisch dort nun als eine kenianische Sprache (und damit L1) oder als Fremdsprache (L2) zu behandeln sei – die Antwort hat weit reichende Konsequenzen für die Sprach-und Bildungspolitik und die konkrete Schulpraxis; für viele sogenannte frankophone Länder gilt dies genauso für die soziopolitische und damit ideologische Bewertung des Französischen. Soziolinguistisch und pädagogisch handelt es sich für die ganz überwiegende Zahl der betroffenen Schulkinder und Erwachsenen eindeutig um „Fremdsprachen“, wenn auch – in Afrika nur scheinbar paradox – um Fremdsprachen mit nationaler Bedeutung.
Als zweites ist zu nennen die Idee von der „neutralen“ Einheitssprache. Afrikanische Politiker, aber auch viele von deren Beratern, sitzen der eigenartigen Idee auf, daß der nationalen Einheit am besten mit einer „Einheitssprache“ gedient sei, die mit der Nation bzw. den Einwohnern des Staates im Wesentlichen gar nichts zu tun hat – vom historischen Zufall der kolonialen Landnahme abgesehen, oder die als Symbol und „Arbeitssprache der Befreiung“ aus dem Exil mitgebracht wurde, wie z. B. in Namibia, aber auch in Südafrika.[26] Sie halten die zwangsimportierte Sprache für politisch „neutral“ im Hinblick auf die rivalisierenden ethnischen und sprachlichen Gruppierungen im Staate – und reißen dabei einen neuen tiefen Graben auf zwischen den Wenigen, die diese Sprache beherrschen, und den Vielen, die mittels dieser Sprache beherrscht werden. Natürlich war die Idee auch, ein fertiges und im kolonialen Mutterland bewährtes Erziehungssystem einfach und kostengünstig übernehmen und damit eine den Zukunftsaufgaben der jungen unabhängigen Staaten gerecht werdende Bildung in ausreichendem Maße sicherstellen zu können. Dies stellte sich als fataler Irrtum heraus: Beide Ziele wurden nicht erreicht. Die nationale Einheit wurde nicht befördert, die Machtfrage zwischen rivalisierenden dominanten Gruppen schwelt weiter und entlädt sich immer wieder in sogenannten „Stammeskriegen“ (die natürlich keine sind, sondern Kämpfe um die Macht im Staat und Zugriff auf nationale Ressourcen). Das Bildungssystem ist extrem elitär und etabliert eine kleine, kulturell entfremdete Funktionärskaste; der überwiegende Teil der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung bleibt davon praktisch ausgeschlossen, mit entsprechendem volkswirtschaftlichem Schaden durch Vergeudung finanzieller und menschlicher „Ressourcen“.
Die dritte Besonderheit betrifft die Restriktionen, die dem L1-Unterricht aufgebürdet werden. Wenn schon afrikanische Muttersprachen im Bildungssystem eingesetzt werden, dann in der Regel nur in den ersten 1 bis 3 Jahren der allgemeinen Primarschule, oder sie werden gleich in das Ghetto weniger sogenannter Experimentalschulen relegiert. Afrikanische Sprachen werden als notwendiges Übel angesehen, um den Übergang zur offiziellen Staatsfremdsprache gegebenenfalls zu erleichtern, und das so schnell wie möglich. Eine begründete positive Grundeinstellung zu den afrikanischen Sprachen verbirgt sich dahinter in den wenigsten Fällen.
5. Sprachplanung in Afrika
Sprachplaner in Afrika waren bislang meist einem monistischen Ansatz verpflichtet: ein Staat – eine Sprache. Sie hatten die Wahl zwischen zwei Strategien, von einer neuen dritten Strategie wird noch gesprochen werden. Die (monistische) Sprache-als-Instrument-Strategie zielt auf nationale Integration, zügige Modernisierung und internationale Kommunikation; sie führt in der Regel zu einer exoglossischen Sprachpolitik, d. h. Gebrauch einer Fremdsprache zur nationalen Kommunikation. Dies führt zum Elitismus.
Durch die importierte Sprache wird der Zugang zu höherer Bildung eingeschränkt mit dem Vorteil für die Elite, dadurch den Selbstrekrutierungsprozeß kontrollieren zu können. Diese Strategie ist von oben nach unten gerichtet, autoritär und undemokratisch. Ein solches System hat erschreckend negative Auswirkungen: hohe Schulabbruch-Quote, massenhaftes und häufig wiederholtes „Sitzenbleiben“, in fast allen Bereichen unterqualifizierte Absolventen, die weder auf ein produktives Erwerbsleben, noch auf die nächst höhere Schulstufe vorbereitet sind. Dieser Strategie sind die meisten afrikanischen Staaten seit ihrer Unabhängigkeit verpflichtet.
Die Sprache-als-Symbol-Strategie ist eine Reaktion auf das Versagen der eben beschriebenen Strategie. Sie basiert auf einer endoglossischen Sprachpolitik, d. h dem offiziellen Gebrauch einer einheimischen afrikanischen Sprache mit dem Anspruch, durch deren Aufwertung afrikanische Authentizität, Identität und die Entwicklung der „afrikanischen Persönlichkeit“ zu fördern (herausragendes Beispiel in Ostafrika: Kiswahili). Diese Strategie ist im Prinzip von unten nach oben gerichtet, demokratisch und zielt auf die Beteiligung möglichst vieler Bevölkerungsteile an der nationalen Entwicklung. Sie läßt aber den konstitutiven Multilingualismus außer acht mit der Folge, daß weite Teile der Bevölkerung, die der ausgewählten afrikanischen Sprache nicht hinreichend mächtig sind (vgl. z. B. Amharisch im vorrevolutionären Äthiopien, aber auch bezüglich des Kiswahili), marginalisiert bleiben.
Seit kurzem setzt sich eine weitere Strategie in der soziolinguistischen Diskussion durch, die wir als Sprache-als-Ressource-Strategie bezeichnen. Sie geht vom alltäglichen Sprachverhalten der Mehrheit der Afrikaner aus, das durch funktionalen Multilingualismus gekennzeichnet ist, d. h. eine der jeweiligen Lebenssituation angepaßte Verwendung mehrerer Sprachen zu unterschiedlichen Zielen und Zwecken.[27] Nachhaltige Modernisierung der Gesellschaft erfordert den Wechsel sowohl von monistischen zu pluralistischen Strategien als auch von der Sprache-als-Instrument- zur Sprache-als-Symbol-Politik und damit Maßnahmen zum empowerment bislang marginalisierter Sprachen und ihrer Sprecher, wie sie im Language Action Plan for Africa der OAU (Organisation für Afrikanische Einheit) und unzähligen Resolutionen und Nachfolgedokumenten genannt werden. Es geht dabei um die funktionale Aufwertung der einheimischen Sprachen zu Nationalsprachen und Amtssprachen, um staatlich geförderte Sprachplanung im Sinne von deren Modernisierung und Standardisierung, sowie um den Gebrauch dieser afrikanischen Sprachen in sogenannten erweiterten Domänen, d. h. zu allen öffentlichen und professionellen Kommunikationsanlässen.
6. Die Dauer-Kontroverse: Pro und Contra Muttersprachunterricht
Ein Dauerbrenner in der Diskussion der Sprachenfrage in Afrika ist die Kontroverse zwischen der Muttersprachfraktion und der Amtssprachfraktion. Diese Kontroverse zusammenfassend zu referieren bedürfte es eines weiteren umfangreichen Aufsatzes. Nur soviel sei hier dazu angemerkt: Seit der berühmten Empfehlung der UNESCO-Expertenkommission des Jahres 1951, daß der Gebrauch der Muttersprache im Bildungswesen so lange wie möglich erfolgen sollte und daß vor allem Kinder bei Schuleintritt in ihrer Muttersprache, oder wenigstens in einer Sprache, die ihnen bereits hinlänglich vertraut ist (als L1), unterricht werden sollen, hat diese Frage die Gemüter von Betroffenen in Afrika und der internationalen Gemeinde der Afrikalinguisten erhitzt. Dieser völlig eindeutigen UNESCO-Expertenempfehlung, deren Wirksamkeit seither durch eine Vielzahl von Schulexperimenten innerhalb und außerhalb Afrikas immer wieder aufs neue bestärkt wurde, steht die unausrottbare und doch sachlich falsche Auffassung der meisten Eltern und Schüler, ja auch oft sogar der Lehrer und ohnehin aller in pädagogischen Dingen ignoranten Laien, gegenüber: Für den Fremdsprachenerwerb gälte der Satz „je länger, desto besser“, und daher auch: „je früher, desto besser.“ In die afrikanische Lebenswirklichkeit und Schulpraxis umgesetzt heißt dies, die Kinder möglichst schon ab Kindergarten ausschließlich mit Englisch oder Französisch zu konfrontieren. Auf die katastrophalen Auswirkungen dieses Ansatzes unter den vorherrschenden Bedingungen wurde bereits hingewiesen. Das Problem liegt in der Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung in allen ihren Teilen darüber, daß das von ihnen nachdrücklich geforderte legitime Ausbildungsziel, nämlich die Beherrschung der offiziellen Sprache L2 (meist eine importierte Fremdsprache), viel erfolgreicher, oder für die meisten Kindern überhaupt nur mit Aussicht auf Erfolg, auf dem Wege über den L1-Unterricht möglich ist. Natürlich sind noch andere Faktoren beteiligt, wenn ein Bildungssystem erfolgreich funktioniert, die Sprachenfrage ist dabei nur ein, aber sehr wichtiger, Faktor – wenn nicht gar der wichtigste.
Am Anfang des 21. Jahrhunderts müssen wir also feststellen, daß in Afrika das aus der Kolonialzeit überkommene System, das im Wesentlichen auf Monolingualismus auf der Basis einer ex-kolonialen Fremdsprache beruht, gescheitert ist. Vor dem Hintergrund zahlreicher Studien, die die kognitiven und kreativen Vorteile der L1-Strategie eindrucksvoll belegen, beginnt in Afrika das Pendel langsam in die Richtung auszuschlagen, die die UNESCO Kommission bereits vor mehr als 50 Jahren nachdrücklich empfohlen hatte. Der Druck auf die afrikanischen Regierungen wächst, die überfälligen Reformen anzugehen und umzusetzen. NGOs und einige Geberländer sind inzwischen schwerpunktmäßig in verschiedenen Staaten Afrikas im Bildungssektor aktiv geworden und räumen mother-tongue-based bilingual education Modellen wachsenden Raum ein. Selbst die Weltbank, jahrzehntelang ein Hort eurozentrischer, wenn nicht gar kulturimperialistischer Konzepte hinsichtlich der Sprachenfrage im Bildungssektor, hat dies begriffen.[28]
7. Sprache und „Entwicklung“
Der Nutzen von Sprache, etwa die Wahl der L1 für den Schulunterricht, für gesellschaftliche, politische und ökonomische „Entwicklung“ leitet sich aus einem humanitären Entwicklungskonzept ab, wie in einem UNESCO-Dokument formuliert, 1992 zusammengestellt anläßlich der 43. Sitzung der International Conference on Education:[29]
„Weil das primäre Ziel aller Entwicklung der Mensch selbst ist, sollte Entwicklung auf die Ausweitung und Förderung der menschlichen Fähigkeiten abstellen, indem sie Menschen nicht nur Zugang zu materiellen Gütern verschafft,... sondern auch zu so unabweisbaren Gütern wie Wissen und das Recht, eine vollwertige Rolle im Leben der Gemeinschaft zu spielen …“ (Übersetzung des Autors)
In einem solchen Entwicklungskonzept kommt der Bildung und Ausbildung der Masse der Bevölkerung eine ganz herausragende Rolle zu. In beiden Fällen ist eine L1, also die jeweilige afrikanische Muttersprache oder eine bereits aktiv verwendete afrikanische Verkehrssprache, das am besten geeignete Medium. Denn selbst Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz hängen entscheidend von Wissen und Fähigkeiten des Individuums ab, die bereits in der frühkindlichen Entwicklung gefördert werden müssen. Die grundlegenden kognitiven Fähigkeiten werden weitestgehend über Sprache vermittelt, und dies nur in einer solchen Sprache, die das Kind sehr gut kennt und beherrscht. Zu den wichtigsten kognitiven Fähigkeiten für eine Berufstätigkeit in einer sogenannten entwickelten Wirtschaft und Gesellschaft gehören z. B. ganz offensichtlich Fähigkeiten wie die folgenden: den wesentlichen Inhalt eines Textes zu erfassen und die Hauptargumente zusammenfassend wiedergeben zu können; relevante Informationen auszuwählen und in einem neuen kohärenten Ganzen zusammenzufügen; Verallgemeinerungen zu entdecken und zu formulieren; abstrakte Konzepte zu verstehen und als Argumente einzusetzen; sowie Beziehungen zwischen Ereignissen zu erkennen (z. B. Ursache und Wirkung). Diese kognitiven wie sprachlichen Fähigkeiten können nicht in einer Sprache erlernt und entwickelt werden, die man gar nicht oder allenfalls mangelhaft beherrscht, und die vor allem auch die Lehrer nur mangelhaft beherrschen.[30] Entsprechend „unterentwickelt“ bleibt das „Humankapital“ einer Gesellschaft, der es nicht gelingt, die kreativen und intellektuellen Potentiale über ein die Techniken von Wissenstransfer adäquat vermittelndes Bildungssystem zu wecken und für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt nutzbar zu machen.
Eine Antwort auf die Frage, warum Bildung und Sprachenproblem in der bisherigen Entwicklungsdiskussion keine oder kaum eine Rolle gespielt haben, ist unter anderem in der Langfristigkeit der Wirkung von Maßnahmen im Bildungssektor zu suchen. Ökonomische und tagespolitische Fehlentscheidungen rächen sich oft kurzfristig, d. h. die Auswirkungen ökonomischer oder auch politischer Maßnahmen machen sich bald bemerkbar und können gegebenenfalls repariert werden – noch vor den nächsten Wahlen. Im Bildungsbereich haben wir es mit Schülergenerationen und Ausbildungszyklen von 9, 12 oder gar 20 Jahren zu tun, wenn wir die Universitäten mit einbeziehen. Kaum ein auf Wiederwahl spekulierender Politiker läßt sich auf so lange Zyklen ein, von autokratischen Systemen ganz abgesehen. Und doch liegen die Auswirkungen bildungspolitischer Fehlentscheidungen auf der Hand; hierzu zählen vor allem Ineffizienz von Verwaltungen und Bürokraten, Vergeudung von Ressourcen und Lebenszeit in den Schulen, geringe Produktivität, mangelnde Teilnahme am öffentlichen Leben; kurz: Unterentwicklung. Es geht aber auch um materielle Vergeudung von Ressourcen. Man könnte auf Heller und Pfennig ausrechnen, was allein an Lehrergehältern vergeudet wird, wenn 60 bis 80 % der Schüler das Schulziel nicht erreichen, bzw. diejenigen, die das Schulziel erreichen, bis zu 9 Jahre länger dazu brauchen, als das System vorsieht.
Wie konnte es zu der beschriebenen Bildungskatastrophe kommen, selbst in jenen Staaten, in denen der Weg aus der Misere, nämlich die Umstellung auf eine multilinguale und Muttersprachen-bezogene Bildung, wie von Experten seit Jahren gefordert, längst bekannt ist? Eine Antwort finden wir bei Neville Alexander (1999), Leiter des Projekts für Forschungen über alternative Erziehung in Südafrika (PRAESA):[31]
„... die neue Elite, schwarz und weiß, ist nicht bereit, mehr als nur Lippenbekenntnisse abzulegen hinsichtlich der Förderung von Multilingualismus oder der Entwicklung der afrikanischen oder anderer marginalisierter Sprachen... Der Grund für diese Tendenz ist, daß der neue Elitismus, der sich eingestellt hat, sich sehr bequem mit der Übernahme des kolonialen Apparats arrangiert und ihn nur insoweit ‚reformiert’ hat, als man black faces in white places etabliert und ansonsten im Grunde alles beim Alten belassen hat.“ (Übersetzung des Autors)
Es herrscht im postkolonialen Afrika, nach Neville Alexander, ein Status-quo-Erhaltungssyndrom vor, das durch Resignation, soziale Pathologie und Mediokrität gekennzeichnet ist und in eine Neo-Apartheid führt – und damit zwangsläufig Unterentwicklung zementiert.[32] Dazu gehört, daß selbst Verfassungsaufträge hinsichtlich der Umsetzung von Maßnahmen im Erziehungswesen, und hier vor allem wieder die Frage der Mutter-und Nationalsprachen, ignoriert, sabotiert und konterkariert werden. Häufig genug ist aber bereits der Verfassungsauftrag oder das entsprechende Gesetz so mit Hintertüren und Ausnahmeklauseln gespickt, daß der Normalfall die Nichtanwendung des Gesetzes wird.[33]
Die größte aller Hürden befindet sich im Kopf der am meisten Betroffenen selbst. Afrikaner aller Schichten und Herkunftsregionen teilen, wie der Doyen der afrikanischen Soziolinguistik, Ayo Bamgbose, zum wiederholten Male noch im Jahre 2000 betonen muß, ein tief sitzendes negatives Vorurteil gegenüber ihren eigenen Sprachen, das in der traumatischen Erfahrung der Kolonialzeit wurzelt. Die Geringschätzung der afrikanischen Sprachen durch Afrikaner selbst beruht auf Jahrhunderten der Marginalisierung, Ignoranz, und eigener schmerzhafter Erfahrungen in der Vergangenheit.[34] Weitere negative Faktoren, die von Sprachplanern für Afrika immer wieder moniert werden, sind (a) die „Unsichtbarkeit“ der afrikanischen Sprachen im öffentlichen Leben (Ausnahmen stellen in dieser Beziehung das Swahili, das Amharische und das Somali dar), (b) das Fehlen einer „Schreib-und Schriftkultur“ (literacy environment), d. h. Herstellung und Vertrieb von Literatur aller Art (Fachliteratur und Belletristik, Schulbücher und Übersetzungen aus anderen, vor allem auch afrikanischen Sprachen), (c) der geringe „Marktwert“ der indigenen Sprachen.[35] Auch der „Symbolwert“ der afrikanischen Sprachen muß erhöht werden, unter anderem mittels öffentlicher Nutzung durch afrikanische Führungspersönlichkeiten, die Medien, und durch konsequenten Einsatz im nationalen Erziehungssystem, und zwar in allen Zyklen – also zumindest auch als Unterrichtsfach im Sekundar-und Tertiärbereich. Studien z. B. aus Kenia zeigen ein verblüffendes Bild: Sekundarschüler geben zwar zu, daß sie ihren Lehrern besser folgen können, wenn diese auf Swahili unterrichten; dennoch ist eine Mehrheit dieser Schüler überzeugt, daß Englisch als Unterrichtssprache beibehalten werden soll. Hier zeigt sich deutlich die Wahrnehmung der Sprachenfrage als Machtfrage: Macht ist da, wo das Englische ist. Wir haben es nicht allein mit Fragen der pädagogischen Effizienz zu tun, sondern mit der Einbindung von politischen und sozioökonomischen Faktoren, darunter der jeweilige Status der Sprachen im Machtgefüge. Entsprechend sind Schlüsselkonzepte des innerafrikanischen sprachsoziologischen Diskurses empowerment und intellectualisation, d. h. die Verwendung afrikanischer Sprachen auch in den anspruchsvollsten Domänen des Sprachgebrauchs getreu der soziolinguistischen Einsicht, daß Sprachentwicklung durch Sprachgebrauch erfolgt.
8. Epilog
Seit Amtsantritt des neuen Präsidenten von Südafrika, Thabo Mbeki, macht das Wort von der „Afrikanischen Renaissance“ verstärkt die Runde – eine rhetorische Hülse, die dennoch eine starke Symbolkraft hat. Mit dem Begriff der Renaissance wird auf indigene Ressourcen Afrikas Bezug genommen. Unverzichtbar dazu gehören die afrikanischen Sprachen, die als die vornehmsten Gefäße der vielfältigen afrikanischen Kulturen weitgehend ungehobene Schätze des Weltkulturerbes transportieren.[36] Eine afrikanische Renaissance ist nicht denkbar, wenn diese Sprachen nicht ihren angemessenen Platz in der Gesellschaft einnehmen.[37] Dazu bedarf es in Afrika der Normalität, die für den überwiegenden Teil der Welt, vor allem für deren sogenannten entwickelten Teil gilt: nämlich daß der Einzelne alle wichtige Kommunikation über das Vehikel einer L1 betreiben kann. Dazu muß das Bildungssystem in Afrika auf L1-Unterricht umgestellt werden, wobei den regionalen Verkehrssprachen und den sogenannten Weltsprachen als Fremd- und Arbeitssprachen ihr fester Platz in additiv-bilingualen bzw. additiv-trilingualen Bildungssystemen zukommt. Dazu müssen die meisten afrikanischen Sprachen erst fit gemacht werden, darin liegt eine wesentliche Aufgabe für Sprachplaner, Entwicklungsberater und Politiker. Dies führt uns zu den drei großen „M“ der angewandten Soziolinguistik in Afrika:[38] Multilingualismus unter Einbeziehung von möglichst vielen afrikanischen L1 neben den sog. Weltsprachen als L2 (aber keineswegs statt ihrer); Modernisierung („Intellektualisierung“) durch Standardisierung und Terminologiebildung; Muttersprachen/L1-basierte Bildungssysteme unter Beachtung der pädagogisch adäquaten Scheidung von L1 und L2.
Eine den Zielen von nachhaltiger Entwicklung und Armutsreduktion in Afrika verpflichtete Afrikanistik knüpft in scheinbar paradoxer Weise an den praxisbezogenen Beginn der Wissenschaft vor mehr als 100 Jahren an, allerdings unter völlig veränderten Voraussetzungen. Geblieben ist der humanitäre Ansatz einer angewandten afrikanistischen Soziolinguistik, die ihren Fokus auf die indigenen Potentiale der afrikanischen Sprachen richtet für eine Entwicklung in Afrika, die der sogenannten Hamburger Erklärung der UNESCO von 1997 verpflichtet ist, in der es in Artikel 18 zu „Indigener Bildung und Kultur“ heißt:[39]
„Indigene und nomadische Völker haben das Recht auf Zugang zu allen Ebenen des Bildungssystems, die der Staat bereitstellt. Dabei darf ihnen das Recht nicht verweigert werden, sich ihrer eigenen Kultur zu erfreuen und ihre eigene Sprache zu verwenden. Bildung für indigene und nomadische Völker soll sprachlich und kulturell ihren Bedürfnissen angemessen sein und ihnen den Zugang zu weiterführender Bildung und Ausbildung erleichtern.“ (Übersetzung des Autors)
Nur unter Verwirklichung dieser Rechte und Forderungen, will scheinen, aber natürlich nicht nur auf diesem Weg allein, können Unterentwicklung und Armut in weiten Teilen Afrikas langfristig beseitigt und die Weichen in eine bessere Zukunft gestellt werden. Dies ist eine begründete Hoffnung, die in Opposition steht zum Afrika-Pessimismus des mainstream-Entwicklungsdiskurses. Voraussetzung ist, daß die Sprachenfrage in ihrer ganzen Komplexität und Relevanz für den entwicklungspolitischen Diskurs wahrgenommen wird, von Experten wie Entscheidungsträgern, innerhalb wie außerhalb Afrikas, und daß eine angemessene Umsetzung in die Praxis erfolgt.
In Afrika sind es Eltern und Schüler, Lehrer und Schulleitungen, Provinz- und nationale Regierungen, die hinsichtlich der Sprachenfrage und der erforderlichen Maßnahmen auf dem Bildungssektor des Ersatzes von uninformed choices (Bamgbose) durch sachkundige Aufklärung bedürfen. Die Gründung der African Academy of Languages (ACALAN) als Einrichtung der African Union ebenso wie die aus der ACALAN-Gründung hervorgegangene Initiative, das Jahr 2006/07 in Afrika zum Year of African Languages auszurufen, sowie die ebenfalls in diesem Zusammenhang erfolgreich initiierte Erklärung des Jahres 2008 durch die UNO-Vollversammlung zum „Internationalen Jahr der sprachlichen Vielfalt“ weisen in diese Richtung. Ziel ist die Abkehr vom ideologischen „Monomanismus“ europäischer Prägung, der da heißt „ein Staat – eine Nation – eine Sprache“, d. h. erforderlich ist die Erarbeitung eigener sprach-, kultur- und bildungspolitischer Positionen, die die oktroyierten und weitgehend neokolonialistisch geprägten Bildungssysteme in Afrika zukunftsweisend und unter Nutzung der vorhandenen linguistischen und kulturellen Ressourcen ersetzen. Diese Ressourcen zu identifizieren und nutzbar zu machen, ist eine der Aufgaben der Angewandten Afrikanistischen Soziolinguistik.
In Afrika selbst ist der entsprechende Diskurs seit Jahren entbrannt, er geht allerdings außerhalb Afrikas an vielen Experten in Wissenschaft und Politik vorbei. Daher versteht sich der vorliegende Essay als ein Plädoyer für die Wiederaufnahme des inzwischen erneut überfälligen interdisziplinären Dialogs zwischen Wissenschaft und Politik über die „Sprachenfrage in Afrika“, der in Deutschland bereits mehrfach begonnen und wieder verschüttet wurde, so in den unruhigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg (mit der Folge des Verlustes der Kolonien in Afrika), nach den sich antikolonialistisch und antiimperialistisch verstehenden Studentenunruhen 1968/69 in der alten BRD (mit nachfolgender Gründung der VAD), und nach der Wende an den Universitäten der ehemaligen DDR, wie z. B. am Afrikanistik-Standort Leipzig, dem einzigen in der neuen Bundesrepublik, an dem Afrikalinguistik und regionalwissenschaftlich fokussierte Kultur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften personell und institutionell unter einem Dach vereint sind und an dem die oben skizzierte Angewandte Afrikanistische Soziolinguistik eine akademische Heimstatt hat.
Zusammenfassung
Indigene Sprachen, zumal in Afrika, befinden sich seit der Kolonialzeit in einem Verdrängungswettbewerb mit den sogenannten Weltsprachen der ehemaligen Kolonialmächte. Afrikanische Regierungen und deren internationale Berater, aber auch weite Teile der betroffenen Bevölkerungen teilen eine tief verwurzelte Abneigung gegen die von afrikanischen Intellektuellen und aufgeklärten Sprach- und Erziehungswissenschaftlern geforderte gesellschaftliche und politische Aufwertung der afrikanischen Sprachen und deren Nutzung als entwicklungsrelevante Ressourcen. Zu beklagen sind Ignoranz und thematische Defizite im mainstream-Entwicklungsdiskurs hinsichtlich der wichtigen Rolle muttersprachbasierter multilingualer Bildungssysteme für die Überwindung von Massenarmut und Unterentwicklung in Afrika.
Summary
Since the days of colonialism indigenous languages particularly in Africa suffer from a fatal competition with the so-called world languages of the former colonial masters. Not only African government officials and their international advisors, but also large sections of the African population share a deep rooted negative attitude towards the African languages despite the claims of African intellectuals and enlightened linguists and educationists that these languages can and must be accepted as highly valuable resources for overcoming underdevelopment and mass poverty. Widespread ignorance concerning the language factor blinds mainstream developmental discourse with regard to the overall benefits of mother-tongue based multilingual educational systems for development and poverty alleviation in Africa.
[1] Vgl. Tove SKUTNABB-KANGAS, Why should linguistic diversity be maintained and supported in Europe? Some arguments. Language Policy Division, Directorate of School, Out-of-School and Higher Education, DGIV, Council of Europe, Strasbourg 2002.
[2] Vgl. Joslin L. MOORE u. a., The distribution of cultural and biological diversity in Africa, in: Proceedings of the Royal Society London B 269, 2002, S. 1645-1653.
[3] Wenn auch belastbare Zahlen fehlen (Fragen der tatsächlichen Sprachverwendung werden in der Regel bei Volkszählungen in Afrika nicht erhoben), kann man davon ausgehen, daß eine funktionale Kenntnis und Verwendung der in der Kolonialzeit importierten europäischen Sprachen auch dort, wo sie laut Verfassung oder Dekret „offiziellen Status“ als nationale Amtssprache haben, optimistisch geschätzt bei weniger als 20 % der jeweiligen Bevölkerung gegeben ist, mit signifikant unterschiedlicher Distribution zwischen urbanen und ländlichen Räumen. So wurde z. B. im Senegal konsequent über mehr als 100 Jahre nur das Französische als Unterrichtssprache auf allen Ebenen des Erziehungsssytems eingesetzt mit der Folge, daß auch heute noch vermutlich höchstens 15 % der senegalesischen Bevölkerung das Französische in adäquater Weise im täglichen Leben zu verwenden in der Lage sind. In den meisten afrikanischen Staaten ist die Rate noch weit geringer, man kann sie im Einzelfall eher bei 5 bis 7 % als bei 10 bis 12 % vermuten. Der oft nur kurzfristig anwesende Entwicklungsexperte oder Tourist nimmt dies wenig wahr, da in (Haupt-) Städten und Touristenzentren bei Funktionären und Dienstleistern der Anteil an Mehrsprachigen erfahrungsgemäß sehr viel höher liegt und den durchaus falschen Eindruck vermittelt, man käme im Land mit z. B. Englisch oder Französisch „überall durch“ – und dies könne man daher generell für die (offizielle) nationale Kommunikation annehmen. – Sofern es sich bei den nach Afrika importierten europäischen Sprachen um die des ehemaligen kolonialen Mutterlandes handelt, werden sie im Folgenden als „Ex-Kolonialsprachen“ und „Staatsfremdsprachen“ apostrophiert, ungeachtet der Beobachtung, daß in urbanen Zentren lokale Varietäten dieser Sprachen (New Englishes, français populaire, new urban vernaculars, etc. neben schon älteren Pidgin-und Kreolsprachen) inzwischen von jugendlichen Minderheiten auch als Erstsprachen verwendet werden. Im sprachpolitischen Diskurs in Afrika lösen diese Sprachen stark emotional aufgeladene antagonistische Attitüden aus: Für die einen tragen sie das Stigma von Kolonialismus und neokolonialer Dominanz, für die anderen sind sie Instrumente der Überwindung einer gefühlten „Rückständigkeit“ und Eintrittskarte in die Welt der ehemaligen Kolonialmächte.
[4] Neville ALEXANDER, An African Renaissance without African Languages, in: Ders. (Hrsg.), Language and Development in Africa. Social Dynamics Special Issue 25 [1], 1999, S. 1-12, hier: S. 3.
[5] Ulf ENGEL / Robert KAPPEL u. a., Memorandum zur Neubegründung der deutschen Afrikapolitik. Frieden und Entwicklung durch strukturelle Stabilität, Berlin 2000, S. 1.
[6] Dies erklärt, warum sich Mitglieder der neuen afrikanischen Funktionseliten vehement gegen alles wehren, was unter dem Konzept des empowerment afrikanischer Sprachen und deren Sprechergemeinschaften seit Jahren in Afrika kontrovers diskutiert wird. Die Belohnungen für diese Verweigerung sind vielfach: Zugang zu privilegierten Bildungseinrichtungen, wirtschaftlichen Ressourcen und politischer Macht daheim, auf internationaler Ebene Prestigegewinn und Anerkennung durch die Vertreter der ehemaligen Kolonialmacht und der sogenannten Gebergemeinschaft. Für Literaten und andere Intellektuelle bedeutet dies zudem den Zugang zu einem internationalen Publikum und Markt. Man denkt sogleich an das senegalesische Mitglied der französischen Akademie Léopold Sédar Senghor und den in englischer Sprache schreibenden nigerianischen Nobelpreisträger Wole Soyinka. Der ägyptische Literaturnobelpreisträger Nagib Mahfus schrieb hingegen in arabischer Sprache. Entsprechende Ehrungen sind Autoren, die in afrikanischen Sprachen schreiben, bislang versagt geblieben; hier denkt man an den kenianischen Autor Ngugi wa Thiong’o, der ganz bewußt vom Medium English in das Medium seiner Muttersprache Gikuyu wechselte, um sich (s)ein afrikanisches Publikum zu erschließen. Hinzu kommt der Nutzen bzw. die Notwendigkeit der Verwendung einer sogenannten Weltsprache für die internationale auch innerafrikanische Kommunikation, dies galt schon für die Verbreitung von Kwameh Nkrumahs panafrikanischen Überlegungen in englischer Sprache, oder den transatlantischen Dialog über „négritude“ oder die „damnées de la terre“ zwischen Aimé Césaire und Frantz Fanon auf der einen, und der afrikanischen Diaspora zumal in Paris auf der anderen Seite. Wole Soyinkas schon lange zurückliegende Anregung, dem afrikanischen Kontinent eine eigene kontinentale Verkehrssprache zu geben, die nicht das Stigma des Kolonialismus trüge (er dachte dabei an das Kiswahili), hat sich nicht durchgesetzt; erst in jüngster Vergangenheit wurde Kiswahili überhaupt erstmalig offiziell bei den Beratungen der Staatschefs der African Union verwendet, auch wenn es diese Möglichkeit theoretisch schon seit Gründung der OAU gab. Von größerer weil wirtschaftlicher Bedeutung dürfte sich erweisen, daß die Firma Microsoft inzwischen begonnen hat, Bedieneroberflächen für erfolgreiche Produkte auch in afrikanischen Sprachen, wiederum beginnend mit dem Kiswahili, zu vermarkten. Zur Verbreitung afrikanischer Sprachen im Internet vgl. das thematische Heft Le traitement informatique des langues africaines, Cahiers du Rifal [Réseau international francophone d’aménagement linguistique] 23, November 2003.
[7] Wir lassen bei diesem schülerzentrierten Ansatz zunächst einen zweiten wesentlichen Aspekt beiseite, nämlich den, daß die in der ehemals kolonialen Fremdsprache unerrichtenden Lehrer selbst dieser Sprache zum großen Teil nur unvollkommen mächtig sind. Sie setzen aus Verunsicherung und aufgrund mangelhafter Ausbildung pädagogisch fragwürdige Methoden ein und haben daher an dem Zusammenbruch von Kommunikation in den ohnehin völlig überfüllten Klassen entscheidend Anteil. Faktisch unterlaufen motivierte Lehrer in Afrika die offizielle Sprachpolitik und unterrichten weitgehend in einer der afrikanischen Sprachen, auch wenn sie hierfür nicht ausgebildet wurden und die Schüler trotz dessen in der kaum beherrschten Fremdsprache ihre Examina ablegen müssen – mit vorhersagbar katastrophalen Ergebnissen nicht nur bezüglich der Sprache, sondern in praktisch allen Fächern. Eine rezente Bestandsaufnahme liegt vor in der Arbeitsdokumentation Optimizing Learning and Education for Africa - the Language Factor. A Stocktaking Research on Mother Tongue and Bilingual Education in Sub-Saharan Africa mit Beiträgen von Hassana ALIDOU, Aliyou BOLY, Yaya Satina DIALLO, Birgit BROCK-UTNE, Kathleen HEUGH, und H. Ekkehard WOLFF, erstellt im Auftrag der Association for the Development of Education in Africa (ADEA) zur Vorbereitung des Biennial Meeting of ADEA (27.–31. März 2006 in Libreville, Gabun) in Kooperation mit dem UNESCO-Institut für Pädagogik, Hamburg, und der GTZ.
[8] Vgl. dagegen das explizit den konstitutiven Pluralismus thematisierende Staatsmotto unity in diversity (Nigeria) bzw. das Selbstverständnis als Rainbow Nation (Südafrika).
[9] Für eine Einführung in diese und andere Grundfragen der afrikanistischen Soziolinguistik siehe H. Ekkehard WOLFF, Language and Society, in: Bernd HEINE / Derek NURSE (Hrsg.), African Languages. An Introduction, Cambridge 2000, S. 298-347. Schwerpunkt der Betrachtung dort wie hier ist das subsaharanische Afrika. Dies entspricht zum einen der traditionellen wissenschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Afrikanistik und Arabistik/Orientalistik, wobei sich letztere der weitgehend arabophonen Gebiete des nördlichen Afrikas annimmt, zum anderen der besonderen sprachsoziologischen Situation im arabophonen Raum. Die Sprachenfrage dort betrifft vor allem die Konfliktsituation zwischen den minoritären, muttersprachlich berberophonen Bevölkerungssegmenten und der arabophonen Bevölkerungsmehrheit im Maghreb (Stichwort: Zwangsarabisierung), neben Fragen des Verhältnisses zwischen der (Ex-)Kolonialsprache Französisch und der charakteristischen Diglossiesituation des Arabischen selbst.
[10] J. POOL, National developments and language diversity, in: Joshua A. FISHMAN (Hrsg.), Advances in the Sociology of Language, vol. 2, Den Haag 1972, S. 213-230.
[11] So zitiert bei Christopher STROUD, Towards a Policy for Bilingual Education in Developing Countries. Stockholm 2002, S. 37: „Using advanced statistical techniques, he [gemeint ist Joshua Fishman – HEW] correlated 238 different economic, political, social, cultural, historical, geographic and demographic variables from across 170 countries to GNP, only to find that linguistic heterogeneity bore no predictive value for the level of per capita GNP (Fishman 1991: 13). And, in fact, Fishman and Solano (1989) even suggest that the existence of lingua francas and bilingualism enable many polities to attain a higher per capita GNP.“ Vgl. Joshua A. FISHMAN, An interpolity perspective on the relationship between linguistic heterogeneity, civil strife and per capita gross national product, in: International Journal of Allied Linguistics 1, 1991, S. 5-18; Ders. / F. R. SOLANO, Crosspolity linguistic homogeneity and per capita gross national product: an empirical exploitation, in: Language Problems and Language Planning 13, 1989, S. 103-118.
[12] Die Kluft schlägt sich in für Außenstehende schwer nachzuvollziehenden terminologischen Abgrenzungen nieder: hier die linguistisch begründete „Afrikanistik“, die sich auf eine mehr als 100jährige akademische Tradition im deutschsprachigen Raum beruft, dort die „Afrikawissenschaften“, die sich an importierten jüngeren Vorbildern von African Studies orientieren. Die Gründung der Vereinigung von Afrikanisten in Deutschland (VAD) durch primär sprachwissenschaftlich arbeitende Jungakademiker Ende der 1960er Jahre war der Versuch, in der alten BRD diesen Dialog in Gang zu setzen, führte jedoch durch den massenhaften Zulauf nicht-linguistisch arbeitender Wissenschaftler sehr bald wieder zu einer thematischen Marginalisierung der linguistischen und damit auch sprachpolitischen und sprachsoziologischen Probleme Afrikas. Beim alternativen Afrikanistentag (seit 1978), inzwischen unter den Fittichen des im Jahre 2002 gegründeten Fachverbands Afrikanistik, stehen wieder linguistische und von Fall zu Fall auch soziolinguistische Fragestellungen im Vordergrund.
[13] Siehe dazu auch [H.] Ekkehard WOLFF, Afrikanistik im Dienste der Herrschenden, in: Ders. / Hilke MEYER-BAHLBURG in Zus.arb. m. Ludwig GERHARDT / Siegbert UHLIG, Afrikanische Sprachen in Forschung und Lehre. 75 Jahre Afrikanistik in Hamburg 1909-1984, Berlin 1986, S. 7-32.
[14] Ludwig GERHARDT, Swahili – eine Sprache, zwei Schriften. University of Leipzig Papers on Africa (ULPA). Languages and Literatures 26, 2005, S. 13.
[15] Auch in den westeuropäischen Staaten geraten die traditionell sprachlich eher homogenen Räume in zunehmendem Maße unter den Veränderungsdruck von Immigration aus aller Herren Länder, zusätzlich zur zunehmenden Bedeutung internationaler Verkehrssprachen innerhalb der EU und für den globalen Wettbewerb. Die Kommunikationslandschaft wandelt sich dramatisch, mit nachhaltigen Auswirkungen auf den Bereich der formalen Erziehung. In Ballungszentren klagen Eltern und Lehrer über das, was sie im Extremfall als Marginalisierung ihrer deutschsprachigen Kinder in von „Kindern mit Migrationshintergrund“ überlaufenen Klassen wahrnehmen. Damit hat die „Sprachenfrage“ Einzug in den politischen Diskurs auch in der Bundesrepublik Deutschland gehalten.
[16] Man vergleiche Westeuropa: Anders als im fast schon vergessenen Sprachenkampf der Flamen und Wallonen in Belgien noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts sind die Bürgerkriegsparteien in Nordirland und Ex-Jugoslawien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jeweils durch eine gemeinsame Sprache verbunden gewesen: Englisch bzw. Serbokroatisch. Soziolinguistisch interessant ist die Beobachtung in der Nach-Bürgerkriegsära im ehemaligen Jugoslawien, daß „politisch korrekt“ jetzt von drei verschiedenen Sprachen gesprochen wird, nämlich Serbisch, Kroatisch und Bosnisch, und daß z. B. Schulbücher nun eindeutig einer der drei „Sprachen“ zuzuordnen sein müssen. In Afrika ist ähnlicher politischer Korrektheit geschuldet, daß z. B. isiZulu und isiXhosa in Südafrika als zwei verschiedene Sprachen gelten, während es sich linguistisch gesehen – wie im Falle der ehemals Serbokroatisch genannten Sprache – auch „nur“ um verschiedene Varietäten einer (allerdings in der Vergangenheit schon aus Gründen der Apartheid nie als solche wahrgenommenen) einzigen Sprache handelt. Hier müssen auch die Aktivitäten christlicher Missionen erwähnt werden, verschiedene Denominationen durch unterschiedliche Normen z. B. bei der Bibelübersetzung quasi auseinander zu standardisieren. Versuche, das Ndebele, Swati (Swazi), Xhosa und Zulu in einem Nguni genannten Standard wieder zu harmonisieren (parallel dazu wäre dies auch für die Varietäten Pedi/Nord-Sotho, (Süd-)Sotho, und Tswana der Sotho-Gruppe machbar), sind derzeit noch zum Scheitern verurteilt, allerdings nicht aus linguistischen, sondern aus historischen, sozio-kulturellen, religiösen und vor allem politisch-ideologischen Gründen.
[17] Interessanterweise werden im anglophonen Raum die entstandenen und weiter entstehenden „New Englishes“ regional als neue Standards akzeptiert, während dies für den frankophonen Raum nicht gilt und das hexagonale Französisch das Maß aller Dinge bleibt.
[18] Es entstehen dadurch sehr komplexe und scheinbar widersprüchlich definierte Kommunikationslandschaften. So kann z. B. aus Sicht der Verbreitung und Nutzung des Tswana in Botswana dieser Staat als linguistisch relativ homogen gelten (da vermutlich mindestens 90 % der Bevölkerung sich dieser Sprache bedienen können), andererseits ergeben genauere Zählungen die Anwesenheit von mindestens 28 Sprachen (einschließlich Afrikaans und Englisch). Ähnliches gilt mutatis mutandis auch für die scheinbar monolingualen ex-kolonialen Mutterländer wie Frankreich, Großbritannien, Spanien etc., darunter auch Deutschland, selbst ohne Berücksichtigung ganz rezenter Immigration. Die vielfach postulierte oder auch nur implizierte sprachliche und kulturelle Homogeneität von „Nationalstaaten“ ist eher nationalromantischem Wunschdenken und Ideologie europäischer Provenienz des 19. Jahrhunderts geschuldet als der Analyse sprachsoziologischer Realitäten.
[19] Angaben zu Bevölkerungszahlen und Sprachen variieren z. T. beträchtlich je nach Quelle. In der folgenden Tabelle sind Bevölkerungszahlen und in Klammern gesetzte Maximalzahlen für Sprachen pro Staat der Internetversion des Ethnologue (www.ethnologue.com; letzter Zugriff am 10.09.2013) entnommen; die nicht in Klammern gesetzte und in der Regel geringere Zahl von Sprachen pro Staat gibt konservative Zählungen bzw. Schätzungen wieder. Die teilweise erheblichen Unterschiede bei der Zählung von Sprachen beruhen auf widersprüchlichen linguistischen und extra-linguistischen Kriterien der Abgrenzungen zwischen „Sprache“ und Sprachvarietäten (vulgo: Dialekten), insbesondere angesichts der Existenz von sogenannten Dialektkontinua, wie sie auch in Europa z. B. das westromanische, westgermanische, skandinavische, nordslawische und südslawische Dialektkontinuum darstellen, denen wir traditionell jeweils viele separate „Sprachen“ zurechnen nach dem Motto: a ‘language’ is a dialect with a flag, a national anthem, and a navy.
[20] Vgl. UNESCO Working Document, prepared for the INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE ON LANGUAGE POLICIES IN AFRICA, Harare 17.–21.03.1997 (unveröff. Arbeitsmaterialien).
[21] Eine wissenschaftspolitische Konsequenz war die Einrichtung von afrikanistischen Forschungs- und Lehreinrichtungen zur Ausbildung entsprechend qualifizierter Kolonialbeamter, wie z.B. an der School of Oriental and African Studies (SOAS) der Universität London oder am Orientalischen Seminar an der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität (heute Humboldt-Universität) in Berlin (ab 1887) bzw. am Seminar für Kolonialsprachen des Kolonialinstituts in Hamburg (ab 1908/09; die Gründung der Universität Hamburg erfolgte erst am 1. April 1919). Als zweitältester Standort in Deutschland scheint die Leipziger Afrikanistik (seit 1895 bzw. 1900) nicht schwerpunktmäßig an der kolonial-wissenschaftlichen Ausbildung beteiligt gewesen zu sein. – Es steht im Einklang mit der gänzlich anderen Kolonialpolitik Frankreichs und Portugals, daß die professionelle akademische Verankerung der wissenschaftlichen Beschäftigung mit afrikanischen Sprachen an Universitätsinstituten und Lehrstühlen in Frankreich zögerlich erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgt und dies in Portugal bis heute noch nicht verwirklicht ist.
[22] Kahombo MATEENE, Failure in the obligatory use of European languages in Africa and the advantages of a policy of linguistic independence, in: Reconsideration of African Linguistic Policies, Kampala 1980, S. 11-41, zitiert bei Hassana ALIDOU / Ingrid JUNG, Education Language Policies in Francophone Africa: What Have We learned from Field Experiences?, in: Steven BAKER (Hrsg.), Language Policy: Lessons from Global Models, Monterey 2002, S. 59-73, hier: S. 65.
[23] Statistische Angaben zu Ein-und Beschulungsraten allein sind wenig aussagekräftig. Bis zu 90 % der Schüler verlassen die Primarschule vorzeitig, die meisten haben eine oder mehrere Klassen mehrmals wiederholt. Im Extremfall verlängert sich eine Grundschulausbildung um 9 Jahre. (Staaten wie Niger „schönen“ inzwischen ihre Statistiken, indem das „Sitzenbleiben“ ausgeschlossen wird.) Nicht nur die Schulabbrecher sind nach Verlassen der Schule illiterat oder höchstens semiliterat (können aber viele Schulbuchtexte auswendig dahersagen, ohne sie je selbst gelesen haben zu können); sie sind zudem nicht in der Lage, Englisch oder Französisch so zu sprechen, geschweige denn zu schreiben, daß sie damit irgendeine Aussicht auf eine erfolgreiche Berufstätigkeit hätten. Paradoxerweise ist es der zu frühe Einsatz gerade des Englischen und Französischen als Unterrichtssprache, die diese negativen Folgen zeitigt, wie die verfügbare Fachliteratur eindeutig nachweist. Vgl. Hassana ALIDOU u. a., Optimizing Learning and Education for Africa – the Language Factor. A Stocktaking Research on Mother Tongue and Bilingual Education in Sub-Saharan Africa. Working Document Biennial Meeting of ADEA (27.–31. März 2006 in Libreville, Gabun).
[24] Gegner einer moderaten Indigenisierung afrikanischer Bildungssysteme werden nicht müde, deren Befürwortern just dies zu unterstellen. Beide „Lager“ im Disput sind dabei nicht immer frei von Unterstellungen bezüglich zumindest latenter neokolonialistischer Motivationen; vgl. stellvertretend die überzogene und sachlich angreifbare Polemik bei Johannes HARNISCHFEGER, Afrikanisierung und Nation-Building. Sprachpolitik in Südafrika. University of Leipzig Papers on Africa (ULPA), Politics and Economics 67, 2004.
[25] Vgl. auch dazu die Bestandsaufnahme Optimizing Learning and Education for Africa – the Language Factor (ADEA. 2006), darin insbesondere den Beitrag von Kathleen HEUGH über Cost Implications of the Provision of Mother Tongue and Strong Bilingual Models of Education in Africa.
[26] So verdankt das Englische in Namibia seinen Status als Amtssprache in erster Linie der Tatsache, daß es die Arbeitssprache der Befreiungsorganisation SWAPO im Exil war, ungeachtet der Tatsache, daß Englisch gegenüber etlichen in Namibia verbreiteten Erstund Zweitsprachen (neben indigenen Sprachen vor allem auch Afrikaans und Deutsch) eine viel geringere Sprecherzahl und kaum L1-Sprecher nachweisen kann. Für Südafrika ergibt sich eine interessante historische Umdeutung: Während das Englische noch im 19. Jahrhundert als Kolonialsprache und Mittel der Unterdrückung wahrgenommen wurde, insbesondere von Niederländisch und Afrikaans sprechenden Bevölkerungsgruppen, gilt es seit dem organisierten Widerstand gegen die Apartheidspolitik als Sprache der Befreiung (und war zugleich auch die Arbeitssprache des ANC). Andererseits wandelte sich das Ansehen des Afrikaans als identitätsstiftendes Vehikel des (burischen) Antikolonialismus zum verhaßten Symbol der Apartheidspolitik. Wie schon erwähnt, eignet Sprache sich prinzipiell nicht, als „neutrales“ Medium eingesetzt zu werden, schon aufgrund des historischen Wandels der Einstellungen von Bevölkerungsgruppen gegenüber bestimmten Sprachen. Interessanterweise verändern sich sogar die Inhalte von eingeführten Begriffen: Wurden im deutschen Sprachraum zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter „Kolonialsprachen“ noch die Sprachen der Kolonisierten verstanden (ähnlich wie „Kolonialwaren“ die Produkte aus den Kolonien bezeichneten), verstehen wir heute unter „Kolonialsprachen“ (bzw. Ex-Kolonialsprachen) das Englische, Französische, aber auch das Deutsche usw., also die Sprache der Kolonisatoren.
[27] Das herausragende Beispiel für eine Reflexion dieses Ansatzes in der Verfassung liefert das Post-Apartheid Südafrika, das in Übereinstimmung mit den Prinzipien des OAU Language Action Plan for Africa 11 offizielle Sprachen anerkennt: Neben Englisch und Afrikaans sind dies die 9 afrikanischen Sprachen der sogenannten Nguni-Gruppe einerseits (isiNdebele, siSwati, isiXhosa, isiZulu) und der Sotho-Gruppe andererseits (Sepedi, Sesotho, Setswana) sowie das Xitsonga und das Tshivenda. Bezeichnenderweise wird der Begriff der „Nationalsprache(n)“ vermieden, da keine der 11 Sprachen allein als Symbol „nationaler Identität“ gelten kann.
[28] Vgl. WORLD BANK. In Their Own Languages. Education for All. Education Notes 2005.
[29] UNESCO, The Contribution of Education to Cultural Development, Working Paper for the International Conference on Education (14.–19. September 1992), Genf 1992, S. 7.
[30] So war kürzlich einem Leserbrief an eine tansanische Zeitung zu entnehmen, daß an einer bestimmten Sekundarschule des Landes vom Schulleiter selbst in seinem Kollegium von 45 Lehrern nur 3 identifiziert wurden, die Englisch gut verstehen und korrekt sprechen konnten. Die Leserbriefschreiberin, eine engagierte Kollegin von der Universität in Daressalaam, kommt zu dem Schluß, daß unter den z. B. in Tansania vorherrschenden Bedingungen „The use of English as a medium actually defeats the whole purpose of teaching English language.“ Ihre fachkundige Empfehlung lautete: „The … way to eliminate the incorrect English is not to use it as medium of instruction.“ In der Tat wird immer wieder übersehen, daß schlecht ausgebildete Lehrer, und das bezieht sich auch und vor allem auf deren eigene (zumeist mangelhaften) Kenntnisse in der Unterrichtssprache, natürlich nicht in der Lage sind, ihren Schülern zum einen korrektes Englisch, zum anderen Bildungsinhalte teilweise sehr komplexer Natur in dieser Sprache beizubringen. Die Lehrkräfte sind daher gezwungen (und oft auch zu nichts anderem in der Lage), ineffiziente Unterrichtsmethoden des Frontalunterrichts (safe talk, chalk and talk, etc.) ohne Schulbücher vor in der Regel völlig überfüllten Klassen anzuwenden. Es kann daher niemanden verwundern, daß die in englischer Sprache durchgeführten und damit zugleich die sprachlichen Fähigkeiten der Schüler bewertenden Examina, z. B. auch und gerade in Mathematik und den Naturwissenschaften, katastrophale Ergebnisse zeitigen, die wiederum zu enorm hohen Abbruchquoten und Klassenwiederholungen führen.
[31] ALEXANDER, An African Renaissance, S. 3.
[32] Ebd., S. 5.
[33] Ayo[rinde] BAMGBOSE, Language and Exclusion. The Consequences of Language Policies in Africa, Münster – Hamburg – London 2000, S. 110.
[34] Ebd, S. 88: „Nach Jahren der Indoktrination haben die Menschen inzwischen die Auffassung entwickelt, daß ‚richtige‘ Bildung nur durch eine Weltsprache wie Englisch vermittelt werden kann. Selbst die Idee, daß ein Kind in den ersten Schuljahren nur davon profitieren kann, wenn die Grundschulerziehung in der Muttersprache erfolgt, wird von vielen sogenannt gebildeten Eltern angezweifelt. Hier sind zweifellos Ignoranz und Vorurteile am Wirken, und ein wesentlicher Aspekt der Umsetzung einer Sprachpolitik, die den Gebrauch der indigenen Sprachen im Unterricht vorsieht, muß eine Aufklärungskampagne sein mit dem Ziel, Laien mit den Argumenten für eine solche Politik vertraut zu machen“ (Übersetzung des Autors).
[35] Kenntnis afrikanischer Sprachen ist in der Regel kein berufliches Qualifikationsmerkmal. Berühmt-berüchtigt ist der vielfach kolportierte Fall der Bewerbung eines (schwarzen) Südafrikaners auf die Stelle eines „bilingualen“ Mitarbeiters bei dem Radio- und Fernsehsender SABC. Der Bewerber beherrschte etliche Sprachen in Wort und Schrift und wurde dennoch nicht eingestellt, weil er nicht „bilingual“ war – im Sinne von Englisch und Afrikaans. Seine hervorragenden Kenntnisse in mehreren afrikanischen Sprachen zählten nicht. Ähnliches gilt bis heute im Sonderfall Kamerun, das gleich durch zwei ex-koloniale Staatsfremdsprachen charakterisiert wird: „Bilingualismus“ als Bildungsziel wird hier verstanden als Beherrschung von Französisch und Englisch, den beiden Amtssprachen; die mehr als 250 indigenen Sprachen zählen nicht. In Kenia ergab sich eine sprunghaft steigende Nachfrage nach universitären Swahili-Kursen, als Kenntnis dieser Sprache zur Einstellungsqualifikation für Positionen im öffentlichen Sektor wurde (Professor Okoth OKOMBO [pers. Mitteilung]). In Südafrika beklagen Universitäten nach großem Zulauf in der anfänglichen Euphorie der Post-Apartheid inzwischen dramatisch sinkende Studentenzahlen für die 9 afrikanischen Amtssprachen, da diesen in der öffentlichen Wahrnehmung kein faktischer Marktwert in der Post-Apartheid-Gesellschaft zuzukommen scheint.
[36] Allerdings kommen die indigenen Sprachen in Mbekis Reden über die African Renaissance nicht vor, und bei öffentlichen Auftritten vermeidet er es, wie schon sein Vorgänger Nelson Mandela, sich afrikanischer Sprachen zu bedienen. Vgl. H. Ekkehard WOLFF, Convener’s Introduction: The Vision of the African Renaissance, in: Ders. (Hrsg.), Tied Tongues. The African Renaissance as a Challenge for Language Planning, Münster – Hamburg – Berlin 2002, S. 1-19.
[37] Dazu ALEXANDER, An African Renaissance, S. 1-12.
[38] Vgl. H. Ekkehard WOLFF, Multilingualism, Modernisation, and Mother Tongue: Promoting Democracy through Indigenous African Languages, in: ALEXANDER (Hrsg.), Language and Development, S. 31-50.
[39] UNESCO/CONFINTEA, Adult Education: The Hamburg Declaration. The Agenda for the Future. Fifth International Conference on Adult Education 14–18 July 1997. Hamburg 1997, S. 16.
Zitation
H. Ekkehard Wolff, Die afrikanischen Sprachen im 21. Jahrhundert. Herausforderungen an Politik und Wissenschaft , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/die-afrikanischen-sprachen-im-21-jahrhundert