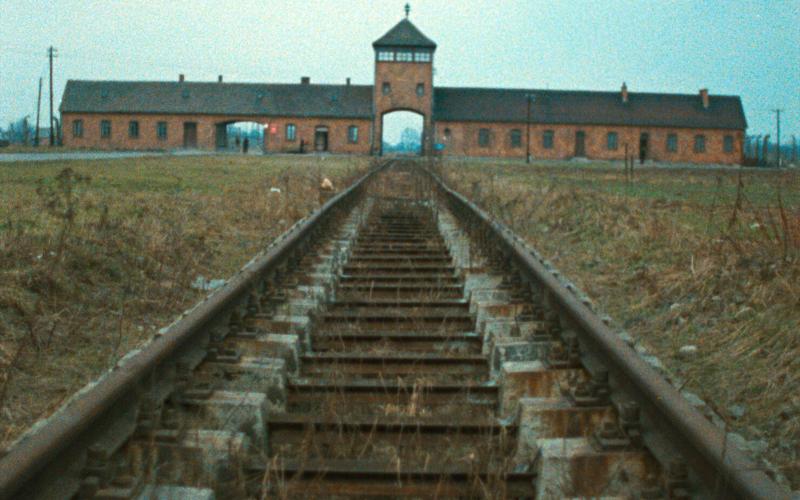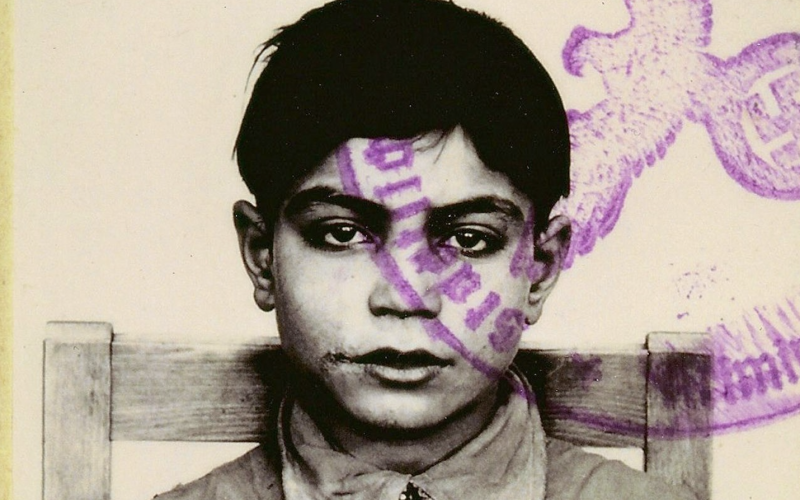Gezeigt wurde der Film, der nun an den Start geht, im Februar 2025 während der Berlinale im Rahmen von Berlinale Special. Schon der Titel macht neugierig, lockt möglicherweise gerade jene, die als Provenienzforscher und -forscher auf der Suche nach geraubten, entzogenen, abgepressten Kunstwerken sind. Allerdings geht fehl, wer hier einen detektivischen Plot um das Thema Bedrängung, Verfolgung, Beraubung und oft auch Ermordung von Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus erwartet.
Um den im Filmtitel genannten großen Leibniz gleichwohl geht es selbstverständlich.
1646 in Leipzig geboren, 1716 in Hannover verstorben, Philosoph, Mathematiker, Jurist, Historiker, Aufklärer, universaler Geist seiner Zeit. Leibniz ist seit nunmehr 30 Jahren Namensgeber für die Leibniz-Gemeinschaft, in der an die 100 Forschungsinstitute und Forschungsmuseen vereint sind, darunter das Museum für Naturkunde in Berlin, das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremen oder eben das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF), auf dessen Fachportal zeitgeschichte | online Sie diesen Text gerade lesen.
Er war ebenso Namensgeber für die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover und dies nicht ohne Grund. Hier wird der Leibniz-Briefwechsel verwahrt, im beeindruckend-opulenten Umfang von rund 15.000 Briefen von und an Leibniz, Briefe, die dieser mit rund 1.100 Korrespondentinnen und Korrespondenten aus allen wichtigen Bereichen der Wissenschaft wechselte. Dies ergibt im Laufe von 50 Jahren studierten, forschenden, tätigen Lebens jährlich an die 300 Briefe, die ihren Adressaten oder ihre Adressatin wechselten. An nahezu jedem Tag im Kalenderjahr war somit ein Brief unterwegs, entweder zu Leibniz hin oder als Antwort von diesem hinaus in die gelehrte und wissbegierige Welt.
In Hannover trat Leibniz nach mehrjährigem Aufenthalt u.a. in Paris 1676, als Dreißigjähriger, die Stelle des Bibliothekars der Herzoglichen Bibliothek am Hof des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg an. Hier wurde er etwa zwei Jahre darauf zum Hofrat ernannt: Für ihn letztlich die „beste aller Möglichkeit“, Einfluss auf die Geschehnisse seiner Zeit zu nehmen. Hier erging Leibniz sich im Herrenhäuser Garten. Dieser war für ihn, der wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung dieses berühmten Barockgartens nahm, ebenso Refugium wie philosophischer Ort, an dem er die Vielgestaltigkeit der Natur, der Pflanzen, Bäume und Blumen studierte. Der Garten als Ort des Erkenntnisgewinns über die Vielfalt und Individualität der Natur und somit auch die des Menschen.
In Edgar Reitz’ Film erscheint dieser Garten als einziger Ort im Draußen. Immer wieder sind Sichtachsen des Gartens zu sehen, und Leibniz, im wandelnden, besinnlichen Gespräch mit Kurfürstin Sophie von Hannover, gespielt von Barbara Sukowa mit ihrer wunderbar charakteristischen, besonderen Stimme, in minimalistischer und doch sprechender Mimik.
Sonst aber entfaltet sich die Handlung wie ein Kammerspiel, findet ausschließlich in Innenräumen statt. Sie startet mit einer Korrespondenz, fokussiert sich zunächst auf eine Persönlichkeit im geistigen Austausch mit Leibniz, auf Sophie Charlotte von Hannover, Kurfürstin von Brandenburg, Königin in Preußen, Tochter der Kurfürstin von Hannover. Gerade einmal 36-jährig wird sie sterben, womit ihr Dialog mit Leibniz endet und ein Schlussakkord in dem Film von Edgar Reitz gesetzt sein wird.
Mit ihrem Wunsch nach dem Bildnis ihres geliebten, geschätzten, zutiefst verehrten Lehrers Leibniz, formuliert in einem Brief an ihre Mutter, in Szene gesetzt als Zitieren eben dieses Briefes, als Nahaufnahme, quasi dokumentarisch, beginnt eine intensive Erzählung um künstlerische Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Einmaligkeit und Identität, auch – erstaunlich modern – um das geistige und künstlerische Potential und die Ebenbürtigkeit von Frauen, die für Leibniz, so die filmische Interpretation, ganz außer Frage stand.
Als Subtext mag man neben der Sehnsucht nach intellektuellem Austausch eine tiefe Zuneigung, vielleicht auch liebende Schwärmerei mitlesen, bedingt oder befördert durch eine aus politischen Erwägungen arrangierte Zweckehe Sophie Charlottes mit dem bereits einmal verwitweten, neun Jahre älteren Kurprinzen Friedrich von Brandenburg (1657–1713), der sich 1701 als Friedrich I. zum König in Preußen erheben lassen wird. Historikerinnen und Historikern wird man die Klärung einer vermuteten Differenz zwischen dem eher „unkultivierten“, soldatischen Preußen und dem kultivierteren „Kurhannover“ überlassen können.
Reitz’ Film ist text-, sprach-, wortintensiv. Das von Kurfürstin Sophie von Hannover auf den sehnlichen Wunsch ihrer Tochter in Auftrag gegebene Bildnis von Leibniz mündet in zahlreiche Sitzungen. Diese Sitzungen aber werden zu witzigen, ironischen, tiefsinnigen, lebensklugen Disputen. Dabei spielt Reitz damit, Leibniz mit zwei sehr verschiedenen Charakteren und Weltsichten zu konfrontieren. Oder auch, spiegelbildlich gedacht, zwei sehr verschiedene Charaktere, sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen und Lernhorizonte mit Leibniz in Beziehung zu setzen. Zunächst ist da der von Sophie Charlottes Mutter eingeladene Pierre-Albert Delalandre: Nach eigenen Worten berühmt und geschätzt an allen Höfen Europas. Selbstzufrieden, selbstverliebt, selbstsicher, sehr eitel und dennoch durch Leibniz Fragen und Betragen so leicht zu verunsichern.
Weitsichtig hat Delalandre das von der Kurfürstin bei ihm bestellte Porträt, welches Leibniz zeigen soll, bereits vorbereitet. Wahlweise kann er es in Braun oder anderem Kolorit anbieten, mit dunklem Haar oder wallender, silbergrauer Perücke. Diese sei selbstverständlich sorgfältigst gestaltet, mit teurem Marderhaarpinsel, ob von ihm selbst oder nicht eher einem seiner zahlreichen Assistenten, sei hier dahingestellt. Nur das Gesicht eben von Leibniz muss noch eingefügt werden in das so vollkommen und klug Vorbereitete. Der Malerkittel wird angelegt wie eine Rüstung, das Inkarnat wird nach des Meisters Angaben auf der Palette vorbereitet, sein hoheitliches Wirken von schrecklich eintöniger, Schmerzen bereitender Flötenmusik begleitet. Allein: Leibniz weiß die Ehre, Delalandre Modell zu sein, nicht zu schätzen. Es hält ihn nicht auf der Fußbank, die ihn doch erhöhen soll. Sein Gesicht ist gar zu lebendig. Ständig denkt er, was den Ausdruck der Augen verändert, lächelt gar, stellt Fragen, philosophiert. Und so sucht Delalandre, von Lars Eidinger mal blasiert, mal irritiert, immer aber für die Zuschauer vergnüglich interpretiert, empört, missachtet und missverstanden, das Weite.
Die Kurfürstin muss erneut für die Malsession werben, Leibniz an die Mühsal eigenen Modellsitzens erinnern, ihn zu einem neuen Versuch ermuntern. Launig gibt sie dabei preis, dass manches Porträt von ihr gefragter war als sie selbst, dass Modellsitzen oder -stehen nun mal kein Zuckerschlecken sei.
Der neue Versuch startet mit dem Maler Van De Meer aus Delft. Der Name bezeugt es und die Kurfürstin spricht es aus: Es handelt sich um eine Eroberung aus Holland, auf die die Kurfürstin stolz ist. Die Farben, das Licht, das Modellstehen – alles im Atelier verändert sich. Und aus dem Maler mit dem assoziationsreichen Nachnamen, mit dem dieser auch spielt, zu dem er die Geschichte auftischt, seine Mutter könne die Muse des berühmten Jan Vermeer gewesen sein, wird im Laufe der Dialoge Aaltje Van De Meer. Eine Malerin, die ihr Werk versteht, wenn sie auch kein Zunftmitglied ist, denn in der Zunft sind Frauen nicht gelitten. Nichts Äußerliches, Vordergründiges hat sie vorbereitet. Den Einfall des Lichtes beobachtet sie. Rembrandt erwähnt sie, Caravaggio. Kennenlernen möchte sie Leibniz, um zu verstehen, welches Bildnis zu entwerfen wäre. Und dieser erzählt: Aus der Kindheit, vom strengen, fordernden, liebenden Vater, von dem Wissen der Welt in den Büchern. Er erlaubt ihr Einblicke in seine Seele. Die Gespräche mit ihm begleiten sie gedanklich bis in den Schaf.
Kurz vor dem Ende des Films, Van De Meers Bildnis von Leibniz ist fast vollendet, scheint ein Blick auf dieses möglich – und wird der Betrachterin, dem Betrachter dann doch nicht gewährt. Zu keiner Zeit des Filmes war der Zuschauerin, dem Zuschauer ein fertiges, vollendetes Bildnis präsentiert. Nicht von Delalandre, der die Flucht ergriff, seine vorbereiteten Leinwände mitnahm und gewiss an anderem Ort gewinnbringender einzusetzen verstand. Und auch nicht von Aaltje, die ihr Werk zerstört, als jene, für die das Bildnis in Auftrag gegeben war, unerwartet und viel zu früh verstirbt. Festgehalten in einer eher exaltierten Szene, hinterließen Abruptheit und Unvermitteltheit dieser zerstörenden Aktion bei der Rezensentin Irritation.
Auch im Abspann ist das Bildnis, das für einen Moment noch einmal aufzuscheinen scheint, nicht wirklich zu sehen, obgleich wir auf die Rückseite einer Leinwand schauen, durch die sich allmählich Leibniz’ Gesicht abzeichnet. Aber nein. Natürlich ist auch dies nicht Leibniz‘ Gesicht. Es ist das Gesicht von Edgar Selge, der im Film klug, wunderbar, subtil und ironisch Leibniz verkörpert, der mit mal stärkerer, oft minimaler, immer aber sprechender Mimik die Rolle ausfüllt. Sein Leibniz verlässt zu einem letzten, abschließenden Gespräch den Raum Richtung Garten, um beim nachdenklich-intimen Spaziergang die letzte und schwerste Frage der Kurfürstin Sophie zu beantworten: Hat Gott ihn, Leibniz, je enttäuscht? Und Leibniz antwortet mit einem einfachen „Nein“. Gott könne dies gar nicht. Gott habe die beste aller Welten geschaffen. Das Unvollkommene, das Böse, das Leid aber sind nicht Teil des göttlichen Schöpfungsaktes, sondern eine unvermeidliche Folge der menschlichen Wahlfreiheit zwischen dem Guten und dem Bösen. Um dieser gewollten Freiheit willen, lässt Gott das ungewollte Leiden zu.
Edgar Reitz’ Film über Leibniz ist auch in und mit diesem abschließenden Dialog ein Alterswerk, eine sehr versöhnliche Interpretation in einer damals wie heute oft als unversöhnlich und unerträglich wahrgenommenen Welt.
Die Komplexität des Universalgenies Leibniz, der Anspruch, diesem, und sei es ansatzweise, gerecht zu werden, bewirkt eine große Informationsdichte des Films. Die Bildsprache erinnert oft weniger an einen klassischen Spiel-, als vielmehr an einen Dokumentarfilm, was ja auch gar nicht abwegig oder verwunderlich erscheint, wechseln sich in Reitz’ Lebenswerk doch Spiel- mit Dokumentarfilmen ab. Eine Vielzahl von Details wird eingefangen, findet Eingang in die Dialoge und die filmische Erzählung: wir erfahren von den Komponenten, aus denen Inkarnat gemischt wird, jener Farbton, mit dem Malerinnen und Maler die Hautfarbe des Menschen wiedergeben, und der zusammengesetzt wurde aus Rot und Weiß, aus Ocker, Siena und anderen Braun-, manchmal auch Blau- und Grüntönen. Wir staunen über die Verwendung von Schweineblasen zum Aufbewahren und vor allem zum sparsamen Einsatz teurer Farben, von Lapislazuli etwa, jenem tiefblauen Gestein, welches schon im alten Ägypten und Mesopotamien für die Schmuckherstellung verwendet wurde und das als zerriebenes Mineral seit dem 9., 10. Jahrhundert auch in der Malerei Verwendung fand. Wir hören von all den unglaublichen Entdeckungen, die auf Leibniz zurückgehen: das erste funktionsfähige Modell einer Rechenmaschine, welches er 1673 in London der Royal Society vorstellte, leider und zum großen Kummer von Leibniz mit Fehlern behaftet, das binäre Rechnen mit 0 und 1, auf dem die heutige Computertechnik gründet, vertikale Windmühlen, die zur Entwässerung von Bergwerkstollen im Harz dienen sollten, die Brandkassen als Beginn des Versicherungswesen, die Schmerzzwinge, mit der Leibniz die eigene Gicht bekämpfte. 24.000 Notizzettel füllten all die Gedankensplitter, Ideen, Vorhaben, die Leibniz gedanklich-sprachlich formulierte, und die sein treuer Helfer Liebfried Cantor sorgsam und dienend notierte. Aufgereiht auf einer langen Stange, verzettelt, verwahrt in einem Nebengemach, präsentiert Liebfried Van de Meer stolz die Vielzahl all dieser Ideen, die Leibniz hinwarft und er aufschrieb und damit bewahrte.
Auch die Kränkungen, die der große Universalgelehrte im Laufe seines 70-jährigen Lebens erfährt, klingen im Film an: in London, in Berlin, in St. Petersburg, und dann auch in Wien. Die Wiener Begebenheit setzen Edgar Selge als Leibniz und Michael Kranz als Cantor nahezu komödiantisch in Szene. Wohl darf Leibniz dem Kaiser vorstellig werden. All seine Aufmerksamkeit aber hat der Hofetikette, der richtigen Anzahl an Bücklingen, dem rechten Abstand zum Kaiser zu gelten. Und sehr schnell und ganz gewiss beginnt er diesen mit seinen klugen Ausführungen zu langweilen, wird wie ein lästiges Insekt hinweggescheucht, was seinen treuen – und fiktiven – Diener zutiefst empört.
Jeder wird im Film von Edgar Reitz’ Eigenes und Besonderes entdecken können: der Philosoph und Historiker den Philosophen und Entdecker Leibniz, die künstlerisch Tätigen die Wunder und die Grenzen der Malkunst, die an feministischen Aspekten Interessierten eine Emanzipationsgeschichte der Frauen, als Geschichte mitgestaltende, mit Philosophen mithaltende Gesprächspartnerinnen, als in den Zünften nicht tolerierte, dabei aber nicht weniger talentierte Malerinnen. Und die sozial Fühlenden oder sozialhistorisch Denkenden werden die immense Bedeutung all der im Laufe der Jahrhunderte zahl- und oft namenlosen Gehilfinnen und Gehilfen sehen, ohne die die Fülle des von Einzelnen Gedachten, Geleisteten und Geplanten nie so umfänglich entstanden und so sorgfältig überliefert worden wäre.
So ist Edgar Reitz’ Film ein intellektuelles Feuerwerk, sinnliche Entdeckung, humor- und geistvoller Dialog. Und eher der Anfang als ein Abschluss in der Beschäftigung mit Leibniz und dessen Universalität.
Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes
Regie: Edgar Reitz
Kinostart: 18. September 2025
Trailer auf YouTube
Zitation
Regine Dehnel, Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes. Ein filmisches Kammerspiel von Edgar Reitz, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/leibniz-chronik-eines-verschollenen-bildes