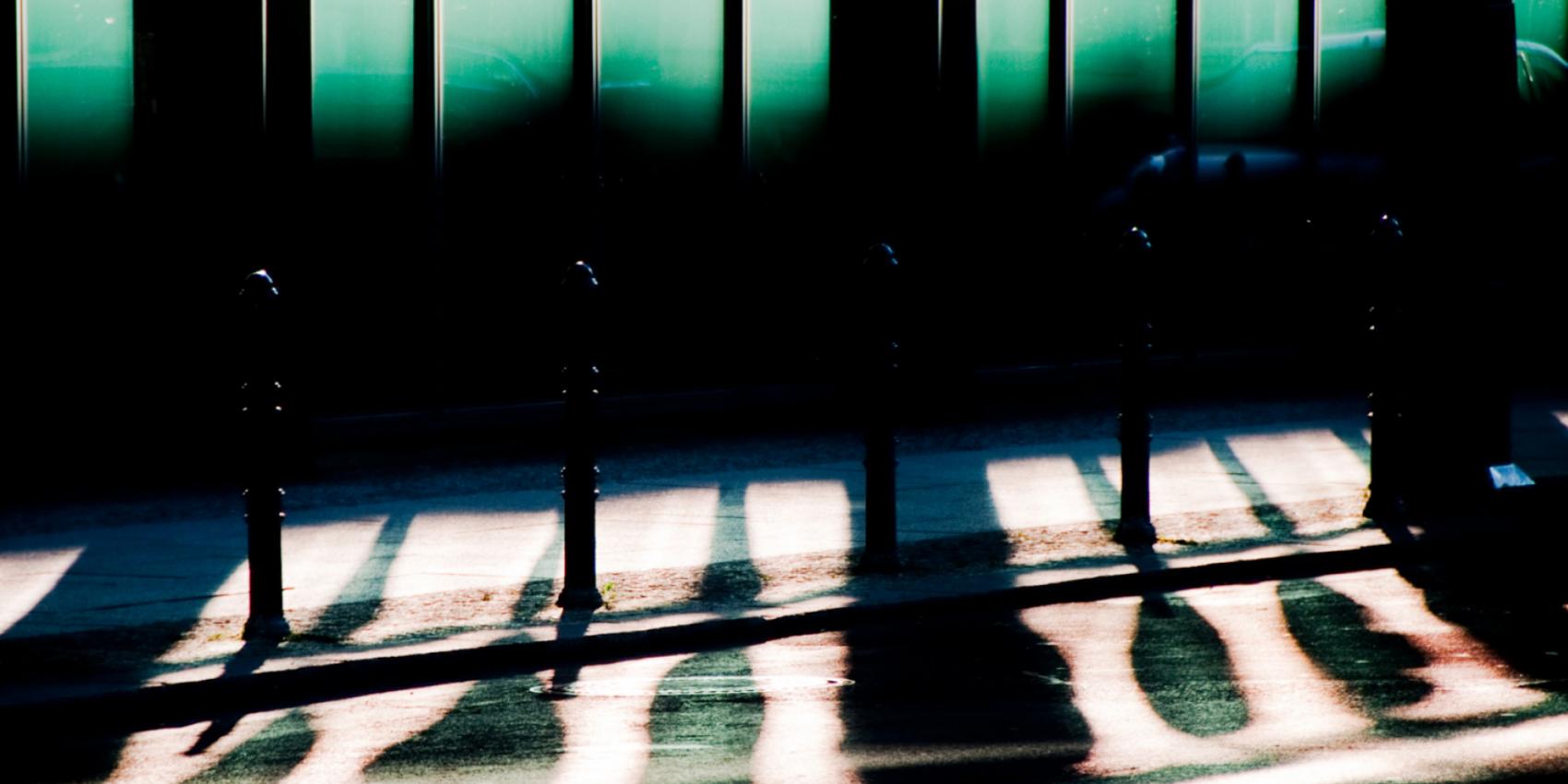Die Stunde der Historiker-Kommissionen
Mitte der Nuller Jahre begann die später so bezeichnete „Take-off“-Phase der historischen Kommissionsforschung.[1] Es war die sogenannte „Nachrufaffäre“ im Auswärtigen Amt, die dafür den entscheidenden Anstoß lieferte. Als erster Außenminister einer rot-grünen Bundesregierung berief Joschka Fischer 2005 eine Kommission ein, die sich mit der Geschichte des alten und neuen Außenministeriums befassen sollte. Begleitet von lebhaften Protesten noch aktiver und pensionierter Diplomaten, legte diese ihre Ergebnisse fünf Jahre später einer breiteren Öffentlichkeit vor. Die Untersuchung, publiziert in einem bekannten Publikumsverlag, löste damals eine hitzige Debatte aus. Vordergründig schien sich die Kontroverse vor allem an einer umstrittenen Deutung der NS-Geschichte entzündet zu haben. Angesichts auch zivilrechtlich geführter Attacken[2] gegen das Buch drängte sich jedoch im Nachhinein der Eindruck auf, als ob es einem Teil der Kritiker*innen auch darum ging, eine als anstößig empfundene Erzählung zur Geschichte der alten Bundesrepublik, ihrer Institutionen und Funktionseliten zurückzuweisen.
Trotz aller Unterschiede im Detail avancierte die AA-Historikerkommission aufgrund ihres mehrköpfigen Formats und des gewählten epochenübergreifenden Forschungsdesigns rasch zum Modell für zahllose weitere Kommissionsgründungen. Insofern schlug nun tatsächlich, wie Axel Schildt meinte, die „Stunde der Kommissionen.“[3] Innerhalb weniger Jahre wurden nach dem Vorbild der UHK etwa zwanzig historische Forschungsprojekte initiiert, die sich mit der Geschichte bundesdeutscher Ministerien und Behörden sowie mit deren Vorgängerinstitutionen im „Dritten Reich“ beschäftigten.[4] Sowohl in der thematischen Spannbreite als auch in der ressourcenmäßigen Ausstattung variierten die staatlich geförderten Projekte zum Teil beträchtlich: Während einige Auftragnehmer mit einer fünfstelligen Summe auskommen mussten, stand der etwa 20-köpfigen Kommission zur Geschichte des Reichs- bzw. Bundeswirtschaftsministeriums ein mehrfacher Millionenbetrag zur Verfügung.[5]
Auf den ersten Blick fügte sich der nun einsetzende Boom der „Behördenforschung“ in längerfristige Entwicklungstrends ein. So hatten insbesondere das Ende des Kalten Kriegs und das Zwei-Plus-Vier-Abkommen vom September 1990 dazu geführt, dass eine Reihe völkerrechtlicher, humanitärer und moralpolitischer Fragen, die durch den Ost-West-Konflikt mehr als vierzig Jahre lang eingefroren oder überlagert worden waren, unversehens neue Aktualität und Relevanz erhielten. Unter dem Druck der amerikanischen Clinton-Regierung, die sich Mitte der 1990er Jahre in die Debatten um unerledigte Ansprüche von NS-Opfern einzuschalten begann[6], gaben damals einige führende deutsche Finanz- und Industrieunternehmen größere historische Forschungsprojekte in Auftrag. Konfrontiert mit einer aus den USA heranrollenden Klagewelle und damit assoziierten weltweiten Image-Schäden, beteiligte man sich außerdem nolens volens an einem 1999 eingerichteten Entschädigungsfonds für NS-Zwangsarbeiter*innen, dessen Finanzierung zu gleichen Teilen von der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand bestritten wurde.[7]
Sprach also die chronologische Abfolge dafür, die staatliche Behördenforschung als Nachfolgerin jener frühen privatwirtschaftlichen Projekte zu sehen, lassen sich auch Anhaltspunkte nennen, die auf ein Phänomen sui generis deuten. So springt bei näherer Betrachtung ins Auge, dass die kritische Unternehmensforschung der 1990er Jahre damals weitgehend an den Bundesministerien und -behörden vorbeilief und dort keinerlei erkennbare Bemühungen zu kritischer historischer Selbstbefragung auslöste. Auch Medien und Geschichtswissenschaft forderten dies seinerzeit nicht ein, obwohl bereits die weitgehend ausgebliebene staatliche Wiedergutmachungspraxis gegenüber großen Gruppen von NS-Geschädigten dazu hätte Anlass geben können. Insofern macht die Kontroverse um das Auswärtige Amt deutlich, dass die behördliche Aufarbeitungswelle nicht, wie oft behauptet, durch beispielgebende Vorbilder, sondern durch einen einzelnen vergangenheitspolitischen Skandal ins Rollen kam, der sich außerhalb der Parameter wissenschaftlicher Selbstverständigung abspielte. Für den Faktor der Kontingenz spricht im Übrigen auch, dass sich das seinerzeit von einem Ex-Grünen geführte Bundesinnenministerium noch 2005 der Erforschung seiner Erblasten mit der paradoxen Behauptung verweigert hatte, als 1949 gegründete Behörde verfüge man über keine „nationalsozialistische Vergangenheit“, die einer „Aufarbeitung“ bedürfe.[8]
Wie schon mehrfach von verschiedenen Autor*innen betont, ist die frühere Ambivalenz inzwischen einer breit verankerten behördlichen Aufarbeitungskultur gewichen. Die Dynamik der Forschungskonjunktur ist enorm, sodass einzelne Historiker*innen mittlerweile davor warnen, keinem falschverstandenen Hang zur Vollständigkeit nachzugeben. Da es inzwischen kaum noch Institutionen und Lehrstuhlinhaber*innen im Bereich der Zeitgeschichte geben dürfte, die nicht in der einen oder anderen Weise in die Behördenforschung involviert sind, werden Forderungen nach verstärkter professioneller Selbstreflexion laut.[9] Ausgehend von dem Befund, dass sich die komplexen Mischungsverhältnisse des Wandels und der Kontinuität mit den Instrumenten aggregierter kollektivbiographischer Studien kaum angemessen erfassen lassen, wird zudem auch immer wieder die Anschlussfähigkeit und Innovativität des gesamten Forschungsfeldes in Frage gestellt.[10] Obwohl es sich dabei um einen Kritikpunkt handelt, der den wissenschaftlichen Ertrag der Behördenforschung mit einem grundsätzlichen Fragezeichen versieht, fielen die zünftigen Reaktionen darauf allerdings bislang eher verhalten bis indifferent aus.
An diesem Punkt möchte der folgende Beitrag ansetzen, indem er zwei Argumente zur Diskussion stellt. Zum einen soll kurz begründet werden, warum die vorgebrachte Kritik am mangelnden Innovationspotential der Behördenforschung zumindest teilweise auf einem Missverständnis beruht. Denn tatsächlich, so die erste These, strebten und streben die meisten laufenden behördlichen Forschungsprojekte keine Neuvermessung der Geschichte der Bundesrepublik an. Vielmehr bewegen sie sich größtenteils in den bekannten Bahnen einer bundesdeutschen Erfolgs- und Ankunftsgeschichte, die beansprucht, den bereits erreichten Kenntnisstand durch differenzierende Konzepte und Zugriffe zu erweitern.[11] Unter Rückgriff auf das seinerzeit von ihm selbst vorgeschlagene Konzept einer „Belastungsgeschichte“ hat daher der verstorbene Axel Schildt den Stand der Behördenforschung mit der ironisch-lakonischen Bemerkung bilanziert, es sei alles noch „viel schlimmer gewesen“ als ursprünglich gedacht.[12] Zwar mag diese Charakterisierung überspitzt erscheinen. Eine kritische konzeptuelle Selbstbefragung ist allerdings nicht nur wegen der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Krisenerscheinungen überfällig. Insofern – und dies wäre die zweite These – muss sich die neue Behördenforschung vermehrt für neuere mikrohistorische Ansätze der Mentalitäts-, Emotions-, Intellektuellen- und Moralgeschichte öffnen und auch transnationale Einflüsse stärker als bisher berücksichtigen, wenn sie der Wahrnehmung einer selbstgenügsamen „Nazizählerei“ und dem Vorwurf methodologischer Saturiertheit entgehen will. Dazu will dieser Beitrag am Ende noch einige konstruktive Vorschläge besteuern.
Vom „Wirtschaftswunder“ zum „Demokratiewunder“: Meistererzählungen der Bundesrepublik-Forschung
Ein oft vorgebrachtes Argument im Zusammenhang mit der neuen Behördenforschung ist, jene habe im Grunde kaum neue Ergebnisse zu Tage gefördert. So wurde beispielsweise auf dem Höhepunkt der aktuellen Forschungskonjunktur wiederholt daran erinnert, dass das Phänomen der Elitenkontinuität bereits unmittelbar nach dem Krieg im Fokus der damals aufblühenden, anwendungsbezogenen amerikanischen Politik- und Sozialwissenschaften gestanden habe. In den 1950er und 1960er Jahren seien es dann bekannte Forscher wie Ralf Dahrendorf, Wolfgang Zapf und Theodor Eschenburg gewesen, die sich intensiv mit dem Sozialprofil und den Ausbildungswegen der höheren Beamtenschaft in Deutschland auseinandergesetzt hätten. Und schließlich habe auch die DDR mit ihren propagandistischen Attacken dazu beigetragen, die Problematik einer hochgradig belasteten Ministerialbürokratie nachhaltig im öffentlichen Bewusstsein zu verankern.[13]
So zutreffend diese Hinweise auch zum Teil sein mögen, so sind sie doch zugleich unscharf, vage und in ihrer Pauschalität auch ahistorisch. Vor 1989 konnte sich auch deswegen keine fachwissenschaftliche Debatte über die Rolle der Beamtenschaft im „Dritten Reich“ und die damit verbundenen Nachwirkungen im bundesrepublikanischen öffentlichen Dienst entwickeln, weil das Thema aufgrund von Restaurationsvorwürfen und einer tagespolitisch-publizistischen Skandalisierung von Einzelfällen einer mehr oder weniger rigiden Tabuisierung und interessengesteuerten Perspektivverengung unterlag. Die junge bundesdeutsche Zeitgeschichtsforschung, dies kann man trotz aller darin liegenden Verallgemeinerungen sagen, fühlte sich für die Thematik der NS-Kontinuitäten anfangs überhaupt nicht und später allenfalls in einem indirekten Sinn zuständig. Die sehr klaren, bereits 1953 getroffenen historischen Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts, der zufolge die Beamtenverhältnisse nach 1933 in ihrer Gesamtheit in ein Dienst-, Treue- und Unterverwerfungsverhältnis zum „Führer“ überführt wurden und deshalb zwingend am 8. Mai 1945 erloschen seien, verhallten somit in der Zunft größtenteils ungehört. Auch die Theorie- und Methodenangebote, die die amerikanische, größtenteils von deutschen Emigranten getragene sozialwissenschaftliche Elitenforschung zur Verfügung stellte, wurden nicht aufgegriffen.[14]
Spätestens seit Beginn der 1960er Jahre waren die personellen Kontinuitäten vom „Drittem Reich“ zur Bundesrepublik für jedermann offenkundig, sodass zu Selbstzufriedenheit eigentlich kein Anlass bestanden hätte. Hinzu kam, dass Karl-Dietrich Bracher in seiner fulminanten strukturgeschichtlichen Analyse zur „Auflösung der Weimarer Republik“ die Belastungen, die der ersten deutschen Demokratie durch eine vordemokratische Beamtenschaft erwachsen waren, in aller Deutlichkeit benannt hatte.[15] In der nun langsam einsetzenden Bundesrepublik-Forschung hinterließ dies jedoch kaum nachweisbare Spuren. Stattdessen formierte sich vor dem Hintergrund des Jerusalemer Eichmann-Prozesses ein einflussreiches Netzwerk aus konservativen politischen Beamten und Historikern des Münchner Instituts für Zeitgeschichte (IfZ), dies unter anderem zu dem Zweck, Adenauers graue Eminenz vor den zu Recht befürchteten vergangenheitspolitischen Angriffen aus dem Ostblock in Schutz zu nehmen. 1961 sorgte dann wiederum der schon erwähnte Eschenburg dafür, dass die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ) einen autobiographischen Bericht des früheren RMI-Rassereferenten Bernhard Lösener unkommentiert abdruckten, mit dem Globke prophylaktisch vom Vorwurf einer Beteiligung an der NS-Judengesetzgebung entlastet werden sollte.[16] Dies geschah auf ausdrücklichen Wunsch von Walter Strauß, damals Staatssekretär im BMJ und selbst Opfer der rassistischen Verfolgungspolitik. Indes herrschte im links-liberalen Spektrum kaum größere Aufgeschlossenheit. In empirischer Auseinandersetzung mit der alten „Restaurationsthese“ stellte man dort eine auch erfahrungsgeschichtlich beglaubigte Angleichung an ein pluralistisches Demokratie- und Parteienmodell heraus, mit der eine deutsche „Abweichung vom Westen“ 1945 unwiderruflich zu Ende gegangen sei.[17]
Das letzte Jahrzehnt der alten Bundesrepublik sollte dann ganz im Zeichen einer Selbsthistorisierung unter liberal-konservativen Vorzeichen stehen. Markantester Ausdruck dafür war die auf zunächst auf fünf Bände angelegte Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der erste Band aus der Feder Eschenburgs kam kurz nach dem Machtwechsel von 1982 heraus und verwies auf die Stabilisierungserfolge der zurückliegenden Jahrzehnte.[18] Parallel zu dieser staatstragenden Geschichtsschreibung entstanden außerdem erste aus den Akten erarbeitete Studien, die sich mit dem Wiederaufbau des öffentlichen Dienstes in den Westzonen und der Bundesrepublik beschäftigten.[19] Ganz dem Credo des nicht nur von Hans-Peter Schwarz beschworenen „politischen Wunders“ verpflichtet, wurde dort die Konstituierung des westdeutschen Staates in eine harmonisierende Gründungserzählung eingebettet, die die parteienübergreifende Abwehr der alliierten Reformpläne als schwierigen, aber auch notwendigen Kraftakt zur Konsolidierung und Eindämmung rechtsradikaler Kräfte deutete.
Gleichzeitig trugen aber der Generationenwandel und der Aufstieg der Alltagsgeschichte dazu bei, dass nun die Stunde der Zeitzeug*innen aus dem Bonner Beamtenapparat schlug.[20] Ehemals aktive, aber immer noch einflussreiche Ministeriale, die ihren Aufstieg oder die so genannte „zweite Chance“ dem Adenauerschen Reintegrationskurs verdankten, suchten sich zu dieser Zeit verstärkt in das sich formierende bundesrepublikanische Erfolgsnarrativ einzuschreiben. Wie schon zu Beginn der fünfziger Jahre und im Gegensatz zu den Befunden der Karlsruher Verfassungshüter betonten die Pensionäre nicht nur die Resilienz des Beamtentums gegenüber nationalsozialistischen „Infiltrationen“ und „Zumutungen“, sondern stellten auch die unverbrüchliche „Treue“ des Beamten gegenüber dem Staat und seiner Verfassung heraus – und zwar exakt in dieser Reihenfolge.[21] Schließlich ließ sich die Grundsympathie, die dem historischen Gebilde des deutschen Beamtentums während der Ära Kohl entgegenschlug, nicht zuletzt an den fachwissenschaftlichen Diskussionen ablesen, die sich anlässlich der damaligen „Preußen“-Renaissance entspannen.[22] Denn wie Gabriele Metzler meint, konnte wer wollte in dem Phänomen auch eine Apotheose effizienter, obrigkeitsstaatlicher Verwaltung und einen Abgesang auf den bundesdeutschen Parteienstaat entdecken.[23]
Nach dem Mauerfall kam dann kurzzeitig die Frage auf, inwieweit mit dem Wegfall der deutschen Zweistaatlichkeit auch bisherige historiographische Fluchtpunkte der Bundesrepublik-Forschung obsolet geworden waren. Jedoch änderte sich auch nach 1989/90 nichts Grundsätzliches an den Koordinaten der deutschen Zeitgeschichte. Vielmehr schlossen sich die meisten westdeutschen Zeithistoriker dem Narrativ der „Selbstanerkennung“[24] an, mit dem sich in der Regel ein „zeitgemäßer Staatsbürgerstolz“ auf die Leistungen der westdeutschen Staats-, Rechts und Sozialordnung verband.[25]. In den nun vermehrt erscheinenden Gesamtdarstellungen wurde die Geschichte der Bundesrepublik zumeist als Stabilisierungs- und Liberalisierungsgeschichte erzählt, während man die soziale Reintegration der belasteten Funktionseliten „mit einem kalten Blick auf die Systemnotwendigkeiten“ beschrieb.[26]
Paradigmatisch findet sich das damals aufkommende Narrativ des Hyperpragmatismus in Hans-Ulrich Wehlers fünftem und letztem Band der „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“. Punkt für Punkt und mit einem gewissen Hang zur Tautologie rekapitulierte der Verfasser dort, wie sich die Reaktivierung des Beamtenheeres als ein kalkulierter Schritt zur Befriedung des rechten innenpolitischen Randes vollzog. Dabei betonte er ausdrücklich, dass die Vermeidung desintegrierender Tendenzen mit einem gewaltigen Schub an Effizienzsteigerung einher gegangen sei, während er den sich gleichzeitig vollziehende Rückgang weiblicher Beamter als Rückkehr zum Status Quo von 1932 einstufte.[27] Im Rückblick lässt sich daher festhalten, dass Wehlers 2008 erschienener Band bereits einige wichtige Akzentverschiebungen vorweg nahm, die es rechtfertigen, von einer Scharnierfunktion im Hinblick auf die spätere Behördenforschung zu sprechen. Indem er die Konsolidierung des Beamtenapparates vor allem unter den Aspekten der „Effizienzsteigerung“ und „ausgebliebenen Radikalisierung“ thematisierte, schrieb er den Vorgang in eine lineare Stabilisierungs- und Liberalisierungsgeschichte ein, die spätere Erfolge der Bundesrepublik als logische Konsequenz günstiger Ausgangsbedingungen und vorausschauender politischer Entscheidungen erklären will. Eine solche Perspektive gewann ihre Plausibilität auch aus den zurückliegenden Erfahrungen der deutsch-deutschen Vereinigung. Denn sowohl auf konservativer Seite als auch im linken Spektrum wurde diese übereinstimmend als Paradebeispiel für die Leistungs- und Bewährungskraft des liberalen Institutionengefüges der alten Bundesrepublik wahrgenommen.
Neue Behördenforschung – Quo Vadis?
2017 stellte Thomas Hertfelder in einem lesenswerten Aufsatz die These auf, in der Bundesrepublik habe sich seit 1990 eine neue und mächtige Meistererzählung herausgebildet, die auch Eingang in die gouvernmentale Geschichtspolitik und die offizielle Erinnerungskultur gefunden habe. Diese zeichne sich dadurch aus, dass Diktaturerinnerung und Demokratieerinnerung nicht mehr länger als Gegensätze verstanden würden. Vielmehr liege eine „Eigentümlichkeit der neuen Meistererzählung [der Demokratie, AW] gerade darin, dass sie die Erinnerung an die beiden Diktaturen in eine demokratische Erfolgsgeschichte der Diktaturbewältigung zu integrieren weiß.“[28]
In gewisser Weise, so lässt sich hier im Anschluss an Hertfelder argumentieren, schuf also erst die Etablierung einer solchen harmonisierenden Basiserzählung die entscheidenden Voraussetzungen dafür, dass vor gut eineinhalb Jahrzehnten der Einstieg in eine großzügig subventionierte Behördenforschung möglich wurde, die seitdem auf einem breiten gesellschaftspolitischen Grundkonsens ruht. Die meisten Studien, die während der letzten Jahre auf diesem Gebiet entstanden, haben sich daher auch in die damit einhergehenden Narrative eingeschrieben. Sie reproduzieren damit eine gleichermaßen fortschrittsorientierte wie in sich gebrochene Meistererzählung, die als Signum der neuen Bundesrepublik gelten kann. Eine hervorstechende Gemeinsamkeit der neueren Untersuchungen ist daher, dass über den Sachverhalt weitgehender Personalkontinuitäten und damit verbundener „Belastungen“ auch über die Adenauer-Ära hinaus kaum noch grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten bestehen. Zudem wird im Sinne Paul Noltes übereinstimmend darauf verwiesen, dass sich der demokratische Wandel nicht nur in Institutionen, Personen und Ereignissen abbildete, sondern auch veränderte Mentalitäten, Einstellungen und Werthaltungen – oder kurz: eine andere politische Kultur – hervorgebracht habe.[29] Gewisse Nachwirkungen der Polarisierungen der 1980er Jahre kann man allenfalls darin sehen, dass die Restauration des Beamtenpersonals auf konservativer Seite in den altbewährten Formeln des „Leistungsethos“ und der „Effizienz“ beschrieben wird, während man im liberalen und links-liberalen Spektrum vermehrt auf die „Neu- und Umgründungen“ der 1960er und 1970er Jahre abhebt.[30]
Doch inwieweit ist eine historiographische Erzählhaltung, die das saturierte Bewusstsein der deutsch-deutschen Einheit in die Vergangenheit verlängert, eigentlich noch angemessen, um die Geschichte deutscher Bundesministerien und Bundesbehörden nach 1945 zu rekonstruieren? Drückt sich nicht bereits in der Tatsache, dass die meisten Untersuchungen zur Behördenforschung in den frühen 1970er Jahren enden, eine problematische Annäherung an ein populäres Erzählmuster aus, das die alte Bundesrepublik in eine bis „1968“ reichende Nachkriegsgeschichte und eine in den 1970er Jahren einsetzenden „Vorgeschichte der Gegenwart“ einteilt?[31] Haben sich die geteilten Prämissen der Behördenforschung, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Diktaturbewältigung und Demokratisierung postulieren, im Zeitalter von Brexit, Trump, Pegida und AfD nicht womöglich schon als überholt erwiesen?
In ihrem kürzlich erschienenen, skizzenhaften Aufriss zur Bundesrepublik-Historiographie vertreten Frank Biess und Astrid Eckert die These, der eigentliche deutsche Sonderweg habe erst 1945 begonnen. Dies begründen sie unter anderem mit dem Argument, dass sich kein anderes Land mit ähnlichen politischen und moralischen Herausforderungen konfrontiert gesehen habe wie die Bundesrepublik nach dem „Zivilisationsbruch“ (Dan Diner).[32] Auch wenn die Autor*innen die Behördenforschung nur am Rande thematisieren, indem sie die Ubiquität von vergangenheitsbezogenen Fragen für den Staatsaufbau hervorheben, lässt sich ihre Kritik an einigen markanten Blindstellen der Bundesrepublik-Forschung durchaus auch als Aufruf zu einer perspektivischen Erweiterung dieses Forschungsdiskurses verstehen. In diesem Sinne sollen am Ende dieses Beitrags einige Vorschläge und Anregungen formuliert werden, die die Überlegungen zur Genese der Behördenforschung mit der hier geäußerten Kritik an einer neuen deutschen Meistererzählung verbinden. Als mögliche Anknüpfungspunkte bieten sich dabei die neuere NS-Herrschaftsgeschichte, die transnationale Geschichte und die Historiographie zur bundesdeutschen Demokratisierungsgeschichte an:
Diskussionen über „Neue Staatlichkeit“:
Grundsätzlich ist positiv hervorzuheben, dass sich die jüngere Behördenforschung, insoweit sie über einen epochenübergreifenden Zuschnitt verfügt, darum bemüht hat, an die Erkenntnisse der neueren NS-Forschung anzuknüpfen. Dies gilt insbesondere für Arbeiten zur „Neuen Staatlichkeit“, die der Erforschung der nationalsozialistischen Verwaltungsstrukturen in den letzten Jahren wichtige Impulse verliehen haben.[33] Der Forschungsansatz hat den Blick für die Eigenbedeutung von Bürokratien geschärft, indem er – in Auseinandersetzung mit älteren Interpretamenten – den vormals stark betonten Faktor der Dysfunktionalität, der sich angeblich aus einer strukturellen Polykratie mit entsprechenden Rivalitäten ergeben habe, stark relativiert hat. Bisher ist allerdings weitgehend offengeblieben, welche Konsequenzen sich daraus für die Zeit nach 1945 ergeben. So wäre es lohnenswert, zu untersuchen, ob diejenigen „persönliche[n] Netzwerke und informelle[n] Entscheidungsverfahren“,[34] die vor allem während des Krieges das lange Fortbestehen einer funktionstüchtigen Verwaltung ermöglicht haben, bis in die Nachkriegszeit hinein und womöglich sogar noch darüber hinaus Bestand hatten. Zu klären wäre dabei, inwieweit dies zur Etablierung neuer Seilschaften beitrug, deren Arbeitsmodi unter den Bedingungen einer sich formierenden Bundesrepublik den reibungslosen Aufbau moderner Verwaltungsstrukturen erleichterten. Denn darin scheint eine grundsätzlich andere Akzentsetzung zu liegen als in der These von der „braunen Beamtenschaft“, die angeblich durch vergangenheitspolitische Belastungen zusammengeschweißt worden sei.
Transnationale Verflechtungsgeschichte vs. Nationalgeschichte
Sieht man einmal von Ausnahmen wie der Studie zum Bundesinnenministerium ab, die sich auch als Beitrag zu einer deutsch-deutschen Vergleichsgeschichte versteht, findet die Behördenforschung bisher fast ausschließlich in einem nationalgeschichtlichen Untersuchungsrahmen statt. Selbst die historiographische Wiederentdeckung und Rehabilitierung der frühen deutsch-alliierten Bestrafungs- und Entnazifizierungsgeschichte, die Lutz Niethammer einmal als „Schule der Anpassung“ für die Funktionseliten bezeichnete,[35] konnten diese Grundausrichtung nicht nachhaltig erschüttern. Die insbesondere von US-Politologen ausgehenden Diskussionsbeiträge zu einer Abschaffung bzw. Reformierung des Berufsbeamtentums fallen daher in den meisten Studien entweder unter den Tisch oder werden erfolgreich in einer Stabilisierungs- und Ankunftserzählung kleingearbeitet. Auch die von Thomas Sandkühler und anderen aufgeworfene Frage, welche Vorbildfunktion den ordnungs- und wirtschaftspolitischen Praktiken des nationalsozialistischen „Neuen Europas“ für die westdeutsche Europapolitik nach 1945 zukam, findet bis heute kaum Eingang in die Behördenforschung.[36] Dies ist umso erstaunlicher, als die entscheidenden Schlüsselfiguren und Ideengeber oftmals in den alten Reichsministerien gesessen hatten.
Die nationalgeschichtliche Verengung der Behördenforschung bestätigt die pointierte Kritik Klaus Naumanns, der der deutschen Zeitgeschichte vor einigen Jahren vorwarf, nicht mehr genügend „Blickkontakt“ zur Gegenwart zu halten und dadurch die „Zeitdiagnostik am eigenen Leib“ zu vernachlässigen.[37] Spätestens in den 1970er Jahren, wahrscheinlich aber schon deutlich früher, wurde die Bundesrepublik mit voller Wucht von einem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Internationalisierungsschub erfasst, auf den zum damaligen Zeitpunkt kaum jemand vorbereitet war. Neue Themen- und Politikfelder wie etwa Terrorismus, Flüchtlingsströme, Menschenrechte und die Herausforderungen einer sich globalisierenden Erinnerungskultur stellten frühere Erfahrungswerte und Denkmuster in den Bonner Ministerien auf den Kopf. Wie etwa das Olympiaattentat von 1972 zeigt, wurden die damit verbundenen Fragen oftmals in einem exkludierenden Angst- und Krisenmodus verhandelt, der mit seinen exotisierenden und rassistischen Untertönen von liberalen „Lernprozessen“[38] und einer „gebremsten Liberalisierung“[39] relativ weit entfernt war. Auch diese Gegentendenzen und Disparitäten gilt es somit in den Blick zu nehmen, wenn man die Wandlungsprozesse in bundesdeutschen Behörden sowie die von ihnen ausgehenden Diskurse und Praktiken erfassen will.
Blindstellen einer demokratie- und erinnerungspolitischen Fortschrittsgeschichte
Die Annahme eines kausalen Zusammenhangs zwischen Diktaturaufarbeitung und Demokratisierung bildet bis heute eine zentrale Prämisse der neueren Behördenforschung. Empirisch steht diese jedoch auf eher schwachen Füßen, weil eine Historisierung des Aufarbeitungs- und Demokratisierungsbegriffs ein uneingelöstes Desiderat der Zeigeschichte geblieben ist.[40] Insbesondere das Konzept der „Demokratisierung“ wurde bislang kaum kritisch hinterfragt, sondern im Sinne einer zeitgenössischen Fortschrittserzählung ganz überwiegend als Indikator für den postulierten politischen, kulturellen und mentalen Wandel aufgefasst, dem sich seit den 1960er und 1970er Jahren immer größere Teile der deutschen Gesellschaft verpflichtet gefühlt hätten. Indem die Behördenforschung einen Quellenbegriff umstandslos zu einer historiographischen Leitkategorie erhebt, blendet sie aus, dass „Demokratisierung“ seit den späten 1960er Jahren für erhebliche Teile der konservativen Beamtenschaft als Feindbild firmierte, das starke Gegenkräfte mobilisierte. „Dieser Generalanspruch unserer Zeit“, so fasste es 1970 der Politologe Wilhelm Hennis zusammen, zerstöre die „Unterscheidung von Gemeinwesen und Ämterordnung“ und letztlich die „Grundlagen der abendländischen politischen Kultur.“[41] Hinter vermeintlich „unpolitischen“ Grundhaltungen verbarg sich daher oftmals eine Delegitimierung linker, emanzipativer und gesellschaftsverändernder Politik, die auf kulturellen Prägungen und Werthaltungen beruhte.[42] Eine Behördenforschung, die sich mit dem Wandel von Verwaltungskulturen befassen will, hätte konservative Adaptionen und Anverwandlungen von „Demokratisierung“ entsprechend zu berücksichtigen, wenn man die Persistenz autoritär-etatistischer Einstellungen und den Übergang zur konservativen „Tendenzwende“ der 1970er Jahre verstehen will.[43]
Neben einer „Geschichte des Politischen“ hat sich in den letzten Jahren außerdem die Emotions- und Mentalitätsgeschichte als fruchtbares Forschungsfeld erwiesen, um spezifische Mechanismen der Veränderung und Beharrung in den Blick zu bekommen.[44] Zu den interessantesten Fragen in Bezug auf das Wertverständnis des westdeutschen Bürgertums dürfte dabei gehören, wie sich Auffassungen von „Ehre“, „Loyalität“ und „Anständigkeit“ nach 1945 unter dem Einfluss amerikanischer Reeducation-Bestrebungen entwickelten. So haben etwa Studien zum Ehrbegriff westdeutscher Stahlindustrieller gezeigt, wie zentral solche moralpolitische Selbstverständigungsdiskurse für die Re-konstituierung und Selbststabilisierung des gesamten Berufsstands waren.[45] Obwohl sich mit der Offenlegung der ministeriellen Personalakten anbieten würde, diesen Blickwinkel auf staatliche Institutionen zu übertragen, ist die Behördenforschung in dieser Hinsicht noch nicht über erste Ansätze hinausgekommen. Erste Fallstudien wie die H.C. Jaschs Skizze zum Fall des früheren Oberbundesanwalts Harry von Rosen-von Hoewel weisen jedenfalls darauf hin, dass die Geschichte der westdeutschen Behörden und ihres Personals auch als ein nicht enden wollendes Drama von Ehrstreitigkeiten gelesen werden kann, denen aufgrund ungesühnter NS-Verbrechen oftmals kompensatorische Funktionen zukamen.[46] In diesem Sinne ließe sich beispielsweise die eingangs erwähnte „Nachruf“-Debatte um das Auswärtige Amt auch als ein später Nachhall auf frühere „Ehren“-Diskurse lesen.[47]
Fazit
1991 stellte Hans-Ulrich Derlien dem deutschen Beamtentum des 20. Jahrhunderts noch ein uneingeschränkt positives Zeugnis aus. Neben Professionalität und hohem Leistungsethos hob der einflussreiche Verwaltungswissenschaftler vor allem dessen ausgeprägtes Beharrungsvermögen hervor. Diese Grundeigenschaften hätten über die Epochenzäsuren von 1918 und 1945 hinweg Bestand gehabt, seien aber nun, vor dem Hintergrund der deutschen Einheit und der fehlenden Qualifizierung des zu übernehmenden früheren DDR-Personals, latent gefährdet.[48] Derliens historische Gesamtschau schloss daher mit der durchaus skeptischen Diagnose: „Owing to divergent developments in the East and the West over the past forty-five years, Germany is, for the first time after a regime change, facing the problem of politicized incompentence of public functionaries.”
Knapp dreißig Jahre später lässt sich konstatieren, dass die neuere Behördenforschung erheblich dazu beigetragen hat, diesen früheren idealisierenden Blick mit einem Fragezeichen zu versehen. So ist sich die Zeitgeschichte heute zumindest in theoretischer Hinsicht darin einig, dass Begriffe wie „Effizienz“ und „politische Neutralität“, „Ehre“ und „Loyalität“ Bestandteile eines Kanons von Selbst- und Fremdzuschreibungen waren, den es zu historisieren gilt. Der Überblick zur historiographischen Entwicklung der Behördenforschung macht einerseits deutlich, dass der saturierte Grundton, der die Bundesrepublik-Forschung noch kurz nach der deutschen Einheit kennzeichnete, zwar mittlerweile einer differenzierteren Betrachtung gewichen ist. Andererseits verharren aber viele Studien aus dem Bereich der Behördenforschung bis heute in dem unreflektierten Erzählmodus einer demokratie- und erinnerungspolitischen Fortschrittsgeschichte, dessen Überzeugungskraft sich allerdings in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen mehr und mehr abgeschwächt hat.
[1] Axel Schildt, In der Welt historischer Kommissionen. Oder: Die Spezifik der Deutsch-Italienischen Historikerkommission, in: Christoph Cornelißen/ Paolo Pezzino (Hrsg.): Historikerkommissionen und historische Konfliktbewältigung, Berlin 2018, S. 315-328, S. 324.
[2] Einstweilige Verfügung gegen „Das Amt und die Vergangenheit“ – allerdings wirksam nur für zukünftige Auflagen. Interview mit Rainer Dresen, Justitiar des Blessing-Verlags, vom 3.3.2011; in: Buchmarkt (Zugriff 8.5.2020); Hans-Jürgen Döscher, Der Fall Gaerte, in: Die ZEIT vom 3. März 2011; wie die Autorin im Rahmen ihrer Forschungen zur Nachkriegsgeschichte des AA feststellen konnte, handelte es sich dabei um ein auf die Fünfziger zurückgehendes Muster zur Unterdrückung kritischer Zeitgeschichtsforschung,
[3] Ebd., S. 315.
[4] Siehe dazu auch die Aufstellung in: Christian Mentel/Niels Weise: Die zentralen deutschen Behörden und der Nationalsozialismus – Stand und Perspektiven der Forschung, hrsg. von Frank Bösch et.al., S. 106-111.
[5] Zahlenangaben nach Christian Mentel/Niels Weise, Die NS-Vergangenheit deutscher Behörden, in: APuZG 14-15/2017, S. S. 16-21, S. 18.
[6] Tim Schanetzky: Distanzierung, Verunsicherung, Entschädigung. Die deutsche Wirtschaft und die Globalisierung der Wiedergutmachung, in: José Brunner/Norbert Frei/Constantin Goschler (Hrsg.): Globalisierung der Wiedergutmachung. Politik, Moral, Moralpolitik, Göttingen 2013, S. 105-149, 120.
[7] Vgl. Neil Gregor, History to Order? Commissioned Research, Contained Pluralism and the Limits of Criticism, in: Zeitgeschichte-online, Dezember 2012, (letzter Zugriff: 5.10.2019).
[8] Wie Otto Schily weiter hinzufügte, gebe es zwar hier und da personelle Belastungen, jene seien aber bereits hinreichend erforscht; zit. nach Mentel/ Weise, NS-Vergangenheit deutscher Behörden, S. 16.
[9] Christian Mentel, Über die Notwendigkeit der Selbstreflexion. Eine Anmerkung zum Stand der Behördenforschung, in: Zeitgeschichte-online, Januar 2017 (letzter Zugriff: 5.10.2019) sowie ders., Der kritische Blick auf sich selbst. Zur Verantwortung der historischen Zunft in der Behördenforschung, in: Marcus Böick/Marcel Schmeer (Hrsg.), Im Kreuzfeuer der Kritik. Umstrittene Organisationen im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M., S. 139-161.
[10] Bernhard Loeffler, „Im Mahlstrom der Zeit“. Personalkontinuitäten und „Vergangenheitsbewältigung“ im Bundeswirtschaftsministerium, in: Stefan Creuzberger/Dominik Geppert (Hrsg.), Die Ämter und ihre Vergangenheit. Ministerien und Behörden im geteilten Deutschland 1949-1972, Paderborn u.a. 2018, S. 87-107, S. 106.
[11] Einige Kritiker sprechen auch von einer Erfolgsgeschichte „unter der Hand“, die sich als Teil einer „moralischen Wiedergutmachung“ versteht; Frank Bajohr/Johannes Hürter, Auftragsforschung ‚NS-Belastung‘. Bemerkungen zu einer Konjunktur, in: Frank Bajohr/Anselm Doering-Manteuffel/Claudia Kemper/Detlef Siegfried (Hrsg.), Mehr als eine Erzählung. Zeitgeschichtliche Perspektiven auf die Bundesrepublik, Göttingen 2016, S. 221-233, S. 230
[12] Schildt, In der Welt historischer Kommissionen, S. 320 (FN 9).
[13] So etwa der Tenor bei Loeffler, „Im Mahlstrom der Zeit“, S. 105, der auch von den beiden Herausgebern des Sammelbands geteilt wird.
[14] So beispielsweise Karl W. Deutsch/Lewis J. Edinger, Germany Rejoins the Powers, Stanford: Stanford University Press 1959; Lewis J. Edinger, Post-Totalitarian Leadership: Elites in the German Federal Republic, in: The American Political Science Review 54 (1960), S. 58-82.
[15] Karl Dietrich Bracher, Auflösung der Weimarer Republik: eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie, Stuttgart und Düsseldorf 1955.
[16] Vgl. Magnus Brechtken, Nürnberger Gesetze: Nachgeschichte und Historiographie: Der Fall Globke, in: Magnus Brechtken/Hans-Christian Jasch/Christoph Kreutzmüller/Niels Weise (Hrsg.), Die Nürnberger Gesetze – 80 Jahre danach. Vorgeschichte, Entstehung, Auswirkungen, Göttingen 2017, S. 249-266, S. 258.
[17] So stellte Heinrich August Winkler das Jahr 1945 als „die wohl tiefste Zäsur in der deutschen Geschichte“ heraus; Heinrich August Winkler, Vorbemerkung, in: Ders. (Hrsg), Politische Weichenstellungen im Nachkriegsdeutschland, Göttingen 1979, S. 7-8, S. 8.
[18] Theodor Eschenburg, Jahre der Besatzung, 1945-1949 (Geschichte der Bundesrepublik in fünf Bänden, hrsg. von Karl Dietrich Bracher, Theodor Eschenburg, Joachim C. Fest, Eberhard Jäckel, Bd. 1), Stuttgart und Wiesbaden 1983.
[19] Udo Wengst, Beamtentum zwischen Tradition und Reform. Beamtengesetzgebung in der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland, Düsseldorf 1988; Wolfgang Langhorst, Beamtentum und Artikel 131 des Grundgesetzes, Frankfurt a.M. 1994; Lutz Niethammer, Zum Verhältnis von Reform und Rekonstruktion in der US-Zone am Beispiel des öffentlichen Dienstes, in: Wolf-Dieter Narr/ Dietrich Thränhardt (Hrsg.), Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung, Entwicklung, Struktur, Königsstein/Ts. 1979, S. 47-59.
[20] Karl Gumbel, Hans Globke – Anfänge und erste Jahre im Bundeskanzleramt, in: Klaus Gotto (Hrsg.), Der Staatssekretär Adenauers. Persönlichkeit und politisches Wirken Hans Globkes, Stuttgart 1980, S. 73-98; Franz Thedieck, Gespräche und Begegungen mit Konrad Adenauer – Aus einem halben Jahrhundert deutscher Politik, in: Dieter Blumenwitz/Klaus Gotto /Hans Meier/Konrad Repgen/Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers. [Band 1:] Beiträge von Weg- und Zeitgenossen, Stuttgart, 1976, 326-339.
[21] „Rückblickend darf festgestellt werden, dass die gekennzeichneten Grundsätze der Personalpolitik mit vollem Erfolg angewendet worden sind. […] Hierzu gehörte das Prinzip guter fachlicher Ausbildung, Treue gegenüber dem Staat und seiner freiheitlichen demokratischen Grundordnung, innere Unabhängigkeit, Fernhalten parteipolitischer Einflüsse, kurz, um mit dem Bundesverfassungsgericht zu sprechen […] der ‚Kernbestand von Strukturprinzipien, die allgemein oder doch überwiegend während eines längeren, Tradition bildenden Zeitraums, mindestens unter der Reichsverfassung von Weimar, als verbindlich anerkannt‘ waren.“ Walter Strauß: Die Personalpolitik in den Bundesministerien zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland, in: Blumenwitz u.a. (Hrsg.), Konrad Adenauer und seine Zeit, 275-282, S. 282.
[22] Karl Dietrich Erdmann, Preußen – von der Bundesrepublik her gesehen, in Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 31 (1980), S. 335-353.
[23] Gabriele Metzler, Der Staat der Historiker. Staatsvorstellungen deutscher Historiker seit 1945, Berlin 2018, S. 207.
[24] Klaus Naumann, Selbstanerkennung? Nach 40 Jahren Bundesrepublik: Anstöße zur Bewältigung einer „Erfolgsgeschichte“, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 33 (1988), S. 915–928; S. 1046–1060.
[25] Hans-Ulrich Wehler, Wider die falschen Apostel. Der Verfassungs- und Sozialstaat schafft Loyalität und Staatsbürgerstolz, in: Die ZEIT vom 9. November 1990.
[26] Axel Schildt, Fünf Möglichkeiten, die Geschichte der Bundesrepublik zu erzählen, in: Frank Bajohr et.al. (Hrsg.), Mehr als eine Erzählung. Zeitgeschichtliche Perspektiven auf die Bundesrepublik, S. 15-25, S. 23.
[27] Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 5: Von der Gründung der beiden deutschen Staaten bis zur Vereinigung 1949-1990, München 2008, S. 14.
[28] Thomas Hertfelder, Opfer, Täter, Demokraten. Über das Unbehagen an der Erinnerungskultur und die neue Meistererzählung der Demokratie in Deutschland, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 65 (2017), H. 3, S. 365-394, S. 391.
[29] Paul Nolte, Von Glück und Streit. Lernen und Stabilität. Historiografische Meistererzählungen deutscher Demokratie, in: Thomas Hertfelder/Ulrich Lappenküper /Jürgen Lillteicher (Hrsg.), Erinnern an Demokratie in Deutschland. Demokratiegeschichte in Museen und Erinnerungsstätten der Bundesrepublik, Göttingen 2016, S. 121-137.
[30] Schildt, In der Welt historischer Kommissionen, S. 321.
[31] Morten Reitmayer/Thomas Schlemmer, Die Anfänge der Gegenwart. Umbrüche in Europa nach dem Boom, München 2017; Anselm Doering-Manteuffel u.a. (Hrsg.), Vorschichte der Gegenwart. Dimensionen des Strukturbruchs nach dem Boom, Göttingen 2016.
[32] Frank Biess/Astrid Eckert, Introduction: Why do we need New Narratives for the History of the Federal Republic?, in: Central European History 52 (2019), H. 1, S. 1-18, S. 12.
[33] Sven Reichardt/Wolfgang Seibel (Hrsg.), Der prekäre Staat: Herrschen und Verwalten im Nationalsozialismus, Frankfurt/M. 2011.
[34] Michael Wildt, Franz Neumann und die NS-Forschung, in: Franz Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944, hrsg. von Alfons Söllner und Michael Wildt, Hamburg 2018, S. 676.
[35] Lutz Niethammer, Schule der Anpassung. Die Entnazifizierung in den vier Besatzungszonen, in: Ders., Deutschland danach: Postfaschistische Gesellschaft und nationales Gedächtnis, hrsg. von Ulrich Herbert und Dirk van Laak in Zusammenarbeit mit Ulrich Borsdorf et.al., Bonn 1999, S. 53-58.
[36] Thomas Sandkühler, Europa und der Nationalsozialismus. Ideologie, Währungspolitik, Massengewalt, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 9 (2012), H. 3 (letzter Zugriff: 5.10.2019).
[37] Klaus Naumann, Reden wir endlich vom Ende!, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30. August 2001.
[38] Zum Konzept des „Lernprozesses“ vgl. unter anderem Arndt Bauernkämper et.al. (Hrsg.), Demokratiewunder. Transatlantische Mittler und die kulturelle Öffnung Westdeutschlands 1945-1970, Göttingen 2005.
[39] Frank Bösch/Andreas Wirsching, Die deutschen Innenministerien nach dem Nationalsozialismus. Eine Bilanz, in: Dies. (Hrsg.), Hüter der Ordnung: Die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus, Göttingen 2018, S. 729-749, S. 749.
[40] Vgl. jetzt Eckart Conze/Annette Weinke, Krisenhaftes Lernen? Formen der Demokratisierung in deutschen Behörden und Ministerien, in: Tim Schanetzky/Tobias Freimüller/Kristina Meyer/Sybille Steinbacher/Dietmar Süß/Annette Weinke (Hrsg.), Demokratisierung der Deutschen. Errungenschaften und Anfechtungen eines Projekts, Göttingen 2020, S. 87-101.
[41] Wilhelm Hennis, Demokratisierung. Zur Problematik eines Begriffs, Opladen 1972, S. 13, 22, zit. nach Axel Schildt, "Die Kräfte der Gegenreform sind auf breiter Front angetreten". Zur konservativen Tendenzwende in den 70er Jahren, in: Ders., Annäherungen an die Westdeutschen. Sozial- und kulturgeschichtliche Perspektiven auf die Bundesrepublik, Göttingen 2011, S. 259-301, S. 264.
[42] Dies bestätigt die Befunde politikwissenschaftlicher Studien, die eine starke Kluft zwischen den demokratietheoretischen Idealen und den realen Demokratieverständnissen in der Beamtenschaft betonen; Sung-Don Hwang, Bureaucracy vs. Democracy in the Minds of Bureaucrats. To What Extent Are These Ideologies Compatible with One Another? New York et. al. 1999.
[43] Vgl. dazu Schildt, „Die Kräfte der Gegenreform“.
[44] Frank Biess, Republik der Angst. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik, Reinbek bei Hamburg 2019.
[45] Armin Grünbacher, ‚Honourable Men.‘ West German Industrialists and the Role of Honour and Honour Courts in the Adenauer Era, in: Contemporary European History 22 (2013), H. 2, S. 233-252.
[46] Hans-Christian Jasch, Vom Reichsministerium des Innern zum Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht. Die Personalie Harry von Rzycki
bzw. von Rosen- von Hoewel. Personelle Kontinuitäten und ihre Grenzen, in: Dieter Deiseroth/Annette Weinke (Hrsg.), Zwischen Aufarbeitung und Geheimhaltung. Justiz- und Behördenakten in der Zeitgeschichtsforschung (erscheint 2020).
[47] Einige Diplomaten bezichtigten Fischer damals öffentlich der „Unanständigkeit“; Eckart Conze/Norbert Frei/Peter Hayes/Moshe Zimmermann unter Mitarbeit von Annette Weinke und Andrea Wiegeshoff, Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010, S. 709.
[48] Hans-Ulrich Derlien, Historical legacy and recent developments in the German Higher Civil Service, in: International Review of Administrative Sciences 57 (1991), S. 385-401.
Zitation
Annette Weinke, „Alles noch schlimmer als ohnehin gedacht“?. Neue Wege für die Behördenforschung, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/alles-noch-schlimmer-als-ohnehin-gedacht