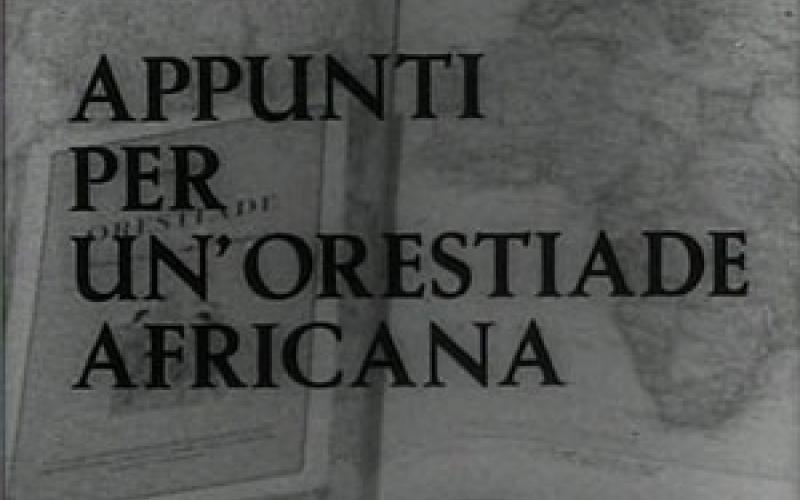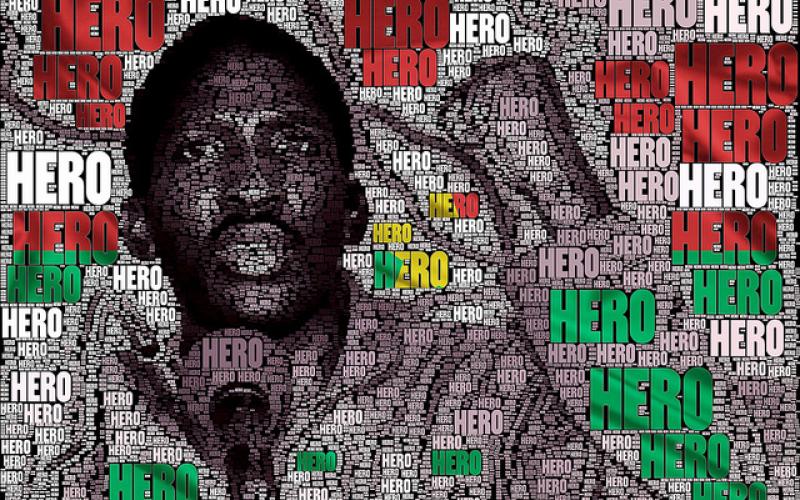Am 12. Dezember 1958 wurde Guinea als erstes frankophones subsaharisches Land Mitglied der Vereinten Nationen (UN). Etwa zur selben Zeit brach die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) die Beziehungen zu dem westafrikanischen Land ab. Während sich Guinea damit einerseits um alle Ansprüche auf europäische „Entwicklungshilfe“ brachte, die sich aus der von der vormaligen Kolonialmacht Frankreich maßgeblich betriebenen sogenannten Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete an die EWG seit Anfang 1958 ergaben, konnte es sich andererseits fortan – und im Gegensatz zu seinen frankophonen Nachbarländern – als unabhängiger Staat in der internationalen Arena der UN profilieren. Ahmed Sekou Touré, der erste Präsident des unabhängigen Guinea nutzte diese Gelegenheit, neue politische Partner insbesondere in den Staaten des „Ostblocks“ zu suchen und machte sein Land damit ganz nebenbei auch zu einem Schauplatz des Kalten Krieges in Afrika.
Deutlicher als am Beispiel Guineas lassen sich Chancen und Probleme, die sich den neu unabhängigen afrikanischen Staaten bei ihrem Eintritt in die „internationale Gemeinschaft“ eröffneten, kaum aufzeigen: Neuen Möglichkeiten, als souveräne Staaten jenseits (neo)kolonialer Abhängigkeiten eine selbstbestimmte politische und wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, standen neue Zwänge gegenüber, sich im ideologischen Systemkonflikt zu positionieren. Internationale Organisationen wurden damit zu Orten, an denen sich die für das internationale System des postkolonialen Zeitalters charakteristische Dialektik von Souveränitätsgewinn und neuer Abhängigkeit archetypisch abbildete.
Im Zentrum des folgenden Beitrags steht vor diesem Hintergrund das Verhältnis zwischen den jungen afrikanischen Nationen und der „internationalen Gemeinschaft“ – beispielhaft illustriert anhand von UNO und EWG – während der Kernphase der afrikanischen Dekolonisation in den 1960er-Jahren. Dies geschieht aus einer doppelten Perspektive: Es geht zum einen darum, die Bereiche zu kennzeichnen, in denen die Dekolonisation Afrikas Spuren in der Arbeit der genannten internationalen Organisationen hinterließ. Im Umkehrschluss wird zum anderen die Bedeutung internationaler Organisationen im postkolonialen nation-building in Afrika vermessen. Neben ihrer Funktion als Foren zwischenstaatlichen Austauschs richtet sich dabei der Blick ebenso auf ganz konkrete Maßnahmen und Aktivitäten von UNO und EWG in Afrika.
Die Analyse erfolgt im Rahmen eines Vergleichs. Wenngleich die Entstehungszusammenhänge, Aufgabenbereiche und nicht zuletzt die geografische Ausrichtung von UNO und EWG erheblich voneinander abwichen, bietet sich eine Gegenüberstellung dieser zwei Organisationen dennoch an, da sich beide im Gegensatz zu anderen internationalen Zusammenschlüssen bereits im Zeitalter der Dekolonisierung zum afrikanischen Kontinent positionieren mussten. Gerade aufgrund der unterschiedlichen Natur der zwei Institutionen gibt ein Vergleich nicht nur Aufschluss über die jeweiligen, spezifisch gelagerten Beziehungen zu den afrikanischen Staaten, sondern lässt in der Zusammenschau auch die „polyzentrische Machtkonstellation“ (Marc Frey) sichtbar werden, die in Afrika nach 1960 an die Stelle der untergegangenen kolonialen Ordnung trat.
Drei Ereignisse erscheinen sinnbildlich für die Zäsur, die Afrikas Ankunft in der Weltgemeinschaft unabhängiger Nationen zu Beginn der 1960er-Jahre auslöste: Im Juli 1960 begann mit der Entsendung von UN-Truppen in den Kongo eine der bedeutendsten und folgenreichsten Friedensmissionen in der Geschichte der UN. Die Kongomission stand dabei insbesondere für die neuartige Weise, wie sich in den 1960er-Jahren postkoloniale Konflikte mit den Trennlinien des Kalten Krieges zu verschränken begannen.
Noch im Herbst desselben Jahres verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution zur „Erklärung bezüglich der Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Gebiete“ und bestätigte damit in verschärftem Ton den von einer neuen Mehrheit getragenen antikolonialen Konsens innerhalb der Weltgemeinschaft. Die UN wurden unter maßgeblicher Führung der „Neuen Nationen“ Afrikas endgültig zum zentralen Forum des symbolisch aufgeladenen Kampfes gegen die Restbestände des Kolonialismus und den Rassismus weißer Siedlerregimes im südlichen Afrika.
Ein gutes Jahr später schließlich, am 19. Dezember 1961, erklärte die Vollversammlung auf Initiative von US-Präsident John F. Kennedy die 1960er-Jahre zur „Entwicklungsdekade“ und verpflichtete die Weltgemeinschaft darauf, die Aufmerksamkeit auf die ärmeren Mitglieder der Staatengemeinschaft zu konzentrieren. Kennedys Vorschlag reflektierte dabei einen von den afrikanischen Unabhängigkeitserklärungen maßgeblich beförderten Prozess, an dessen Ende das UN-System (d. h. die UNO samt ihrer Sonderorganisationen) einen Schwerpunkt seiner Arbeit und seiner Ressourcen auf den Bereich der Entwicklungspolitik verlagerte.
Allen drei Ereignissen war gemeinsam, dass sie die tiefgreifenden Umbrüche widerspiegelten, denen sich das UN-System im Zuge der afrikanischen Unabhängigkeit ausgesetzt sah und deren Tragweite deutlich über den numerischen Zugewinn an Mitgliedsstaaten hinausreichte.
Bevor diese Umbrüche in ihren wechselseitigen Auswirkungen weiter beleuchtet werden, richtet sich der Blick zunächst in die entgegengesetzte Richtung und damit auf die materielle und immaterielle Bedeutung, die der Mitarbeit im UN-System aus Sicht der jungen afrikanischen Staaten zukam. Diese kann kaum hoch genug bewertet werden. Gerade für die frühen Jahre nach der Unabhängigkeit stellte alleine die Aufnahme der unabhängigen Staaten in die Vereinten Nationen einen Akt von höchster symbolischer Bedeutung dar. Indem afrikanische Regierungen ihren Platz als formal gleichberechtigte Mitglieder der Weltgemeinschaft innerhalb der Gremien des UN-Systems einnahmen, wurde die Erlangung staatlicher Souveränität für alle Welt sichtbar. Nebenbei war die Vertretung innerhalb des UN-Systems schon allein aus praktischen Gründen von immenser Bedeutung: Keiner der afrikanischen Staaten verfügte zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit über einen voll ausgeprägten diplomatischen Dienst; allenfalls unterhielten sie Botschaften in wenigen ausgewählten Hauptstädten. Dem Posten des UN-Botschafters kam deshalb eine umso zentralere Stellung bei der Vertretung der Interessen der jungen Staaten zu.
Die symbolische Bedeutung der UN erschöpfte sich jedoch nicht im Akt der Aufnahme. In ihrer Funktion als Bühne des Kampfes gegen Kolonialismus und Apartheid sowie um die Organisation des Welthandels besaß das UN-System gleich doppelte symbolische Strahlkraft für die afrikanischen Regierungen: Es diente erstens als Forum der Abgrenzung gegenüber den „alten Mächten“ bzw. zur alternativen Vergemeinschaftung jenseits der dominierenden Blockkonfrontation und jenseits der weiterhin existierenden Klientelbeziehungen gegenüber den ehemaligen Kolonialmächten, die insbesondere mit Blick auf das frankophone Afrika von großer Bedeutung waren. In diesem Sinne waren Manifestationen der Süd-Süd-Solidarität, der Blockfreiheit oder des Panafrikanismus innerhalb der UN immer auch ein Versuch, die eigene, als fragil begriffene staatliche Souveränität zu untermauern.
Zweitens konnten antikoloniale Rhetorik und Forderungen nach einer Neuorganisation des Welthandels in internationalen Organisationen aus Sicht der postkolonialen Regierungen auch dem Ziel dienen, ihren Machtanspruch als neue Eliten nach innen zu untermauern: Der Anspruch der Regierungen, den Kampf um Unabhängigkeit (sowohl im Sinne der politischen Befreiung noch bestehender Kolonien als auch der Beseitigung wirtschaftlicher Abhängigkeit) im internationalen Rahmen weiterzuführen, konnte auf diese Weise ihrem Herrschaftsanspruch innenpolitisch neue Legitimität verleihen. Alle afrikanischen Regierungen verstanden sich selbst – unabhängig von ihrer politischen Orientierung – als entwicklungspolitische Notstandsregimes. Repräsentation im internationalen System und Zugriff auf Ressourcen, die sich durch ihre Mitarbeit in internationalen Organisationen erschlossen, waren ein sowohl materiell als auch symbolisch wertvolles Kapital, das auch gegen die Opposition im eigenen Land zum Einsatz kommen konnte. Dieser Faktor gewann im Verlauf der 1960er-Jahre, als flächendeckend Ein-Parteien-Regime oder Militärdiktaturen das Ruder übernahmen, zunehmend an Bedeutung. Die Vereinten Nationen standen in diesem Sinn für das Prinzip unbedingter nationaler Souveränität, von der die nationalen Befreiungsbewegungen in ihrem Wandlungsprozess zur Herrschaftselite profitierten.
Von hier aus fällt der Blick zurück auf die Beziehungen zwischen der UNO und den afrikanischen Staaten während der Dekolonisationsphase und dem damit einhergehenden post-kolonialen nation-building: Aus Sicht der UN barg die Welle afrikanischer Unabhängigkeitserklärungen in mehr als einer Hinsicht nicht zu unterschätzenden politischen Sprengstoff. Der Zustrom neuer Mitglieder drohte in den Augen vieler Offizieller ein ohnehin prekäres Gleichgewicht ins Wanken zu bringen, in dem sich die Weltorganisation zu Beginn der 1960er-Jahre vor dem Hintergrund des schwelenden Ost-West-Konflikts befand. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das westliche Lager, geführt von den USA, stets auf eine Mehrheit innerhalb der Vollversammlung vertrauen können. Bereits seit Mitte der 1950er-Jahre hatten sich allerdings infolge der Dekolonisation in Asien und der beginnenden Erosion kolonialer Herrschaft auch in anderen Teilen der Welt die Verhältnisse zu verschieben begonnen. Die Sowjetunion erkannte die Chance, die Architektur innerhalb der Weltorganisation zu ihren Gunsten zu verändern oder zumindest die westliche Dominanz zu neutralisieren und begann, aktiv um die Staaten der sich formierenden „Dritten Welt“ zu werben. Spätestens mit Ghanas Unabhängigkeit 1957 rückte Afrika in den Mittelpunkt dieser Auseinandersetzungen.
Bereits während der Suezkrise 1956 und mit Bezug auf Frankreichs Kolonialkriege in Indochina und Algerien hatten sich innerhalb der UN die Spannungen des Kalten Krieges mit dem afrikanischen Dekolonisationsprozess verschränkt. Im „Jahr Afrikas“ traten sie erstmals vollends zu Tage und machten die Kongomission, den ersten Peacekeeping-Einsatz der UN auf afrikanischem Boden, zu einem Fiasko:[1] Zunächst als neutraler Beobachter mit dem Auftrag entsandt, beim von Anfang an konfliktreichen Übergang des Kongos aus belgischer Herrschaft in die Unabhängigkeit die territoriale Integrität des Landes zu wahren, geriet die UN-Mission im Kongo (ONUC) mit zunehmender Dauer ins Visier der Kritik insbesondere der Sowjetunion. Anlässlich der maßgeblich vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA angeleiteten Absetzung und anschließenden Ermordung von Ministerpräsident Patrice Lumumba zielte sie vor allem auf das Krisenmanagement von UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld. Auch einige afrikanische Staaten warfen Hammarskjöld und dem UN-Sekretariat (nicht ganz zu Unrecht) vor, die gebotene Neutralität bei verschiedenen Gelegenheiten zu Gunsten des westlichen Lagers verletzt zu haben.
Auch auf einer anderen Ebene war die Rolle der UN in der Kongokrise ambivalent: Zwar war die Weltorganisation kaum für die Vielzahl an Konflikten verantwortlich zu machen, die sich aus der nachkolonialen territorialen Ordnung im Kongo und anderswo ergaben; die Vereinten Nationen repräsentierten und stabilisierten jedoch das unter den Verhältnissen des postkolonialen Afrikas spannungsbeladene Prinzip des Nationalstaats und privilegierten es gegenüber alternativen Formen territorialer Ordnung.
Die Folgen der Kongokrise waren weitreichend; mit ihr traten die UN in eine Phase der Lähmung ein. Die Sowjetunion verweigerte Hammarskjöld, der 1961 bei einem Flugzeugabsturz über dem Kongo starb, die weitere Anerkennung als legitimen UN-Generalsekretär. Eine Zeitlang schien Beobachter/innen sogar ein vollständiges Auseinanderbrechen der Weltorganisation möglich. Auch wenn diese Gefahr abgewendet wurde, hatte die Kongokrise zumindest in einer Hinsicht langfristige Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der Weltorganisation und Afrika: Bis zum Ende des Ost-West-Konflikts 1989/90 blieb ONUC die letzte Peacekeeping mission in Afrika. In allen weiteren postkolonialen Konflikten auf dem Kontinent, so zum Beispiel im Biafrakrieg, oder in den am Ende der 1970er-Jahre beginnenden Stellvertreterkriegen wie in Angola und Mosambik, spielten die UN keine oder allenfalls eine sehr geringe Rolle.
Doch nicht nur im Rahmen postkolonialer Konflikte wie im Kongo brachte der fortschreitende Dekolonisationsprozess in Afrika neues Konfliktpotenzial in die Gremien der UN. Die Tatsache, dass viele der Regierungen, die zum ersten Mal an Vollversammlungen teilnahmen, unmittelbar aus Unabhängigkeitsbewegungen hervorgegangen waren, während gleichzeitig der Kampf um die staatliche Unabhängigkeit anderer afrikanischer Länder zu diesem Zeitpunkt noch im vollem Gange war, trug zur Verschärfung des antikolonialen Tones bei. Zur selben Zeit erhielten bestehende Formen und Institutionen der Süd-Süd-Solidarität durch afrikanische Unabhängigkeitsbewegungen frische Impulse, die sich unmittelbar in Aktionsbündnissen innerhalb der UN niederschlugen.
Die Verabschiedung der „Antikolonialismus“-Resolution 1504 im Herbst 1960, eingebracht von 43 afrikanischen, asiatischen und einigen lateinamerikanischen Staaten (der Autor einer ersten Fassung war die Sowjetunion gewesen) bildete dabei nur den Auftakt. In aller Klarheit brandmarkte die Resolution, fortan eine Art „Bibel der antikolonialen Religion“ (Evan Luard), die „Unterwerfung, Beherrschung und Ausbeutung von Völkern“ durch die Kolonialmächte als einen Verstoß gegen fundamentale Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht aller Völker und leitete daraus die Forderung ab, unverzüglich Schritte zur Herstellung der politischen Freiheit der noch verbliebenen Kolonialgebiete einzuleiten.
In den folgenden Jahren bildeten afrikanische Regierungen die Speerspitze einer Bewegung, die internationale Organisationen zur Hauptbühne eines öffentlichkeitswirksamen Kampfes gegen Rassismus und Kolonialismus auserkor. Nachdem sowohl Frankreich und Großbritannien den Großteil ihrer afrikanischen Besitzungen bereits zu Anfang der 1960er-Jahre in die Unabhängigkeit entließen bzw. der Prozess der Machtübergabe eingeleitet war, bot neben der hartnäckig auf seinen afrikanischen Besitzansprüchen beharrenden portugiesischen Salazar-Diktatur vor allem das südafrikanische Apartheidsregime das Hauptangriffsziel.
Das „Jahr Afrikas“ fiel in dieser Hinsicht mit einem weiteren einschneidenden Ereignis zusammen: Im März 1960 eröffnete die südafrikanische Polizei in Sharpeville, einem township außerhalb von Johannesburg, das Feuer auf eine unbewaffnete Menge schwarzer Demonstranten. Nicht zum ersten Mal geriet Südafrika innerhalb der UN ins Kreuzfeuer der Kritik. Seit dem offiziellen Beginn der Apartheid 1948 hatten Länder wie Indien oder Ägypten den institutionalisierten Rassismus und die Brutalität des Regimes gegeißelt.
Die Ankunft der jungen afrikanischen Staaten in der Weltorganisation ein gutes Jahrzehnt später hob die Auseinandersetzung jedoch auf ein gänzlich neues Niveau. Man ließ keine Gelegenheit verstreichen, Pretoria an den Pranger zu stellen. Bei der Gründungskonferenz der Organisation Afrikanischer Einheit (OAU – Organization of African Unity) in Addis Abeba 1963 verschrieben sich die teilnehmenden Staatschefs ganz offiziell dem Ziel, das südafrikanische Regime in allen internationalen Gremien zu ächten und insbesondere die UN hierfür als Aktionsfeld zu nutzen. Mit einigem Erfolg: Neben einer Fülle von Resolutionen, in denen Apartheid verurteilt wurde, gelang es den afrikanischen Staaten, Südafrika langfristig zu isolieren und zum Rückzug aus dem UN-System zu zwingen. Bereits in den 1960er-Jahren verließ Pretoria freiwillig einige der Sonderorganisationen (ILO, UNESCO), bis Südafrika 1973 auch offiziell von der Vollversammlung und der Teilnahme an den Sitzungen anderer UN-Unterorganisationen ausgeschlossen wurde. Bis 1989 blieb die UN ein Hauptforum der internationalen Kampagne zur Ächtung und Überwindung der Apartheid. Unterhalb dieser Ebene begann die UN auf Drängen der afrikanischen Staaten bereits in den 1960er-Jahren damit, Studien zur Überwindung der Rassendiskriminierung in Auftrag zu geben sowie Programme zur Unterstützung der politischen Opposition in Südafrika aufzulegen.
Dabei barg auch die Auseinandersetzung mit Südafrika und Portugal aus Sicht der UN gehörigen politischen Sprengstoff, weil auch sie untrennbar mit den Auseinandersetzungen entlang der Ost-West-Achse verschränkt war. Viele westliche Länder stemmten sich lange – aus politischen, wirtschaftlichen und militärstrategischen Überlegungen heraus – gegen eine Isolation Pretorias und Lissabons, eine Position, aus der die Sowjetunion ihrerseits versuchte, politisches Kapital zu schlagen. Als nach dem Ende des Sechs_Tage-Krieges 1967 mit Israel ein direkter Verbündeter der USA zunehmend ins Visier der von Ländern des Südens dominierten Mehrheit der Vollversammlung geriet, beschleunigte dies aus Sicht der UN eine gefährliche Dynamik noch weiter: Die amerikanische Regierung reagierte nämlich auf die aus ihrer Sicht zunehmende „Politisierung“ der UN mit deutlichen Rückzugstendenzen – wobei in Washington „Politisierung“ quasi als Synonym für den ohnedies im Gefolge des Vietnamkrieges schmerzhaft wahrgenommenen Bedeutungs- und Kontrollverlust der USA innerhalb der Weltgemeinschaft diente.
Auch die UN-Offiziellen fürchteten während der 1960er-Jahre eine „Politisierung“ ihrer Organisation im Gefolge der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen – ein Grund, warum man von dieser Seite verstärkt versuchte, „technische“ Fragen, insbesondere entwicklungspolitischer Natur, in den Mittelpunkt zu rücken. Der Zustrom afrikanischer Staaten war dabei freilich nicht alleiniger Auslöser, gab dem Prozess jedoch an verschiedenen Stellen bedeutende Impulse: Indirekt zunächst, indem mit der großen Zahl von afrikanischen Staatsgründungen nach 1960 sogenannte Entwicklungsländer erstmals ein numerisches Übergewicht innerhalb der Vollversammlung erlangten. Auf institutioneller Ebene versinnbildlichten diesen Trend vor allem die Etablierung der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) und die Gründung von neuen, auf Entwicklungsfragen spezialisierten Unterorganisationen der UN wie der schon 1958 ins Leben gerufenen Economic Commission for Africa (ECA) oder der United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) 1966.
Auch die Mehrzahl der bestehenden UN-Agenturen verlegte zur selben Zeit den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Probleme der Länder des Südens. Parallel zum Ausbau seiner entwicklungspolitischen Programme erlebte das UN-System einen quantitativen und qualitativen Ausbau seiner multilateralen Finanzierungsmöglichkeiten. 1965 entstand das United Nations Development Program (UNDP), das im Verhältnis zu seinen Vorgängern wie dem Expanded Program of Technical Assistance (EPTA) von 1949 nicht nur über weitaus höhere Mittel verfügte, sondern auch längerfristige Projekte förderte. Schließlich begannen auch die von den westlichen Ländern dominierten Bretton-Woods-Institutionen Ende der 1950er-Jahre, ihre Aufmerksamkeit vom europäischen Wiederaufbau weg auf die Entwicklungspolitik zu lenken. Augenfällig wurde diese Neuausrichtung in der Gründung der International Development Association (IDA) unter dem Dach der Weltbank 1960, deren Aufgabe die Vergabe von zinslosen Darlehen an Entwicklungsländer war. Afrika war von Anfang an ein Schwerpunktgebiet der IDA-Arbeit. Bis in die Gegenwart floss etwa die Hälfte der von der IDA ausgeschütteten Darlehen nach Afrika. Hierin spiegelte sich nicht zuletzt die gestiegene Bedeutung wider, die einigen afrikanischen Ländern im Kontext des Kalten Krieges von westlicher Seite und insbesondere von Seiten der USA ab Ende der 1950er-Jahre beigemessen wurde.
Begleitet wurden diese Entwicklungen durch eine im Laufe der 1960er-Jahre grundsätzlicher werdende Debatte um die Strukturen des Welthandels. Viele westliche Geberländer begriffen dabei den Ausbau technischer und materieller Hilfe und ihre Verteilung über multilaterale Institutionen als Alternative zu den geforderten substanziellen Veränderungen in den Welthandelsstrukturen zugunsten der Länder des Südens. Diesen Strukturwandel zu vermeiden, war in der Tat ein wesentliches Motiv der USA für die Ausrufung einer „Entwicklungsdekade“ gewesen.
Die Vereinten Nationen waren in diesem Kontext der zentrale Ort der Auseinandersetzungen, wobei Afrika wiederum eine Schlüsselrolle zukam. Mit der Blockfreien-Konferenz in Belgrad 1961 begann ein Prozess des Zusammenschlusses der Länder des Südens, der mit der Gründung der „Gruppe der 77“ auf der ersten UNCTAD-Sitzung 1964 seinen formalen Abschluss fand. Neben den steten Ruf nach einer Erhöhung der multilateralen Hilfe traten hier unter dem Slogan trade not aid bald Forderungen nach internationalen Abkommen zur Sicherung der Rohstoffpreise und nach dem Zugang zu den Märkten der Industrienationen für die Erzeugnisse der Mitgliedsstaaten – Diskussionen, die in den 1970er-Jahren in das Projekt der „Neuen Weltwirtschaftsordnung“ münden sollten. Afrikanische Staatschef wie Julius Nyerere (Tansania) oder Kenneth Kaunda (Sambia) gehörten hierbei zu den Wortführern und nutzten UNCTAD als Podium, um auf die prekäre Lage der afrikanischen Rohstoffproduzenten hinzuweisen, die durch Preisverfall (im tansanischen Fall für Sisal) auf den Rohstoffmärkten Verluste erlitten, die den Umfang der gleichzeitig erhaltenen Entwicklungshilfe um ein Vielfaches übertrafen.
Jenseits der (gescheiterten) Bemühungen um eine Neuordnung der Weltwirtschaft im Rahmen der Vereinten Nationen ist die Bedeutung und Wirkungskraft des vom UN-System organisierten Transfers von Entwicklungsgeldern nach Afrika in den 1960er-Jahren schwer zu bemessen. Die Entwicklungsprojekte der UN reichten thematisch von der Einführung neuer landwirtschaftlicher Methoden – Afrikas Unabhängigkeit war ein wichtiger Impuls, der die ländlichen Gebiete und die Landwirtschaft allgemein verstärkt in den Fokus des Entwicklungsdenkens der Dekade rückte – über berufliche Ausbildungsmaßnahmen bis hin zur medizinischen Grundversorgung.
Im Vergleich zu der zur selben Zeit auf bilateraler Ebene geleisteten Hilfe blieben die über die UN verteilten Gelder jedoch auch nach der Einrichtung des UNDP noch verschwindend gering. Gleichwohl erschöpfte sich die Rolle der UN nicht im rein finanziellen Aspekt. Ebenso bedeutend, wenn nicht gar folgenreicher, waren die Aktivitäten, die die UN über Seminare, Ausbildungsprogramme und Konferenzen bei der Herausbildung von „Funktionseliten“ in den jungen afrikanischen Staaten entfaltete. Das UN-System diente als Reservoir, aus dem sich Expertenwissen in einer Vielzahl von Bereichen zu vergleichsweise niedrigen Kosten schöpfen ließ. Ob in Fragen wirtschaftlicher Planung, im Bildungsbereich oder im Gesundheitswesen, eine ganze Generation afrikanischer Funktionsträger durchlief die auf „Entwicklungsländer“ zugeschnittenen Aus- und Weiterbildungsprogramme von UN, WHO, FAO, ILO, UNESCO oder Weltbank. Einer weiteren Gruppe von jungen Afrikanern offerierten die Sekretariate des UN-Systems Jobmöglichkeiten, die als Sprungbrett für eine spätere Karriere in ihren Herkunftsländern dienen sollten. Die Auswirkungen dieser „Elitebildungsfunktion“ der UN zu untersuchen, erscheint als lohnende Aufgabe für künftige historische Forschungen.
Wenngleich die afrikanischen Regierungen die Bemühungen der Vereinten Nationen in diesen und anderen Bereichen würdigten, war das Verhältnis nicht ungetrübt. Konflikte entzündeten sich bereits im Verlauf der 1960er-Jahre insbesondere an Fragen der Repräsentation, und dies in doppelter Hinsicht: Die numerische Überlegenheit der „Entwicklungsländer“ innerhalb der Vollversammlung der UN und der Bedeutungsgewinn, den die Vollversammlung zur selben Zeit innerhalb des organisatorischen Gefüges der Vereinten Nationen gewann, konnten nicht über den geringen Einfluss hinwegtäuschen, den afrikanische Staaten auf die tatsächlichen Entscheidungsgremien besaßen. Der UN-Sicherheitsrat und seine Pendants in den Unterorganisationen (wie etwa der Exekutivrat der WHO oder der Verwaltungsrat der ILO) blieben fest unter Kontrolle der USA, der Europäer und des „Ostblocks“. Doch nicht nur in den „politischen“ Gremien, auch auf der Ebene der Sekretariate des UN-Systems blieb Afrikanern der Zugang zu Spitzenpositionen lange Zeit versperrt. Der erste Repräsentant des subsaharischen Afrikas an der Spitze einer UN-Organisation war der Senegalese Amadou M’Bow, der 1974 UNESCO-Generalsekretär wurde. Es sollte weitere 23 Jahre dauern, ehe mit dem Ghanaer Kofi Annan ein Vertreter jener Region erstmals auch den Posten des UN-Generalsekretärs erhielt.
Doch auch auf der mittleren Führungsebene blieben Afrikaner lange Zeit deutlich unterrepräsentiert. Fraglos minderte nicht zuletzt die fehlende Einheit und politische Zerrissenheit Afrikas lange Zeit ihre Chancen, mehr zu erreichen. Der Repräsentationsgrad Afrikas ebenso wie die Debatten um die Koordinaten der Weltwirtschaftsordnung spiegelten schlichtweg die fortbestehenden Ungleichheiten im internationalen System wider. Das Bewusstsein für diese Disparitäten und die unsichtbaren Mauern, an die Afrikas Politiker innerhalb der UN allenthalben stießen, bietet eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis der am Ende der 1960er-Jahre greifbaren Ernüchterung. Sie wurde nicht zuletzt in der verschärften Diskussion um den universellen Gehalt von Werten in der Weltgemeinschaft und insbesondere beim Thema Menschenrechte greifbar.
Im Gegensatz zur zeitlich vorgelagerten Entstehungsgeschichte der Vereinten Nationen war jene der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unmittelbar mit dem afrikanischen Dekolonisationsprozess verwoben. Im März 1957 zwischen den sechs Gründungsmitgliedern – Frankreich, Italien, die Beneluxländer und die Bundesrepublik – besiegelt, zielte die EWG zwar in erster Linie auf eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit dieser Länder etwa in der Agrar- oder Außenhandelspolitik und insbesondere auf die Errichtung eines gemeinsamen Binnenmarktes ab. Daneben barg sie jedoch aufgrund der sogenannten Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete der Mitgliedsstaaten von Beginn an eine nicht unerhebliche kolonialpolitische Dimension, aus der nach der Unabhängigkeit der meisten assoziierten afrikanischen Territorien im Afrikajahr 1960 enge entwicklungspolitische Beziehungen hervorgingen. Bedeutung erlangte dieser Aspekt der europäischen Integration vor allem deshalb, weil Frankreich die Assoziierung seiner afrikanischen Territorien in den Verhandlungen zum einen zur unumstößlichen Bedingung einer Vertragseinigung machte und zum anderen die daraus resultierenden finanziellen Mittel zur politischen wie wirtschaftlichen Stabilisierung seiner überseeischen Besitzungen einsetzen wollte.
Während also die Vereinten Nationen mehr und mehr zu einem dekolonisationspolitischen Forum wurden, schien zeitgleich die EWG zumindest in den Augen der französischen Architekten der Assoziierung eine geeignete Institution zu sein, um Pariser Souveränitätsansprüche in Afrika aufrechtzuerhalten. Entsprechend brüsk protestierte die französische Regierung gegen erste Versuche der EWG-Kommission, eigene Kontakte mit den frankophonen afrikanischen Territorien aufzubauen. Auch setzte sie sich bald über ihre bei Vertragsschluss gegebene Erklärung hinweg, keine finanziellen Mittel aus Brüssel für das kriegsgeschüttelte Algerien zu beantragen. Vielmehr sollte sich der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) an der französischen Entwicklungspolitik in Algerien beteiligen, die elementarer Bestandteil eines wütend geführten „Modernisierungskrieges“ (Stephan Malinowski) war. Die Bundesregierung wie auch die übrigen Mitgliedsstaaten leisteten dabei nur halbherzig Widerstand gegen den Pariser Vorstoß.
Dass die EWG-Assoziierung ihrer Entstehung nach ein Kind des Spätkolonialismus war, verdeutlicht ferner das eingangs erwähnte Schicksal Guineas, das nach der mit seinem Weg in die Unabhängigkeit verbundenen Ablehnung der Communauté auch seinen Status als assoziierter Staat der EWG und entsprechende Ansprüche auf den EEF verlor. Dieses Vorbild vor Augen dachten die Verantwortlichen in Bonn und Den Haag sogar kurzzeitig darüber nach, die Dekolonisation der assoziierten Staaten, die sich breitenwirksam seit Herbst 1959 abzuzeichnen begann, zum Anlass zu nehmen, die ungeliebte Assoziierung zu beenden.
Soweit kam es freilich nicht, weil insbesondere Deutschland vor dem Hintergrund des Kalten Krieges der Assoziierung mehr und mehr politischen Nutzen abgewinnen konnte: Der Bundesregierung war nun in erster Linie daran gelegen, die unabhängig gewordenen frankophonen Länder Afrikas „im Fahrwasser des Westens“ zu halten, wie eine damals gängige Wendung lautete. Für die französische Afrikapolitik hatte sich demgegenüber durch die Dekolonisation kaum etwas an der Funktion und Bedeutung der EWG-Assoziierung geändert; sie blieb ein ergänzendes Instrument, um französische Präsenz vor Ort zu garantieren bzw. im Lauf der Zeit auszubauen. Darin spiegelte sich nicht zuletzt auch Frankreichs Streben wider, sich als Dritte Kraft zwischen den Supermächten zu positionieren, eine Idee, die im Übrigen auch innerhalb der EWG-Kommission Anklang fand. Schließlich zeigten die assoziierten Staaten selbst großes Interesse an einer Fortsetzung der Beziehungen zur Gemeinschaft, weil sie sich davon materielle Vorteile erhofften. Die erste Yaoundé-Konvention von 1963 ersetzte so die oktroyierte Assoziierung durch ein multilateral ausgehandeltes Abkommen und stellte dadurch die Beziehungen zwischen der EWG und Afrika auf eine neue Grundlage.
Anders als die Vereinten Nationen wurde die EWG jedoch nicht zu einem internationalen Forum, wo antikoloniale Reden gehalten und weltpolitische Ereignisse debattiert wurden. Weder Portugals fortgesetzte Kolonialherrschaft noch Südafrikas Apartheidsregime, ja nicht einmal der in ihren Anfängen noch fortdauernde Algerienkrieg wurden zwischen den europäischen und assoziierten Ländern in nennenswerter Weise thematisiert. Sogar die Kongo-Krise löste, obwohl die ehemals belgische Kolonie von Beginn an der EWG assoziiert war, keine größeren Debatten aus.
Dieser vordergründig apolitische Charakter der Assoziierung hatte unterschiedliche Ursachen. Zum einen erschien es im Hinblick auf Portugal und Südafrika wenig fruchtbar, die Foren der EWG zu nutzen, da beide Staaten mit der Gemeinschaft kaum in Verbindung standen. Zum anderen entsprach es auch (noch) keineswegs dem Selbstverständnis der Gemeinschaft, in internationalen politischen Angelegenheiten einheitlich Position zu beziehen. Vor allem deshalb verhielt sich die EWG-Kommission in der Kongo- wie auch in der Algerienfrage neutral, während die Mitgliedsstaaten ihre je eigenen Außenpolitiken verfolgten. Die afrikanischen Staaten sahen außerdem in ihren panafrikanischen Organisationen sowie in den Vereinten Nationen geeignetere Podien, um Kritik an den ehemaligen Kolonialmächten zu üben. Insbesondere die frankophonen Staaten wollten die französische Regierung in Brüssel nicht vor den Kopf stoßen, zumal letztere aus naheliegenden Gründen gegenüber den übrigen Mitgliedstaaten regelmäßig in die Rolle des Anwalts der assoziierten Staaten schlüpfte.
Wenngleich die EWG als internationale Organisation also kein Forum antikolonialer Debatten war, gab doch die Assoziierung an sich Anlass zu harscher Kritik von Seiten all derjenigen, die nicht assoziiert waren – insbesondere von anglophonen afrikanischen Staaten. Gerade Länder wie Ghana, die zeitweise gute Beziehungen zur Sowjetunion unterhielten, brandmarkten das eurafrikanische Regime anfangs als Ausgeburt des Neokolonialismus, welche den Dekolonisationsprozess verzögere – eine Kritik, der sich Moskau umgehend anschloss. Ferner befürchteten nicht nur afrikanische „Entwicklungsländer“, aufgrund der Assoziierung handelspolitisch benachteiligt zu werden. Eine breite Front von südlichen Ländern stellte sich auf den nicht ganz unberechtigten Standpunkt, dass die Assoziierung gegen GATT-Vorschriften verstieß. Dieser Kritik schlossen sich auch die USA an, wobei sie die Assoziierung unter politischen Gesichtspunkten durchaus positiv beurteilten, zumal Washington ihr eine Stabilisierungsfunktion im Systemkonflikt beimaß.
Die Assoziierung verfestigte insoweit auch die afrikanische Spaltung entlang der Sprachgrenzen und konterkarierte zugleich panafrikanische Initiativen sowohl innerhalb des Kontinents als auch in internationalen Organisationen. So wirkte die EWG beispielsweise als Bremse bei dem Versuch, regionale Integration in Westafrika jenseits der Sprachengrenzen zu organisieren. Nicht zufällig war im langjährigen Gründungsprozess der Economic Community of Westafrican States (ECOWAS), die 1975 ins Leben gerufen wurde, nicht die EWG die treibende Kraft, sondern die UN, die vor allem über die Economic Commission for Africa in Erscheinung trat. Freilich verstärkte die EWG hierbei lediglich die innerafrikanische Blockbildung, für die in erster Linie Frankreich – im Übrigen ganz bewusst – verantwortlich zeichnete. Auch in der UNO selbst machte sich dies bemerkbar, da sich Paris bei so umstrittenen Themen wie französischen Atombombenversuchen in der Sahara oder der Dekolonisation der französischen Somali-Küste (seit 1977 Dschibuti) der Unterstützung einiger seiner ehemaligen Kolonien sicher sein konnte.
Dass Paris und Brüssel für Regierungen in Dakar oder Ouagadougou die ersten Jahre nach der Unabhängigkeit weitaus wichtigere Anlaufstationen waren als etwa Washington, Moskau, New York oder auch Accra, lässt sich in erster Linie auf das entwicklungspolitische Regime zurückführen, das Frankreich und die EWG am Vorabend der Dekolonisation errichtet hatten. Ohne französische Transferleistungen für die Verwaltung, das Erziehungswesen, aber auch bei Telekommunikation und Verteidigung, wäre wohl kaum einer der frankophonen afrikanischen Staaten überlebensfähig gewesen. Gerade weil der Großteil der französischen Entwicklungshilfe in Sektoren floss, die eine – wenngleich teils rudimentär funktionierende – Staatlichkeit ermöglichen sollten, wurde der Europäische Entwicklungsfonds in manchen Ländern wie etwa dem Senegal zur bedeutendsten Einnahmequelle, um eine gestaltende Entwicklungspolitik in Angriff zu nehmen. Kurzum erhielten viele frankophone Staaten in den 1960er-Jahren von der EWG weit mehr Entwicklungshilfe als von der UNO, den USA, der UdSSR oder auch der Bundesrepublik.
Entsprechend bedeutsam war der Einfluss der Gemeinschaft auf die Entwicklung der assoziierten Staaten. Dabei machten sich nicht so sehr einzelne Projekte bemerkbar, unabhängig davon, ob diese Erfolge zeitigten oder als „weiße Elefanten“ endeten. Weitaus nachhaltigere Folgen hatte die im ersten Abkommen festgelegte grundsatzpolitische Weichenstellung, französische Agrarsubventionen abzuschaffen. Frankreich hatte seit Anfang der 1950er-Jahre für verschiedene Erzeugnisse aus seinen Territorien Marktordnungen eingeführt und dadurch in der Regel über dem Weltmarkt liegende Preise festgesetzt und Abnahmegarantien gewährt. Ebenjenes System wurde mit der Erneuerung der Assoziierung 1963 zu Grabe getragen, da es mit der europäischen Gemeinsamen Agrarpolitik nicht vereinbar war, die zeitgleich in Angriff genommen wurde.
Infolgedessen wurden die assoziierten Staaten dazu verpflichtet, ihre landwirtschaftlichen Monokulturen den Gesetzen des Weltmarktes zu unterwerfen. Als Kompensation legte die EWG sogenannte Produktions- und Diversifizierungsprogramme auf, die auf fünf Jahre angelegt waren und diese Integration in die freie Weltwirtschaft abfedern helfen sollten. Die Bilanz war in manchen Ländern wie dem Tschad oder dem Senegal desaströs, weil die dort ansässigen Baumwoll- bzw. Erdnussbauern eine rapide Absenkung ihrer Löhne in Kauf nehmen mussten, während zugleich die Modernisierungsmaßnahmen, die den Lohnverfall durch einen Produktionszuwachs und eine Diversifizierung der Landwirtschaft ausgleichen sollten, nicht fruchteten. Abstrakter formuliert, beeinflusste die EWG mit ihrer Entwicklungspolitik in den 1960er-Jahren die Volkswirtschaften der jungen afrikanischen Staaten ähnlich intensiv, wie dies die – strategisch ganz anders gelagerten – Strukturanpassungsprogramme von Weltbank und IWF zu Beginn der 1980er-Jahre taten.
Zugleich zeigte sich hier eine Parallele zu den Entwicklungen innerhalb des UN-Systems und insbesondere der UNCTAD: Auch bei der EWG konnten sich die assoziierten Staaten mit ihren Forderungen nach einer gerechteren Welthandelsordnung lange Zeit nicht durchsetzen. Erst Großbritanniens Beitritt zur Gemeinschaft 1973 und das zwei Jahre später beschlossene erste Lomé-Abkommen, das nun auch die anglophonen Staaten der EWG assoziierte, ebnete den Weg zu einem – allerdings äußerst restriktiv gehandhabten – System zur Stabilisierung von Exporterzeugnissen (STABEX). Dass bei dieser Entwicklung die Debatten um die bereits genannte Neue Internationale Weltwirtschaftsordnung gewisse katalytische Effekte erzeugten, dürfte kaum von der Hand zu weisen sein.
Umgekehrt und im Vergleich zu den Umwälzungen bei der Weltorganisation hatte die afrikanische Dekolonisation respektive die Assoziierung nun souveräner afrikanischer Staaten nur geringe Auswirkungen auf andere, „europäische“ Politikbereiche der EWG. In der Tat war allen Mitgliedsstaaten daran gelegen, die Beziehungen zu den afrikanischen Staaten auch institutionell zu separieren. Mit dem ersten Abkommen von Yaoundé wurden eigene Institutionen wie der Assoziationsrat und -ausschuss und sogar eine eurafrikanische Parlamentarierkonferenz geschaffen. Überwiegend als Konsultations- und Informationsforen angelegt, sollten diese zwar eine gleichberechtigte entwicklungspolitische Partnerschaft symbolisch zum Ausdruck bringen, waren zugleich aber auch Abbild des Assoziiertenstatus der afrikanischen Länder. So wurden die folgenreichsten Entscheidungen für jene Länder, etwa zur Gemeinsamen Agrarpolitik, aber auch entwicklungspolitische Projekte, in rein europäischen Gremien debattiert und beschlossen.
Die daraus resultierende Asymmetrie schien bei der EWG weit größere Ausmaße anzunehmen als bei den UN-Organisationen und spiegelte sich auch in der täglichen Arbeit der Kommission wider. Während vor der Unabhängigkeit afrikanische Funktionsträger noch als reguläre Mitarbeiter bei der Kommission eingestellt wurden und dadurch dem Vorbild der damals herrschenden politischen Praxis in der Union française nachgeeifert wurde, setzte mit der Dekolonisation ein abruptes Umdenken in Brüssel ein. Statt Afrikaner vollständig in den Arbeitsprozess zu integrieren, warben die verantwortlichen Funktionäre bei den afrikanischen Regierungen dafür, Beamte als Praktikanten nach Brüssel zu schicken. In der Tat erlebten jene Beamte, die für ein Jahr bei der EWG hospitierten, klassische Praktikumserfahrungen, die von der Konfrontation mit desinteressierten, bisweilen auch herablassenden Vorgesetzten über inhaltliche Unterbeschäftigung bis hin zu fehlenden Arbeitsplätzen reichten.
Wenngleich die Repräsentation und der Einfluss von Afrikanern in der europäischen Organisation also weitaus geringer blieb als bei den Vereinten Nationen, so hatte die Entwicklungspolitik der EWG insgesamt betrachtet doch spürbare Rückwirkungen auf die Mitgliedsstaaten. Insbesondere in Frankreich wurde die gemeinschaftliche Entwicklungspolitik nicht nur als begrüßenswerte Ergänzung, sondern streckenweise auch als Konkurrenz empfunden. Aufgrund der multinationalen Zusammensetzung der EWG-Kommission setzten sich in Brüssel rasch neue Entwicklungsstrategien und Evaluationskriterien durch, die insbesondere Paris dazu veranlassten, überkommene Praktiken zu überdenken und ein Stück weit den europäischen anzupassen. In diesem Sinne erhielt das Auftreten internationaler Organisationen wie der EWG im unabhängigen Afrika nach 1960 auch eine gewisse Bedeutung für die ehemaligen Metropolen und weitere europäische Mitgliedsstaaten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass beide internationale Organisationen nicht nur immense, wenngleich unterschiedlich gewichtete Bedeutung für das dekolonisierte Afrika erlangten, sondern auch umgekehrt von diesen Umwälzungen wesentlich geprägt und beeinflusst wurden. Während die UN den neuen afrikanischen Staaten ein hervorragendes Podium bot, um die neu gewonnene Souveränität nach außen zu demonstrieren sowie nach innen zu stabilisieren und insbesondere den internationalen Kampf gegen den Kolonialismus wirksam fortzusetzen, nahmen die mit der EWG assoziierten Länder die damit verbundenen materiellen Vorzüge gerne an und verteidigten diese eifersüchtig gegen solche „Entwicklungsländer“, die dieses regionale Arrangement als kolonialistisch brandmarkten. Zieht man noch die alles überstrahlende Blockkonfrontation hinzu, die freilich innerhalb der UN weit mehr zur Geltung kam als innerhalb der ausschließlich von westlichen Staaten getragenen EWG, so kristallisiert sich im Spiegelbild der afrikapolitischen Aktivitäten dieser beiden internationalen Organisationen jene komplexe polyzentrische Machtkonstellation heraus, die nach der Dekolonisation den afrikanischen Kontinent bestimmte.
Das Ende der Kolonialreiche in Afrika wirkte jedoch auch auf die internationalen Organisationen zurück. Insbesondere das UN-System erfuhr durch die Dekolonisation Afrikas und die damit verbundene Verschiebung der Kräfteverhältnisse eine unumkehrbare Modifizierung, was sich vor allem am schrittweisen Rückzug der USA aus den Aktivitäten der Vereinten Nationen zeigte. Darüber hinaus wandelten sich auch die schwerpunktmäßigen Tätigkeitsbereiche der UN, die sich zunehmend entwicklungspolitischen Problemen der „Dritten Welt“ annahm und im Lauf der 1960er-Jahre mehrere darauf ausgerichtete Sonderorganisationen und -programme ins Leben rief. Demgegenüber hätte die EWG sogar womöglich nie das Licht der Welt erblickt, wenn sich die zögerlichen Niederlande und die Bundesrepublik im Februar 1957 geweigert hätten, das frankophone Afrika zu protegieren. Mit der Assoziierung zementierte die EWG letztendlich Frankreichs Sonderstellung, vermochte es jedoch trotz oder gerade wegen dieses Arrangements, Afrika von den weiteren Dimensionen der europäischen Integration weitgehend fernzuhalten.
Zweifellos wirkte sich das unterschiedliche Design der beiden Organisationen auch auf ihre Afrika- bzw. Entwicklungspolitik aus. Die EWG blieb lange Zeit einem – freilich umstrittenen – regionalen Ansatz verpflichtet, der kolonialhistorisch bedingte Gräben verfestigte, während das UN-System seit der Dekolonisation den gesamten Kontinent im Blick hatte. Inhaltlich machte dies jedoch keinen großen Unterschied: Weder in New York noch in Brüssel konnten die afrikanischen Staaten auf Unterstützung für den Aufbau einer gerechteren Welthandelsordnung hoffen. In kaum einer anderen Frage waren die Fronten des Nord-Süd-Konfliktes so klar gezeichnet wie bei jener Auseinandersetzung, die im Übrigen bis heute einer Lösung harrt. Inwieweit die immensen Transferleistungen der UN und, bedeutsamer noch, der EWG seit der Dekolonisation zur Entwicklung Afrikas beigetragen haben, lässt sich schwer bemessen und müsste wohl für jedes einzelne Land individuell untersucht werden – ein Unterfangen, das die Geschichtswissenschaft bislang nur vereinzelt in Angriff genommen hat. Deutlich geworden ist zumindest, dass die Dekolonisierung Afrikas ganz wesentlich auch internationale Organisationen involvierte und von diesen mitgestaltet wurde. Es bleibt zu hoffen, dass dieser vielschichtige Wandel, den die Integration des afrikanischen Kontinents in die internationale Gemeinschaft sowohl in Afrika selbst als auch in den internationalen Organisationen auslöste, von der Geschichtswissenschaft in Zukunft stärkere Aufmerksamkeit erfahren wird.
Weiterführende Literatur (Auswahl)
Amrith, Sunil/Sluga, Glenda, "New Histories of the United Nations", in: Journal of World History 19, 3 (2008), 251-274.
Bitsch, Marie-Thérèse/Bossuat, Gérard (Hg.): L'Europe unie et l'Afrique: de l'idée d'Eurafrique à la convention de Lomé I, Brüssel 2005.
Brüne, Stefan: Die französische Afrikapolitik: Hegemonialinteressen und Entwicklungsanspruch, Baden-Baden 1995.
Cooper, Frederick: Africa since 1940. The Past of the Present, Cambridge 2002.
Cosgrove-Twitchett, Carol: Europe and Africa. From Association to Partnership, Farnborough 1978.
Kennedy, Paul: Das Parlament der Menschheit. Die Vereinten Nationen und der Weg zur Weltregierung, München 2007.
Maul, Daniel: Menschenrechte, Sozialpolitik und Dekolonisation. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 1940-1970, Essen 2007.
Maul, Daniel: Internationale Organisationen als historische Akteure. Die ILO und die Auflösung der europäischen Kolonialreiche 1940-1970, in: Archiv für Sozialgeschichte 48 (2008), 21-53.
Migani, Guia: La France et l'Afrique sub-saharienne, 1957-1963: histoire d'une décolonisation entre idéaux eurafricains et politique de puissance, Brüssel 2008.
Moser, Thomas: Europäische Integration, Dekolonisation, Eurafrika: eine historische Analyse über Entstehungsbedingungen der Eurafrikanischen Gemeinschaft von der Weltwirtschaftskrise bis zum Jaunde-Vertrag, 1929 - 1963, Baden-Baden 2000.
Prashad, Vijay: The Darker Nations. A People’s History of the Third World, New York/London 2007.
Rempe, Martin/Schneider, Tilmann: "50 Jahre 'EUropa' in Westafrika. Zum Verhältnis europäischer und westafrikanischer Integration", in: Pernice, Ingolf/Engelhardt, Benjamin von u. a. (Hg.), Europa jenseits seiner Grenzen. Politologische, historische und juristische Perspektiven, Baden-Baden 2009, S. 37-52.
Rempe, Martin: "Airy Promises: the Senegal and the EEC's Common Agricultural Policy in the 1960s", in: Patel, Kiran Klaus (Hg.), Fertile Ground for Europe? The History of European Integration and the Common Agricultural Policy since 1945, Baden-Baden 2009, S. 221-240.
Stokke, Olav: The UN and Development: From Aid to Cooperation, Indiana 2009.
Vahsen, Urban: Eurafrikanische Entwicklungskooperation. Die Assoziierungspolitik der EWG gegenüber dem subsaharischen Afrika in den 1960er Jahren, Stuttgart 2010.
[1] Vgl. ausführlich dazu den demnächst in diesem Forum zu lesenden Beitrag von Kathrin Zippel.
Zitation
Daniel Maul, Martin Rempe, Wandel durch Integration. Afrikanische Dekolonisierung und Internationale Organisationen , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/wandel-durch-integration