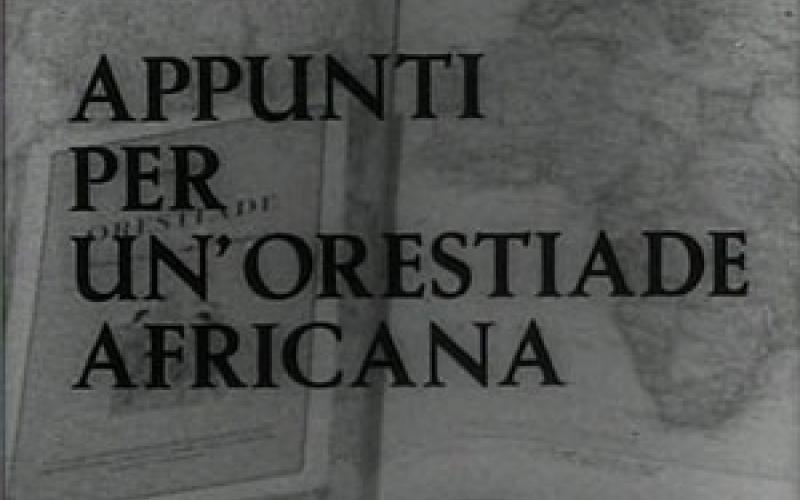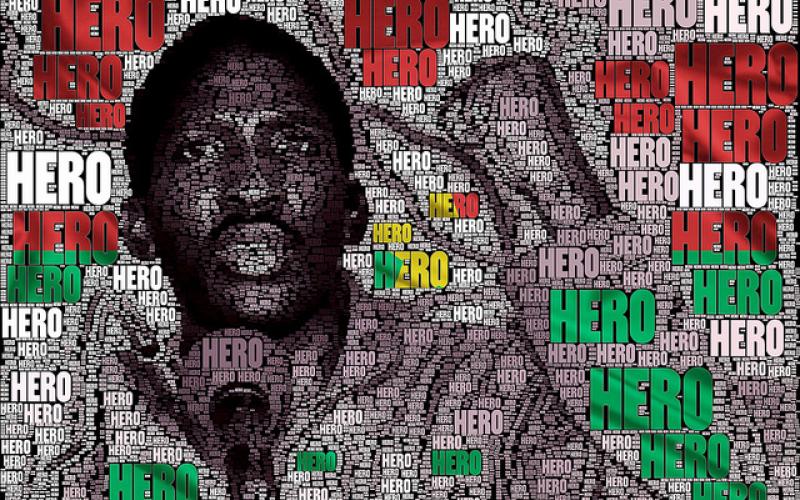Die Dekolonisation geschieht niemals unbemerkt, denn sie betrifft das Sein, sie modifiziert das Sein grundlegend, sie verwandelt die in Unwesentlichkeit abgesunkenen Zuschauer in privilegierte Akteure, die in gleichsam grandioser Gestalt vom Lichtkegel der Geschichte erfasst werden.
Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, 1961
In seinem bekanntesten Buch Die Verdammten dieser Erde warnte der Kulturtheoretiker, Mediziner und antikoloniale Aktivist Frantz Fanon 1961, die junge Unabhängigkeit vieler afrikanischer Länder sei durch Neokolonialismus und neue Diktaturen gefährdet. Fanon war im französischen Überseedepartement Martinique aufgewachsen, hatte in Frankreich Medizin und Philosophie studiert und seit 1956 als Psychiater in Algerien und Tunesien gearbeitet. Fanon, der dort in seinem Arbeitsalltag täglich mit den schweren psychischen Störungen konfrontiert war, unter denen Opfer und Täter kolonialer Gewalt litten, näherte sich immer mehr der algerischen Befreiungsbewegung Front de Libération Nationale (FLN) an. Als Diplomat in verschiedenen afrikanischen Ländern, als Arzt, Journalist und Theoretiker unterstützte Fanon bald mit vollem Einsatz die FLN in deren bewaffneten Kampf für die Unabhängigkeit Algeriens von der französischen Kolonialherrschaft.
Trotz seiner Warnung vor den Fallstricken der postkolonialen Entwicklung in Afrikas neuen Nationalstaaten zeichnete Fanon aber insgesamt ein positives, ja euphorisches Bild vom Aufbruch, den der afrikanische Kontinent durch die Dekolonisierung genommen hatte. In seinen Augen handelte es sich um eine umfassende Befreiung: Sie war Emanzipation im politischen Sinne, hatte aber auch eine wirtschaftliche, soziale, kulturelle und psychologische Dimension. Die durch den Kolonialismus gelähmten Menschen in Afrika hätten, so Fanon, in der Dekolonisierung wieder zueinander und zu sich selbst gefunden und ihre Handlungs- und Gestaltungskompetenz zurückerobert. Nachdem Europa die Afrikanerinnen und Afrikaner in der Tradition Hegels lange als „geschichtslose Völker“ betrachtet hatte, belegten ihre Regierungsübernahme in zahlreichen Kolonien und der Unabhängigkeitskrieg in Algerien in Fanons Augen nicht weniger als ihren „Wiedereintritt in die Geschichte“.
Sicherlich ist die Geschichte nichts, aus dem oder in das Einzelne oder Gesellschaften nach Belieben aus- oder wieder eintreten können. Was Fanon mit dieser Metapher hervorhob, war die Selbstermächtigung der bislang in relative Ohnmacht gezwungenen Menschen in den afrikanischen Kolonien, die für ihn in der Dekolonisierung zum Ausdruck kam. Damit wandte er sich zugleich programmatisch gegen den Eurozentrismus, mit dem die kolonisierenden Gesellschaften Europas sich jahrzehntelang selbstverständlich als Ursprung, Zentren und Modell allen „historischen Fortschritts“ begriffen hatten.
Dem historischen Moment, den die damals weit verbreitete Metapher vom „Wiedereintritt in die Geschichte“ bezeichnet, seinen Voraussetzungen und besonders auch seinen Folgen, die bis in die Gegenwart reichen, widmet sich der vorliegende Themenschwerpunkt auf Zeitgeschichte-online. Vor einem halben Jahrhundert, im sogenannten Afrika-Jahr 1960, erreichte die Dekolonisation des Kontinents ihren Höhepunkt. In Nordafrika waren Libyen (1951) sowie Marokko und Tunesien (1956) bereits staatsrechtlich eigenständig, als die britische Kolonie Gold Coast in Westafrika unter dem Druck des zukünftigen Staatspräsidenten Kwame Nkrumah und seiner Convention People’s Party 1957 ihre Unabhängigkeit unter dem Namen Ghana erlangte. Großbritannien steuerte nun immer deutlicher auf die Auflösung seines Empire auch in Afrika zu. Die Anfang 1960 von Premierminister Harold MacMillan in Südafrika gehaltene „Wind of Change“-Rede machte die Einsicht der britischen Führung in die irreversible Dynamik nationaler Bewegungen auf dem Kontinent in medienwirksamer Form öffentlich.
Um den französischen Einfluss in Afrika dennoch zu erhalten, hatte Frankreichs Präsident Charles de Gaulle 1958 die „Französische Gemeinschaft“ zwischen der Französischen Republik und ihren Kolonien in West- und Zentralafrika (außer Guinea, das diese Lösung in einer Volksbefragung ablehnte) ins Leben gerufen. Dies war der letzte in einer langen Reihe französischer Versuche, dem wachsenden internationalen und in den Kolonien selbst ausgeübten Druck zur Unabhängigkeit mit begrenzten politischen Reformen zu begegnen. Tatsächlich waren Reformen aber keine langfristige Lösung mehr, und die Gemeinschaft wurde daher keine zwei Jahre alt: In den bis dahin kolonisierten Gebieten des Kontinents bildeten sich im „Afrika-Jahr“ 1960 nicht weniger als 17 neue souveräne Staaten,[1] und 14 von ihnen waren zuvor Teil des französischen Afrika-Imperiums gewesen.
Zwar gab es Ausnahmen wie Algerien, wo ein opferreicher Dekolonisierungskrieg noch bis 1962 geführt wurde, die portugiesischen Afrika-Kolonien, die erst 1974/75 unabhängig wurden, oder die rassistische Weiße Minderheitsregierung in Südafrika, die bis 1990 andauerte. Fast überall sonst auf dem afrikanischen Kontinent hatten aber 1960 von N’Djamena (Tschad) über Abidjan (Elfenbeinküste) und Dakar (Senegal) bis Tananarive (Madagaskar) die neuen Landesfarben der „jungen Nationen“ endgültig die alten Flaggen der Kolonialmächte ersetzt. Mit diesem Machtwechsel verbanden sich nicht nur für Fanon, sondern überall in Afrika hochfliegende Hoffnungen auf Frieden innerhalb und zwischen den afrikanischen Nationalstaaten, auf ihre wirtschaftliche „Entwicklung“, die Freiheit von materieller Not und die Hebung des Lebensstandards für die Afrikaner/innen, auf politische Stabilität und die per Verfassung garantierte Herrschaft des Rechts, schließlich auf die Teilhabe der Bevölkerungen am öffentlichen Leben und seinen Entscheidungsprozessen.
Unter den Territorien, die im „Afrika-Jahr“ 1960 die Kolonialherrschaft ablegten, hat die belgische Kongo-Kolonie besondere Bekanntheit erlangt. Fast auf den Tag genau 50 Jahre bevor dieser ZOL-Themenschwerpunkt online geht, wurde am 30. Juni 1960 in Léopoldville die Unabhängigkeit der Republik Kongo proklamiert. Der Festakt in Anwesenheit der höchsten Repräsentanten der bisherigen Kolonialmacht und der zukünftigen Republik Kongo war in mehrfacher Hinsicht denkwürdig.
Bemerkenswert war die Unabhängigkeitsfeier zunächst, weil dort zwei historische Narrative aufeinanderprallten. In seiner Ansprache rühmte der belgische König Baudoin I. in Léopoldville die vermeintlichen zivilisatorischen Leistungen, mit denen sich Belgien seiner Meinung nach um den Kongo verdient und zugleich die Kongolesinnen und Kongolesen für die Unabhängigkeit „reif“ gemacht habe. Der erst 35 Jahre junge und von vielen als charismatisch beschriebene Patrice Lumumba, der fünf Tage zuvor zum ersten Ministerpräsidenten der Republik Kongo gewählt worden war, widersprach dem König anschließend vehement in einer leidenschaftlichen Rede, die bis heute berühmt ist.[2]
Der kolonialen Legitimationserzählung von der „europäischen Zivilisierungsmission“ als einer schweren, aber noblen „Bürde des weißen Mannes“ in Afrika setzte Lumumba eine Erzählung entgegen, die von der körperlichen Gewalt, der psychologischen Erniedrigung und der systematischen Diskriminierung sprach, mit der die Schwarzen Kongoles/innen durch Weiße Kolonialbeamte, Unternehmer und Siedler in allen Lebensbereichen einer rassistisch segregierten Gesellschaft unterdrückt worden waren. Lumumba sprach von erlittenem Unrecht, aber auch vom Stolz der Kolonisierten. Er rief die Leiden der Vergangenheit in Erinnerung, doch er versprach, dass sie jetzt endgültig Geschichte seien: „Tout cela est désormais fini.“ Vor allem aber betonte er, dass die bessere Zukunft, die den Kongoles/innen jetzt offenstehe, dass Rechtssicherheit und Pressefreiheit, soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde, die nun das Leben der jungen Nation bestimmen würden, von ihnen selbst erkämpft worden seien. Lumumba wollte sich nichts von einem gnädig gewährten und planvoll gestalteten „Rückzug“ der europäischen Kolonialherren und ihrer „Machtübergabe“ an die Kongolesinnen und Kongolesen erzählen lassen. Er pries stattdessen den selbstbestimmten, stolzen und entbehrungsreichen „Kampf“, mit dem diese den alten Herrschern ihre Unabhängigkeit abgetrotzt hätten.
Offenbar sprach Patrice Lumumba damit vielen seiner Zuhörer/innen aus dem Herzen. Immer wieder unterbrachen diese mit stehenden Ovationen die kurze Ansprache des Ministerpräsidenten. Bemerkenswert war die Unabhängigkeitsfeier jedoch nicht nur, weil unmittelbar während des Staatsaktes koloniale und antikoloniale Legitimationserzählungen in einer ungewöhnlichen, flüchtigen Konstellation politischer Öffentlichkeit „zwischen“ Kolonialismus und Dekolonisation dramatisch und gefühlsbeladen aufeinanderprallten. In anderer Weise denkwürdig schienen Lumumbas Worte auch einige Zeit später, im Rückblick auf das, was für die Zuhörer/innen der Rede am 30. Juni 1960 noch ein offener, vielversprechender Zukunftshorizont gewesen war, für viele aber bald zu einer tiefen Enttäuschung wurde: die ersten Monate der kongolesischen Unabhängigkeit.
Tatsächlich entsprach die Entwicklung nach dem Abzug der Belgier den Hoffnungen des Nationalisten Lumumba und seiner Unterstützer/innen keineswegs. Das postkoloniale nation building in dem von ihnen angestrebten Sinne war vielmehr zu Ende, bevor es richtig angefangen hatte. Die Meuterei weiter Teile der kongolesischen Armee, die Sezession der an Bodenschätzen reichen Katanga-Region, die Desintegration der kongolesischen Regierung und die Gewalt der Milizen stürzten das Land nur wenige Tage und Wochen nach dem Festakt im Juni 1960 in einen blutigen Bürgerkrieg, in dem ethnisierte politische und soziale Konflikte das riesige Land für Lumumba unregierbar machten. Die Häme, mit der manche in Europa diese Entwicklung als Beleg für den „Tribalismus“ und die politische „Unreife“ „der“ Afrikaner werteten, war nicht nur in der seit Jahrzehnten bekannten Weise rassistisch. Sie gab sich auch blind für die strukturellen Hypotheken der Kolonialzeit, die das junge Land schwer belasteten und damit auch ihren Teil Schuld an seiner postkolonialen Entwicklung trugen. Vor allem aber blendete sie aus, dass sich nicht nur die Vereinten Nationen im Rahmen des ONUC-Einsatzes, sondern auch Belgien, die USA und andere westliche Mächte verdeckt am kongolesischen Bürgerkrieg beteiligten. Diese Länder – wie auch die UdSSR, die Lumumba um Hilfe bat, nachdem die USA sie ihm verweigert hatte –, verfolgten dabei ihre eigenen Interessen. Für sie ging es um den Zugang zu Rohstoffen wie Kupfer und Diamanten, um die Aufrechterhaltung politischen Einflusses oder um die Abwehr der „kommunistischen Gefahr“, zu deren Symbol Lumumba fälschlicherweise stilisiert wurde.
Lumumba selbst wurde in einem klaren Verstoß gegen die Verfassung vom kongolesischen Staatspräsident Joseph Kasavubu im September 1960 seines Amtes enthoben, bald unter Hausarrest gestellt, schließlich bei einem Fluchtversuch von den Soldaten des Armeechefs und Putschisten Joseph-Désiré Mobutu gefangengenommen und in die von Moïsé Tschombé regierte sezessionistische Provinz Katanga überstellt. Dort demütigten und töteten ihn Soldaten und Polizisten Tschombés unter der Beteiligung oder jedenfalls mit Wissen und Billigung belgischer und wahrscheinlich auch US-amerikanischer Stellen. Mobutu wiederum installierte im Kongo eine Diktatur, die mit Unterstützung des Westens im Kontext des Kalten Krieges bis 1997 andauerte und deren Folgen das Land bis heute schwer belasten.
Dass sich die mit der Dekolonisierung verbundenen Hoffnungen auch außerhalb des Kongo in den letzten 50 Jahren in vielen Ländern nicht oder nur sehr unvollständig erfüllt haben, ist ein Allgemeinplatz, den lediglich zu wiederholen nicht das Ziel des vorliegenden Themenschwerpunktes sein kann. Die Enttäuschung über die schwache, sogar rückläufige oder fehlgeleitete „Entwicklung“ des Kontinents führte bereits seit Mitte der 1960er-Jahre zu einem miserabilistischen Afrikabild, das westliche Politiker/innen und Medien bis in die Gegenwart immer wieder erneuert haben, wenngleich differenziertere Berichte, die auf die schlimmsten Klischees verzichten, in den letzten Jahren deutlich zahlreicher geworden sind.
Ethnisierte Konflikte, Kriege und Flüchtlingsströme, Diktaturen und Korruption, Hunger und Krankheiten, Armut und Bildungsmisere sind einerseits zwar afrikanische Realitäten – und europäische zudem, wie sich nicht zuletzt an den Tausenden Migrant/innen zeigt, die seit Jahren bei der Überfahrt des Mittelmeers und an den nach Nordafrika ausgelagerten Außengrenzen der „Festung Europa“ sterben. Zugleich aber sind sie Stereotypen des inzwischen sprichwörtlichen „Afrikapessimismus“, der angemessen komplexe Auseinandersetzungen mit der Vielfalt afrikanischer Lebenswelten in einer breiteren Öffentlichkeit verhindert.
Diese schematische Verkleinerung unserer Afrikabilder verstärkt letztlich alte, koloniale Wahrnehmungsmuster vom bedrohlichen „dunklen Kontinent“, der in seiner vermeintlichen Quasi-Körperlichkeit gerade keine Geschichte zu haben scheint. Daneben zeigen optimistischere, jedoch teils ebenso stereotype Bilder Afrikas den Kontinent als „Wiege der Menschheit“, als Schatzkammer „kultureller Diversität“, als Entfaltungsraum selbstbewusster, innovationsfreudiger und „modernisierungsbereiter“ Mittelschichten oder als Laboratorium neuer Formen zivilgesellschaftlichen Engagements. Zugleich reichen auch „pragmatische“ Diskurse über Afrika als ökonomische Ressource oder strategischen Partner Europas in verschiedenen Aktualisierungen von der kolonialen Zeit bis in die Gegenwart. Kurzum: Seit Joseph Conrads literarischer Reise ins vermeintliche „Herz der Finsternis“ sind viele Afrika-Bilder dazugekommen, hat sich das Spektrum der Repräsentationen stark verbreitert. Noch immer aber sind, verlässt man die Kreise spezialisierter Kenner/innen, viele Afrika-Bilder der Gegenwart zu einseitig.
Der Themenschwerpunkt Afrika auf Zeitgeschichte-online soll demgegenüber den Blick des zeithistorisch interessierten Publikums für die jüngere Geschichte und für die Gegenwart Afrikas schärfen. Dass Afrika eine Vielzahl spannungsreicher und spannender Geschichten hat, ist selbstverständlich, kommt in gegenwärtigen Diskussionen aber immer noch oft zu kurz. Manche dieser Geschichten sollen hier von einschlägig interessierten und kompetenten Autorinnen und Autoren erzählt werden, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Dabei hoffen wir, einige vielversprechende Fäden aufzugreifen und zu zeigen, wie Forscherinnen und Forscher historischer, aber auch anderer Disziplinen heute, nach einem halben Jahrhundert, über die Dekolonisierung Afrikas nachdenken. Welche Bedeutung hat dieser Prozess, der eine der wichtigsten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts darstellt, eigentlich noch für die afrikanische Gegenwart im 21. Jahrhundert? Inwiefern trägt diese Gegenwart die Spuren vorkolonialer, kolonialer und nachkolonialer Geschichte? Können diese sich überlappenden Zeitlichkeiten im Begriff des Postkolonialen zusammengedacht werden? Das sind nur einige von vielen Fragen, in deren Kontext die auf Zeitgeschichte-online veröffentlichten Texte gelesen werden können. Dabei geht der Themenschwerpunkt in der Wahl der Themen, Methoden und Fragestellungen durchaus eklektisch vor. Alles andere wäre – das zeigt schon ein Blick auf die schiere Diversität der 53 unter dem Sammelbegriff „Afrika“ zusammengefassten Länder – intellektuell und politisch anmaßend.
Eröffnet wird der Themenschwerpunkt auf Zeitgeschichte-online mit einem grundlegenden Beitrag von Frank Schubert, der den Blick von der Gegenwart in die Vergangenheit richtet und die zentralen Merkmale kolonialer Herrschaft und Staatlichkeit in Erinnerung ruft. Der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit verschiedenen Formen von Gewalt nur je unvollständig realisierte Herrschaftsanspruch der Europäer adressierte die Afrikaner/innen nicht als „Staatsbürger“ einer „Nation“, sondern als „Untertanen“, die in ethnisierte Gruppen eingeteilt und oft indirekt, mit Hilfe indigener Autoritäten, kontrolliert wurden. „Tradition“ war ein zentraler Begriff dieser Herrschaft, die nicht zuletzt auf der Produktion ethnologischen Wissens über „Stämme“ beruhte. Als eine „erfundene Tradition“, an deren Aufbau sich europäische und afrikanische Akteure beteiligten, wurden „chiefs“ und „tribes“ dabei zu wichtigen Institutionen und Identitäten der kolonialen Gesellschaften Afrikas aus- oder zuallererst aufgebaut. Damit bildete sich eine „politische Ethnizität“ heraus, die Nationsbildungsprozesse in der Unabhängigkeitsära und vor allem in der postkolonialen Geschichte vieler afrikanischer Länder als „koloniale Erblast“ bis heute stark behindert hat.
Es folgen drei Beiträge, die medienhistorische Aspekte mit politik- und kulturgeschichtlichen Fragen und der Aufmerksamkeit für die transnationalen Dynamiken der afrikanischen Dekolonisierung verbinden. Wie zentral eine ethnologisch arbeitende (Pop-)Musikgeschichte die afrikanische Unabhängigkeitsära und die mit ihr einhergehenden Vergemeinschaftungen, aber auch gesellschaftsgeschichtliche Entwicklungen bis zur Gegenwart zu beleuchten vermag, zeigt der breit angelegte Beitrag von Hauke Dorsch, der ganz verschiedene Musikstile und Regionen des Kontinents in den Blick nimmt. Theoretisch reflektiert – und durch ethnologische Mikroperspektiven sowie durch die Links auf zahlreiche Hörbeispiele auf youtube auch sehr anschaulich – verbindet Dorsch lokale Geschichten popkultureller Praktiken mit dem Nachdenken über die transnationale und transkontinentale Dynamik, der sie ihre Entstehung und Wirkung verdanken. Nicht zuletzt stellt Dorsch die methodisch wichtige Frage, wie angemessen eigentlich westliche Begriffe der Popgeschichte afrikanische Musiker/innen, ihre Musik, deren Aufführungssituationen und Publika zu beschreiben vermögen. Er dezentriert so ganz nebenbei auch die „allgemeine“, sprich: die immer noch vor allem an „westlichen“ oder europäischen Gesellschaften orientierte Zeitgeschichte der Populärkultur und bereichert sie um neue Perspektiven.
In seinem Beitrag über die Rolle der Medien in der Dekolonisierung Afrikas schildert Robert Heinze, wie der verbreiterte Zugang von Afrikaner/innen zu Massenmedien wie Radio, Zeitungen, Magazinen und Kino vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg die politische und kulturelle Dynamik der kolonisierten Gesellschaften veränderte. Nicht nur Konsumerwartungen und Lebensstile waren an mediale Repräsentationen gebunden und veränderten sich gemeinsam mit diesen. Auch im engeren Sinne der politischen Mobilisierung für oder gegen die koloniale Herrschaft wurden die Medien zu einer Waffe, mit der die Europäer, bald aber auch antikoloniale Befreiungsbewegungen die Mobilisierung der Bevölkerungen in den Kolonien zu erreichen suchten, wobei sie immer wieder mit dem eigensinnigen Medienkonsum der Rezipient/innen zu rechnen hatten. Nach den Unabhängigkeiten blieben Medien dann einerseits zentral für den Aufbau „nationaler Identität“ im Sinne der an Medien gebundenen „vorgestellten Gemeinschaften“ (Benedict Anderson). Wichtig waren sie aber auch für „partikulare Identitätspolitiken“, mit denen verschiedene Gruppierungen und Medienakteure „quer“ zur „Nation“ (oder den Ansprüchen der Regierenden) ihre Zeitungsartikel schrieben oder ihre Radioprogramme sendeten.
Die Medialität politischer Kommunikation thematisiert Jürgen Dinkel in seinem Beitrag auf der Ebene internationaler Konferenzen: Die Afro-Asiatische Konferenz im indonesischen Bandung (1955) war beispiellos, da sich hier zum ersten Mal die Repräsentanten ehemals kolonisierter Nationen trafen, um sich auf diplomatischem Parkett als neue Akteure der Internationalen Beziehungen zu positionieren, ihre Solidarität miteinander zu erklären, das Ende des Kolonialismus zu fordern sowie im Kontext des Kalten Krieges eine dritte Position zwischen den Blöcken zu formulieren. Wie Dinkels Beitrag zu den Blockfreien-Konferenzen nach Bandung zeigt, waren diese nicht zuletzt „Zeiträume verdichteter Kommunikation“, in denen die „neuen Staaten“ mit aufwändigen Maßnahmen die medialen Möglichkeiten politischen agenda settings für sich zu nutzen versuchten. Im Anschluss an das „Afrika-Jahr“ 1960 bekannten sich fast alle afrikanischen Staaten sowie die Organisation für Afrikanische Einheit zu einer „blockfreien“ Politik. Auch die Behandlung afrikanischer Themen oder die Wahl afrikanischer Tagungsorte (1964 in Kairo, Ägypten; 1970 in Lusaka, Sambia; 1973 in Algier, Algerien) belegt die Bedeutung Afrikas innerhalb und für die Blockfreien-Bewegung.
Das Feld der Internationalen Beziehungen bearbeiten auch Daniel Maul und Martin Rempe in ihrem Beitrag zu Afrika in der UNO und der EWG in den 1960er-Jahren. Dabei lenken die Autoren den Blick auf die „Dialektik der Dekolonisierung“: Die Integration Afrikas in beide Organisationen stellte einerseits einen – für die neuen afrikanischen Herrschaftseliten auch innenpolitisch verwertbaren – Souveränitätsgewinn sowie ein Forum für die koordinierte Artikulation eigener Anliegen dar. Andererseits aber resultierten aus erhöhter Integration auch neue Zwänge einer „polyzentrischen Machtkonstellation“, während zugleich alte politische und ökonomische Abhängigkeiten teils nur wenig modifiziert fortbestanden, nun aber in den Gremien der UNO selbst von den „jungen Nationen“ kritisiert werden konnten. Neue Akteure und Themen veränderten also auch die Internationalen Organisationen: Debatten um „Entwicklung“, die „Neue Weltwirtschaftsordnung“, die Unterstützung antikolonialer Befreiungsbewegungen und den Kampf gegen das südafrikanische Apartheidregime zeigen, dass der durch die Dekolonisierung bewirkte „Wandel durch Integration“ beide Seiten betraf – die afrikanischen Nationalstaaten und die Internationalen Organisationen, in die sie eingebunden wurden.
Einen zentralen Moment der Neuordnung der internationalen Beziehungen im Umfeld des Afrika-Jahres beschreibt anschließend Katrin Zippel in ihrem Beitrag zu den Vereinten Nationen und ihrer Mission ONUC (1960-64) in der sogenannten Kongokrise. Der UN-Militäreinsatz im Kongo war Teil einer komplexen Konstellation: Akteure aller Konfliktparteien operierten am Schnittpunkt internationaler Entwicklungen wie dem Kalten Krieg und der Dekolonisierung auf der einen Seite, einem kongolesisch-lokalen sowie afrikanisch-regionalen Streit über wirtschaftliche Ressourcen, Macht und politische Legitimität auf der anderen Seite. In dieser schwierigen Gemengelage hatten die Vereinten Nationen eine Doppelfunktion, wie Zippel herausarbeitet: In New York boten ihre Gremien einerseits ein internationales Forum zur Diskussion der kongolesischen Entwicklung. Mit ihren multinationalen Truppen, die auf die logistischen und politischen Herausforderungen ihres Einsatzes nur unzureichend vorbereitet waren, traten die UN andererseits auch vor Ort als zunehmend „robust“ engagierter, also militärische Gewalt ausübender Akteur in Erscheinung, der massiv in die inneren Angelegenheiten eines Mitgliedsstaats eingriff. Die Vereinten Nationen waren somit eine Bühne des internationalisierten Konflikts, handelten aber auch selbst. Sie setzten so das von Generalsekretär Dag Hammarskjöld entwickelte neue Selbstverständnis der UN als supranationaler Organisation, die nötigenfalls auch gegen die Interessen mächtiger Nationen global agierte, einem experimentellen Praxistest aus, dessen Verlauf schwierig und dessen Ergebnis und Erbe ambivalent waren.
Einen Sprung in die Zeit um die Jahrtausendwende macht der Beitrag von Anne Fleckstein. Sie nimmt die südafrikanische Truth and Reconciliation Commission (TRC) in den Blick, die sich nach dem Ende der Apartheid von 1996 bis 2002 deren „Aufarbeitung“ durch die Findung der historischen „Wahrheit“ zum Ziel gesetzt hatte und für das Feld der sogenannten transitional justice bald auch in anderen Ländern vorbildhaft wurde. Fleckstein skizziert den Verlauf und manche Widersprüche dieser gedächtnispolitischen Intervention und nutzt diese Beobachtungen für eine generalisierende diskurstheoretische Reflexion auf „Archive“ und die Logik ihrer Sammlungs-, Aufbewahrungs- und Zugangspraxis. Das von der TRC geschaffene Archiv im Besonderen deutet sie dabei als Materialisierung eines „prospektiven Sprechens“, das mit dem Gestus des „So wird es gewesen sein“ letztlich weniger auf die Vergangenheit referiert als auf die gedachte Zukunft „nationaler Versöhnung“. In diesem Sinne beleuchtet es vor allem die Gegenwart seiner Entstehungszeit, in der das Sammeln von Dokumenten und Zeugenaussagen vielleicht weniger dem „Erinnern“ als dem „Vergessen“ dienen sollte, das zur Integration der Post-Apartheid-Gesellschaft unabdingbar schien.
Mit der Systematik des Wissens befasst sich auch der Beitrag von Thomas Reinhardt (zuerst 2009), den wir – mit Dank an den Autor und die Zeitschrift „Stichproben“[3] – als digitalen Reprint anbieten können. „Kann es Wissenschaft geben, die auf anderen epistemologischen Voraussetzungen aufbaut als jene, die heute an den Hochschulen der westlichen Welt praktiziert wird?“ Diese Frage, die Reinhardt in seinem Beitrag zum sogenannten Afrozentrismus stellt, ist im Kontext der vorliegenden Publikation besonders spannend – schließlich sind alle Autor/innen des vorliegenden Themenschwerpunkts an westlichen Universitäten sozialisiert. Sie berührt zugleich den Kern der Dekolonisierung als einem intellektuellen Ereignis: Die Infragestellung und Delegitimierung eurozentrischer Weltsichten, die zentral auch von afrikanischen Denker/innen vorangetrieben wurde (und wird), ist die vielleicht wichtigste kulturelle Folge des End of Empire. So notwendig jedoch die Kritik der strukturellen Selbstbezüglichkeit westlicher (Geschichts-)Wissenschaft ist und sicher lange noch bleiben wird, so wenig bietet der seit den späten 1970er-Jahren in den USA entstandene Afrozentrismus eine überzeugende wissenschaftliche Alternative, wie Reinhardt in seiner differenzierten Analyse argumentiert.
Dass die durch die Dekolonisierung beförderte Krise alter Selbstgewissheiten nicht nur die westlichen Wissenschaften, sondern auch das europäische Autorenkino betrifft, zeigt der Beitrag von Nikolaus Perneczky über die „Krise des eurozentrischen Laufbilds“ um 1968. Perneczkys ebenso detailgenaue wie breit kontextualisierte Analyse des von Pier Paolo Pasolini gestalteten Filmessays Appunti per un’Orestiade africana (Italien 1970) macht nachvollziehbar, wie Pasolinis ästhetische und politische Praxis in ihrem Bemühen um ein hierarchiefreies, dialogisches Verhältnis zu den Bildern der afrikanischen Anderen scheitert. Gerade in der Zirkelhaftigkeit ihrer Projektionen auf „Afrika“ erweist sich die wachsende Brüchigkeit der europäischen Wissensmuster in den „langen 1960er-Jahren“: Pasolinis Versuch einer Relokalisierung des mythologischen Stoffs von Aischylos‘ „Orestie“ in Afrika kann so als filmhistorisches Dokument dafür gelesen werden, dass linke Intellektuelle Europas im Kontext der Dekolonisierung die Deutungshoheit über die Begriffe des Politischen und der Revolution verloren hatten.
Verunsicherung herrschte auch bei den westdeutschen Funktionseliten, wie Torben Gülstorff zeigt, der sich am Beispiel der ersten bundesrepublikanischen Afrikabotschafterkonferenz im Oktober 1959 im äthiopischen Addis Abeba mit den Strategiediskussionen und Politikentwürfen westdeutscher Diplomaten im Umfeld des „Afrika-Jahrs“ befasst. Gülstorff legt dar, dass diese Diskussionen nicht nur synchron im Kontext der durch den Kalten Krieg, die bundesdeutsche Westbindung und die europäische Einigung definierten Außenbeziehungen und Interessen des jungen Staates gelesen werden müssen. Zahlreiche Spuren rassistischer Einstellungen in den Äußerungen der diplomatischen Elite zeigen vielmehr, dass die Afrikapolitik der jungen Bundesrepublik diachron auch vor dem doppelten Hintergrund deutscher Kolonialherrschaft in Afrika vor 1918 sowie der Geschichte des Nationalsozialismus gedeutet werden kann, die keine 15 Jahre vor der Botschafterkonferenz in Addis Abeba von den Alliierten beendet worden war.
Einen Beitrag zur Debatte über afrikanische „Entwicklung“ aus der Perspektive der Soziolinguistik bietet Ekkehard Wolff, dem wir dafür danken, dass er uns ermöglicht hat, seinen zuerst 2007 im Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte erschienenen Beitrag als digitalen Reprint anzubieten. Wolff plädiert für die Akzeptanz, Erhaltung und Förderung der Mehrsprachigkeit, die den Alltag praktisch aller Afrikaner/innen prägt: In den 53 Ländern des Kontinents werden mehr als 2.000 Sprachen gesprochen (also ein Drittel der weltweit ca. 6.000 Sprachen). Dieser ausgeprägte Multilingualismus ist, so argumentiert Wolff, keineswegs ein „Problem“, das der Lösung durch eine scheinbar neutrale „nationale“ Einheitssprache wie Englisch, Französisch oder Portugiesisch bedarf. Mehrsprachigkeit ist vielmehr eine soziale Realität, die anerkannt und begrüßt werden sollte, um auf ihrer Grundlage ein effizienteres Bildungssystem und damit auch die soziale und politische Teilhabe einer Mehrheit der Bevölkerung in den afrikanischen Gesellschaften zu ermöglichen. Ein angemessener Umgang mit der „Sprachenfrage“ als dem täglichen Nebeneinander mehrerer Sprachgemeinschaften, so Wolff, ist in diesem Sinne zentral, um der afrikanischen „Bildungskatastrophe“ entgegenzuwirken und „Entwicklung“ überhaupt zu ermöglichen. Das auf den Sprachen der Ex-Kolonialmächte beruhende monolinguale Bildungswesen dagegen führt, so Wolff, eine jahrzehntealte Geschichte der Marginalisierung afrikanischer Kultur und Erfahrungen fort.
Ein Paket von drei Beiträgen befasst sich schließlich mit der ethnologischen und historisch informierten Vor-Ort-Beobachtung der 2010 stattfindenden Unabhängigkeitsfeiern in Madagaskar, Burkina Faso und Kamerun. Drei Forscherinnen des Instituts für Afrikanistik der Universität Mainz nutzen diese Berichte zu einer Bilanzierung der jeweiligen Landesgeschichten seit den Unabhängigkeiten, vor allem aber zu einem Blick auf gesellschafts- und gedächtnispolitische Konstellationen der Gegenwart.
Mareike Späth schildert die festliche Stimmung bei den madagassischen Unabhängigkeitsfeiern am 26. Juni 2010 in Antananarivo, aber auch verschiedentlich geäußerte Zweifel am Sinn staatlich finanzierter Vergnügungen, während Madagaskar von ökonomischen Belastungen und – nach dem 2009 erfolgten Putsch des derzeitigen Präsidenten Andry Rajoelina – von politischen Konflikten geprägt ist. Wie Späth in ihrer Analyse der vom Kulturministerium gestalteten und am 17. August 2010 eröffneten Ausstellung zur Geschichte Madagaskars zeigt, soll der Blick von einer als krisenhaft empfundenen Gegenwart in die Vergangenheit die nationale Einheit für die Zukunft stärken. Späth untersucht und kontextualisiert solche retrospektiven Konstruktionen einer „nationalen Geschichte“ und einer „nationalen Kultur“ im Umfeld des Jubiläums, fragt nach der relativen Pluralität oder Uniformität historischer Erzählungen sowie nach den markanten Referenzpunkten madagassischer Geschichtspolitik und einer inkludierenden „nationalen“ Selbstbeschreibung. Sie betont aber auch, dass – unabhängig von der offenen Frage nach der Rezeption solcher Gedächtnispolitik – die staatlicherseits zwar ermunterte, jedoch nicht kontrollierte soziale Praxis des Unabhängigkeits-Feierns selbst die Vergemeinschaftung als Nation befördern und so eventuell Wege aus der gegenwärtigen Krise eröffnen kann.
Das umfangreiche Festprogramm zum Jubiläum der Unabhängigkeit in Burkina Faso bis zum Nationalfeiertag am 11. Dezember 2010 beschreibt Svenja Haberecht. Ihre Schilderung des Cinquantenaire erlaubt tiefe Einblicke in die (Selbst-)Inszenierung Blaise Compaorés, des seit seinem Staatsstreich 1987 amtierenden und im November 2010 wiedergewählten Präsidenten. Compaorés stark selektive und konsensorientierte Gedächtnispolitik, die konfliktträchtige Episoden der Vergangenheit in den Hintergrund rückt, konzentriert sich auf die Erinnerung an die Kolonisierung, den Unabhängigkeitskampf und des anschließenden nation building. Dieses Bild der geschlossen antikolonialen und geeinten postkolonialen Nation – in dem Compaorés Rolle bei der Ermordung seines Amtsvorgängers Thomas Sankara, der von vielen Burkinabè bis heute verehrt wird, keinen Platz haben kann –, wird begleitet von einem staatlichen Modernisierungs- und Fortschrittsdiskurs, der aus der Ära der afrikanischen Unabhängigkeiten weitgehend ungebrochen bis in die Gegenwart und in die projektierte Zukunft Burkina Fasos zu reichen scheint. Doch Haberecht zeigt auch, dass zahlreiche Burkinabè dem Bild Compaorés als volksnahem und zupackendem Erbauer der aufstrebenden Nation widersprachen. Akteure der Opposition, der Zivilgesellschaft und der Medien Burkina Fasos erzählten im Jubiläumsjahr ihre eigenen Versionen der Geschichte, gedachten „vergessener“ Helden und mahnten historische Fehler oder aktuelle Versäumnisse an.
Wie Kathrin Tiewa in ihrem Beitrag zum goldenen Jubiläum in Kamerun darlegt, hat das 1919 vom Völkerbund geteilte und an die englische bzw. französische Mandatsmacht übergebene Land eigentlich zwei Unabhängigkeitsdaten: Während Paris „seinem“ Landesteil bereits im Afrikajahr die staatsrechtliche Eigenständigkeit zubilligte, blieb der britische Teil noch bis zum 1. Oktober 1961 Mandatsgebiet. Zwar wurden beide am 20. Mai 1972 „wiedervereinigt“ – und der 38. Jahrestag dieses Datums im Jahr 2010 ist es auch, den die Regierung zum nationalen Feiertag der 50-jährigen Unabhängigkeit bestimmt hat. Diese geschichtspolitisch so komplexe wie umstrittene Kompromisslösung zeigt jedoch bereits an, dass Kamerun und seine Bevölkerung auch nach 1972 und bis heute in vieler Hinsicht – zum Beispiel regional, sprachpolitisch und ethnisch – gespalten blieben, wie Tiewa in ihrer kritischen Lektüre regierungsoffizieller Slogans zur 50-jährigen Unabhängigkeitsfeier argumentiert. Umso aufschlussreicher ist es daher, dass neben Themen wie „Fortschritt“ oder „Stabilität“ gerade das Konzept nationaler „Einheit“ im Zentrum der Feiern steht, die der amtierende Präsident Paul Biya zur Inszenierung der Regierungsarbeit und seiner Person nutzt.
Mit der performativen und diskursiven Konstruktion der Nation – in diesem Fall der ghanaischen Nation – im Umfeld des Unabhängigkeitsjubiläums befasst sich auch ein Beitrag von Carola Lentz und Jan Budniok, den die Autor/innen uns freundlicherweise zum Wiederabdruck überlassen haben. Als erstes afrikanisches Land südlich der Sahara wurde Ghana 1957 staatsrechtlich eigenständig. Entsprechend richtete die Regierung bereits 2007 unter dem Motto „Ghana@50“ ein großes Festprogramm zum „Golden Jubilee“ aus, das Lentz und Budniok am 5. und 6. März 2007 als teilnehmende Beobachter/innen auf den Spuren lokaler Informant/innen ethnografisch begleitet und (nicht zuletzt fotografisch) dokumentiert haben. Dabei zeigte sich immer wieder, dass der Anspruch der Regierung, die von ihr proklamierte nationale „Unity in Diversity“ angemessen zu repräsentieren, von verschiedener Seite bestritten wurde: Oppositionsparteien wie der National Democratic Congress (NDC), Vertreter der politisch unterrepräsentierten nördlichen Landesteile, aber auch zivilgesellschaftliche Aktivist/innen diverser grass roots-Bewegungen stellten die Verwirklichung dieses Anspruchs in Frage. Im Grundsatz jedoch teilten auch sie das von der Regierung ausgegebene, im geschichtspolitischen Rückgriff auf die Geschichte der Unabhängigkeit untermauerte Postulat nationaler Einheit in regional-ethnischer Vielfalt.
Damit Sie als Leserinnen und Leser sich auch jenseits der hier publizierten Texte umfassend informieren können, haben wir die Beiträge für diesen Themenschwerpunkt um eine Materialumgebung ergänzt, die mit Bibliografien, Rezensionen, Veranstaltungshinweisen und der Sammlung nützlicher Links zahlreiche Hinweise zur vertiefenden Beschäftigung mit den verschiedensten Dimensionen afrikanischer Zeitgeschichte gibt. Für ihre substanzielle Arbeit an dieser Materialsammlung und insgesamt am Entstehen dieses Themenschwerpunkts danken die Herausgeberin und der Herausgeber herzlich ihren temporären Mitarbeiter/innen Andrea Moritz und Michael Dunker.
Die Redaktion von Zeitgeschichte-online betrachtet den vorliegenden Themenschwerpunkt im Übrigen als ein Experiment, das zugleich eine „Wiederholungstat“ ist – im letzten Jahr hatte Zeitgeschichte-online bereits einen Schwerpunkt zu „Zeithistorischen Debatten in Asien“ vorgelegt. Mit den hier versammelten Beiträgen zum „Afrika-Jahr“ vor einem halben Jahrhundert soll nun zum zweiten Mal ein neugieriger Ausflug jenseits der konventionellen Grenzen „deutscher Zeitgeschichte“ unternommen werden, die in den letzten Jahren – zu unser aller Vorteil – ohnehin immer durchlässiger für neue Gegenstände und Untersuchungsräume sowie für Anregungen aus anderen disziplinären oder methodisch-theoretischen Kontexten geworden sind. Wir hoffen jedenfalls, Ihnen mit den vorliegenden Beiträgen eine Kreuzung der Perspektiven zu bieten, in der sich sehr verschiedene Blickachsen zu einer anregenden Momentaufnahme kombinieren, der zugleich die historische Tiefe nicht fehlt. Viel Spaß beim Lesen!
[1] Nach der zeitlichen Reihenfolge der Unabhängigkeitsdaten der neuen Staaten: Cameroun, Togo, Madagascar, République Démocratique du Congo, Somalie Bénin, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Tchad, République centrafricaine, République du Congo, Gabon, Sénégal, Mali, Nigeria und Mauritanie.
[2] Vgl. den Text der Rede auf http://www.ouestaf.com/Patrice-Lumumba-sur-l-independance-du-Congo-ex-Zaire--six-mois-avant-son-assassinat-Texte-integral_a2260.html (Zugriff: 18.06.2010). (letzte Überprüfung am 07.08.2013)
[3] http://www.univie.ac.at/ecco/stichproben/. (letzte Überprüfung am 07.08.2013)
Zitation
Christoph Kalter, Aufbruch und Umbruch. "Das Afrika-Jahr" vor einem halben Jahrhundert , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/aufbruch-und-umbruch