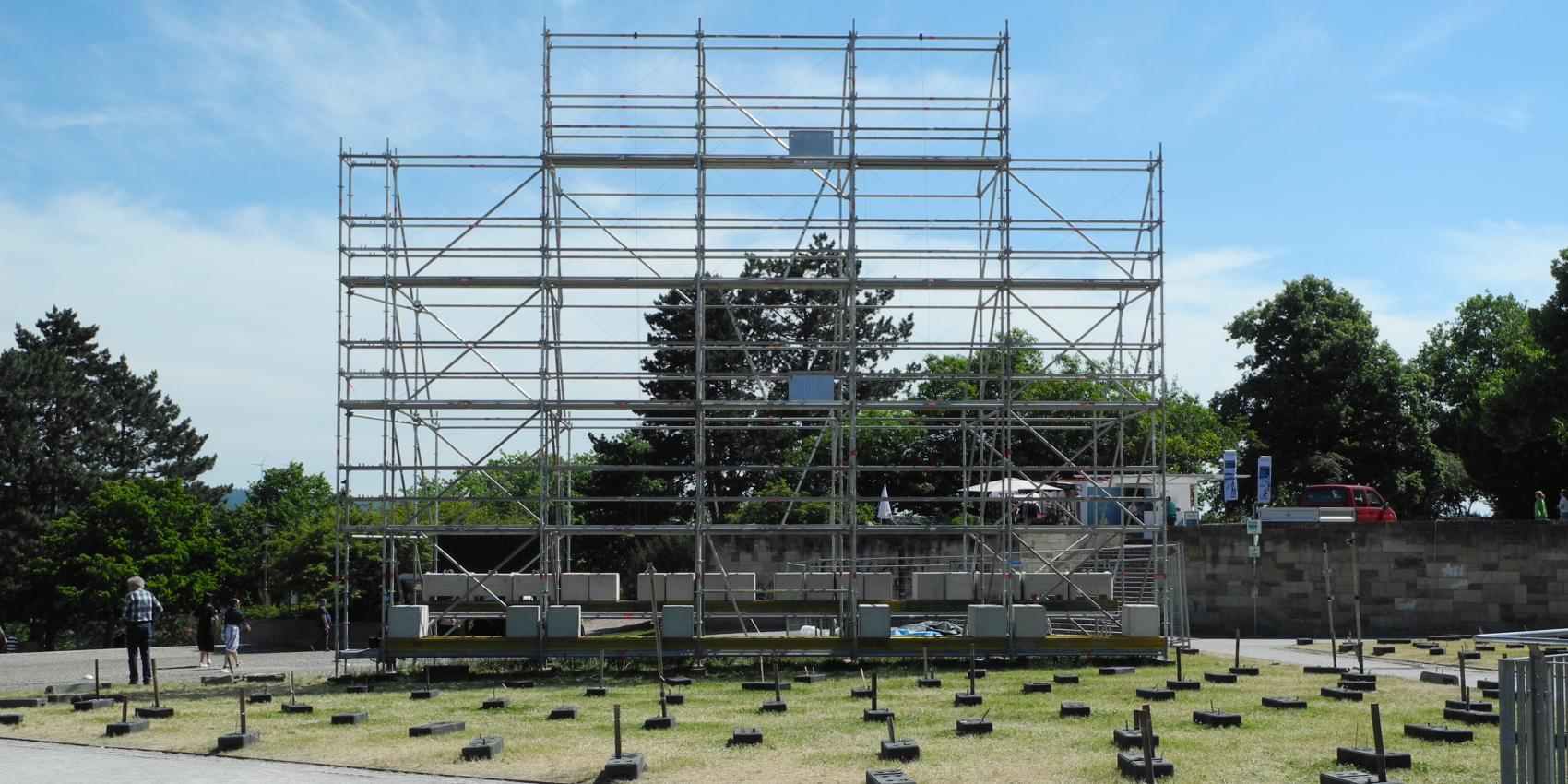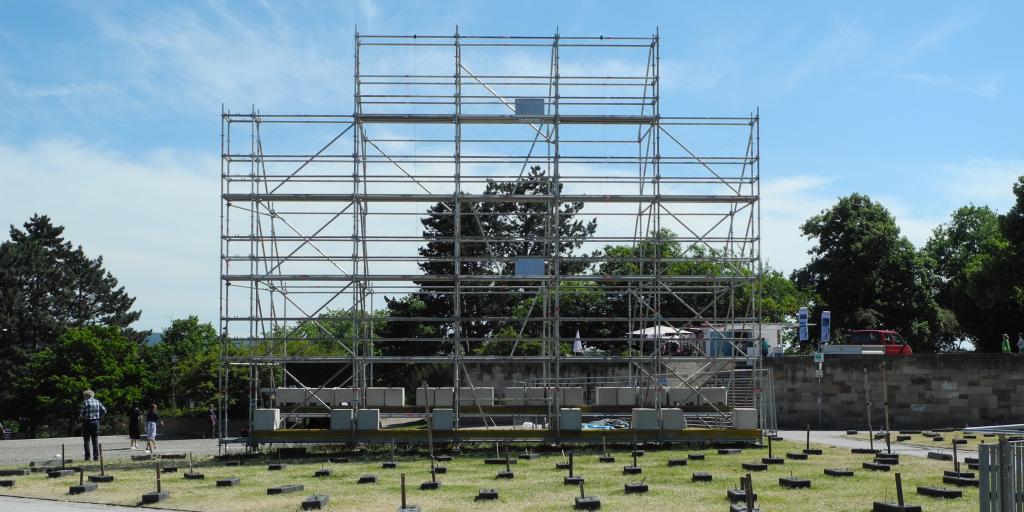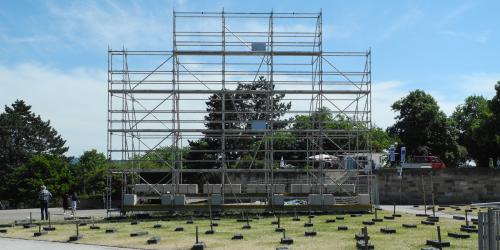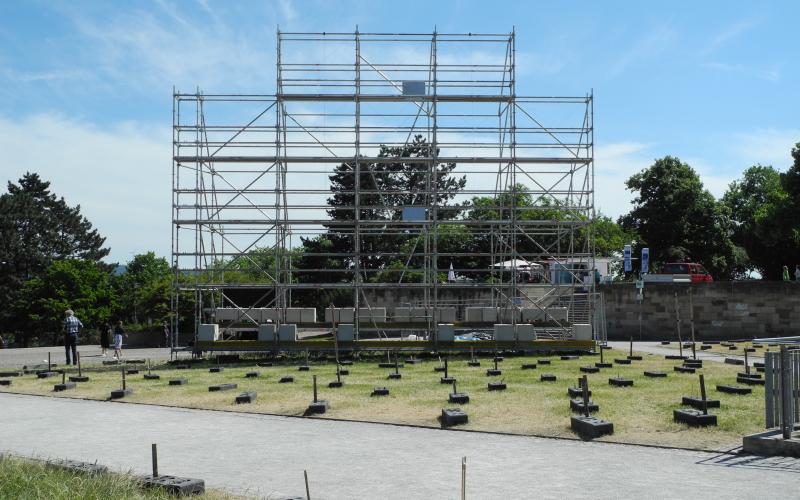In den Sozialwissenschaften werden „natürliche Experimente“ verwendet, wenn gesellschaftliche Vorgänge zu komplex und zu langwierig sind, als dass man sie unter naturwissenschaftlichen Laborbedingungen replizieren könnte. Man sucht also nach Brüchen in der historischen Entwicklung, wie etwa in der deutschen Geschichte durch den Fall der Mauer. Aber auch kleinere Konfliktereignisse haben Auswirkungen. Durch sie werden soziale Zusammenhänge, die im alltäglichen Lauf der Kommunikation ungesagt bleiben, nicht nur zur Sprache, sondern sogar in Schriftform gebracht. Der documenta-fifteen-Skandal hat eine Flut solcher schriftlichen Äußerungen generiert. Deshalb eignet er sich als „natürliches Experiment“.
Jedes Experiment braucht eine Theorie, mit der das gewonnene Material sinnvoll interpretiert werden kann. Ich verwende dazu – mit einigen Erweiterungen – die soziologische Systemtheorie. In diesem Beobachtungsraster ist Gesellschaft ein ständiger Strom von Kommunikationsereignissen oder Mitteilungen. In dem Strom ereignen sich Verknüpfungen von Mitteilungen, in denen eine je eigene Logik und eine autonome Vorstellung von Wert Gültigkeit haben. Die so gebildeten Sinnwelten nannte Luhmann „Funktionssysteme“, ich schlage dafür den Begriff der „ernsten Gesellschaftsspiele“ vor.[1] Es ist hilfreich, zwischen „lustigen“ und „ernsten“ Spielen zu unterscheiden. Lustige Spiele haben einen Anfang und ein Ende, und die werden, ebenso wie die Einsätze, von den Mitspielern bestimmt. Die Unsicherheit über das Ergebnis einer Spielrunde dient der Unterhaltung, das Spiel fesselt die Mitspielenden, beim Publikumssport sogar Millionen von Beobachtern.
Ernste Spiele haben keinen Anfang und kein Ende, man wird in sie hineingeboren, und sie werden in eine den Spielenden unbekannte Zukunft hinein weitergespielt. In diesen großen, Jahrhunderte überspannenden Gesellschaftsspielen treten Spieler:innen auf, die mit unterschiedlichem, oft über Generationen akkumuliertem Wertkapital ausgestattet sind, die ihr eigenes Interesse am Spielvorteil durch Allianzen mit Verbündeten fördern und die sich durch Kontroversen – mit unsicherem Ausgang – gegen Widersacher durchsetzen. Die ernsten Spiele sind also Gesellschaftskampfspiele, in denen ständig um Siege gerungen und über Regelverletzungen gestritten wird.
Ernste Spiele simulieren im Einsatz ihrer spezialisierten Medien die jeweilige Problemlage: durch Machtproben in der Politik, durch Geldzahlungen in der Wirtschaft, durch Urteilsverfahren im Recht, durch Prüfungen in der Wissenschaft, aber auch durch die fiktiven Medien der Kunst- und die transzendenten Medien der Religionsspiele. All diese Gesellschaftsspiele, in denen um ganz unterschiedliche Einsätze gespielt wird, geraten mit ihren Spielzügen auch aneinander und ineinander. Wenn Spieler:innen nicht nur auf fremde, irritierende Spielzüge in der eigenen Gesellschaft reagieren, sondern auch auf solche aus Welten mit fremden Spieleerfahrungen, dann potenzieren sich die Möglichkeiten der Irritation. Eine solche Konstellation hatte sich im Sommer 2022 in Kassel aufgebaut, explodierte in der letzten Juniwoche und hinterließ Resonanzen nicht nur im Kunstspiel, sondern auch in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Die Explosion war nicht unerwartet. Seit dem späten 20. Jahrhundert verwenden Kunstschaffende für ihre Werke immer häufiger Material, das seine Bedeutungen über kunstfremden „Gehalt“ erreicht.[2] Die Werkformen werden entgrenzt, Installationen, multimediale Arbeiten und Performances dominieren. Damit die Betrachtenden den ausgewählten Gehalt erkennen können, müssen die Werke auf das ernste Spiel verweisen, in das durch den künstlerischen Spielzug interveniert wird. Werke, die ihren Gehalt aus politischen Spielen beziehen, nehmen meistens Bezug auf die Verfehlungen und Ungerechtigkeiten, selten auf die Wohltaten der Mächtigen. Ob die Techniken der Bildkünste, vom Holzschnitt bis zum Videoclip, eingesetzt werden, um politische Aktivist:innen mit Propagandamaterial zu versorgen, oder ob die ausgewählten politischen Konfliktlinien den Gehalt für eine ästhetische Wirklichkeitskonstruktion liefern, ist der Interpretation der Betrachtenden überlassen. Je expliziter die kritisierten Spieler:innen und ihre Praktiken benannt werden, desto heftiger setzen sich die Angegriffenen zur Wehr, und sie tun das mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.
Argumentationstaktiken im Deutungskampf
Als sich die im globalen Kunstspiel renommierten Mitglieder der Findungskommission für die documenta15 darauf verständigten, die Gestaltung Kurator:innen und Künstler:innen zu überlassen, die die politische Dimension des Zusammenlebens als „Gehalt“ ihrer Arbeiten betrachten, folgten sie der Strömung der politisch aktivistischen Kunst. In einer zweiten Brechung sollten kollektiv organisierte Künstler:innen aus einem außereuropäischen Kunstspiel für Irritationen im hegemonialen westlichen Kunstspiel sorgen. Die Wahl fiel auf ruang-rupa, ein Kunstkollektiv aus Jakarta. Deren gestalterischer Zugriff sollte die Grenze überschreiten zwischen der Welt der Kunst im indonesischen Archipel und der Kunstwelt des globalen Nordwestens. Die „documenta“, ein Ausstellungsformat, das alle fünf Jahre in Kassel inszeniert wird, sollte in Gestalt der so benannten „documenta fifteen“ wegweisende neue Entwicklungen im globalen Kunstspiel vorstellen. Missverständnisse, Versäumnisse und vor allem Streit über den künstlerischen Wert des Ausstellungskonzepts und der ausgestellten Werke sind Teil einer jeden documenta-Edition gewesen. Keine Auseinandersetzung war in ihrer Heftigkeit und in ihrer Beachtung durch die deutschsprachige Öffentlichkeit vergleichbar mit dem documenta-fifteen-Skandal. Das lag daran, dass Bilder der Ausstellung zu Werkzeugen an einer Konfliktlinie im deutschen Politikspiel wurden, entlang der darüber gestritten wird, an welchem Punkt Kritik an israelischer Politik umschlägt in israelbezogenen oder in alle Juden herabwürdigenden Antisemitismus.
An der Berichterstattung über die zwei anstößigen Figuren auf dem Banner People’s Justice lässt sich genauer verfolgen, mit welchen Taktiken die jeweiligen Positionen verteidigt wurden. Dabei werde ich, die Wirklichkeit vereinfachend, von zwei sich gegenüberstehenden Lagern ausgehen. Die Partei, deren Anhänger:innen beim Anblick des Banners rot sahen, erhoben den Vorwurf einer absichtlichen antisemitischen Botschaft des Banners. Die Partei, deren Anhänger:innen zumindest Blauäugigkeit zugeschrieben wurde, bestritt diese Intention und bot alternative Deutungen für Bildelemente, die in Deutschland als antisemitisch gelesen werden.
Erst zu den roten Taktiken: Beide Figuren im Banner sind jeweils Teile einer Gruppe. Der Mossad-Mann ist einer von neun Geheimdienstsoldaten, gekennzeichnet durch die Namen der Dienste; der SS-Mann ist einer von drei Vampirdämonen, javanisch codiert durch rote Augen, spitze Zähne und gespaltene Zunge. Die erste Taktik besteht darin, den Kontext der Gruppe zu ignorieren und sie als Einzelfiguren zu interpretieren. Zur sprachlichen Beschreibung einer gezeichneten Figur werden im nächsten Schritt affektiv aufgeladene, die Zeichnung vereinfachende Worte und Begriffe eingesetzt. So wurde häufig geschrieben, auf dem Banner seien „Juden als Schweine“ dargestellt. Das schafft die unmittelbare Verbindung zur europäischen Tradition der Herabwürdigung von Juden als unrein und minderwertig. Beleg dafür sind zwei kleine Kreise auf dem Helm des Mossad-Soldaten, die als Schweinerüssel, Schweinenase oder Schweineschnauze interpretiert wurden. Vergröbernd wurde von einem Schweinskopf, oder – eine besonders häufige Formulierung - einem Schweinsgesicht geschrieben, obwohl das menschliche Gesicht des Soldaten deutlich konturiert ist. Das hinderte einen FAZ-Herausgeber nicht, von einem „Schwein mit Mossadhelm“ zu sprechen.[3] Zudem wurde das Argument der israelbezogenen Übertreibung herangezogen. Der Einfluss des Mossad in Indonesien sei weitaus geringer gewesen als es die Gleichrangigkeit mit den anderen Geheimdiensten auf dem Banner suggeriere, „ausgerechnet“[4] Israels Politik werde in bewusst verzerrender Weise hervorgehoben.
Beim SS-Mann kombinierten die Beschreibungen eine Auswahl inkongruenter Merkmale. Hakennase, Schläfenlocken und Kippah konnotieren den orthodoxen Juden, Zigarre, Anzug „Haifischzähne“ und Vampiraugen den Finanzjuden, die SS-Runen schreiben Juden und/oder Israel die Täterrolle zu. Die Beschreibungen zählten diese Merkmale, oft mit emphatischen Adjektiven versehen, auf. Durch den Vergleich mit Stürmer-Karikaturen wurde der Verweis auf die antisemitische Intention gleich mitgeliefert. Die Herleitung einzelner Merkmale setzte meist auf Allgemeinwissen, konnte aber auch, wie im Abschlussbericht des wissenschaftlichen Fachgremiums geschehen, historisch weit ausgreifen.
In der Berichterstattung über diese Vorwürfe griffen weitere Taktiken. Durchweg wurden die Einzelfälle in der Mehrzahl wiedergegeben, sodass der Eindruck des seriellen und folglich absichtlichen Verstoßes entstand. Auch wenn nur jeweils ein strittiger Fall vorlag, lautete die Kernbotschaft: Taring Padi habe Juden als Schweine und als asoziale Blutsauger dargestellt. Das Verfahren ließ sich zum Antisemitismusvorwurf für die gesamte Ausstellung erweitern: Vier unterschiedlich gelagerte Fälle wurden zur Serie von „immer neuen antisemitischen Skandalwerken“.[5]
Eine weitere Taktik in der Debatte war die Abwertung des Meinungsgegners auf verschiedenen Wertebenen: (1) Das Objekt, also das Kunstwerk, wird abgewertet als schlechte Kunst, als Kitsch oder Agitprop-Instrument, dem man die bei Kunstwerken besonders geschätzte Vieldeutigkeit nicht zugestehen muss. (2) Das Verhalten der Produzent:innen wird als Schuldbeweis gewertet, gerade dann, wenn sie die Absicht der Beleidigung leugnen: Sie sind trotzig, verschlagen, bockig. Entschuldigungen und Erklärungen werden nicht ernst genommen. „Schulligum“ betitelte die Feuilletonchefin der Frankfurter Rundschau ihre Meinung zu Taring Padis Stellungnahme und verglich diese mit der genuschelten Entschuldigung auf dem Kinderspielplatz, bei der alle Beteiligten wissen, dass sie eine Farce ist.[6] (3) Die Abwertung kann auch das abstrakte Gedankengebäude betreffen, in dem die Produzierenden kommunizieren. Bei dieser Praktik gilt das anstößige Werk als Ausdruck einer postkolonialistisch genannten Weltsicht, in der die Palästinenserpolitik israelischer Regierungen in die Nähe von Kolonialismus und Apartheid gerückt wird.
Das blaue Lager hingegen, in dem für alternative Deutungen plädiert wurde, bestand zum einen aus dem Netzwerk von Künstler:innenkollektiven, die im Schneeballverfahren nach Kassel eingeladen worden waren. Sie verteidigten sich über Statements, die in einer umständlichen Kooperation mit Geschäftsführung, künstlerischem Team und Kurator:innen formuliert worden waren. Unterstützt wurden sie von zahlreichen lokalen Akteur:innen, mit denen sie Verbindungen aufgebaut hatten, und von kulturwissenschaftlichen Experten, die alternative Deutungen der zwei Figuren vertraten. Jüdische Autoren wie Joseph Croituru, Eyal Weizman und Omri Boehm kamen zu Wort. Mit Bezug auf den Mossad-Soldaten wurde die Rolle des israelischen Geheimdiensts bei der Machtergreifung Suhartos hervorgehoben, die behauptete Schweineschnauze wurde mit javanischer Bildsymbolik erklärt. Eine alternative Interpretation, wonach die zwei verdächtigen Kreise Atemlöcher in seinem Helm darstellen könnten, ähnlich wie beim dahinter laufenden ASIO-Soldaten, tauchte erst im September auf, als sich Wissenschaftler:innen, deren Fachgebiet der kulturelle Raum Südostasien ist, zu Wort meldeten.[7]
Auch beim SS-Mann war es blaue Taktik, plausible Erklärungsangebote zu machen, die den Vorwurf der antisemitischen Absicht entkräften sollten. Ade Darmawan, der als Repräsentant von ruang-rupa am 6. Juli vor den Kulturausschuss des Deutschen Bundestags zitiert worden war, erläuterte, dass in Indonesien antisemitische Schablonen verwendet werden, um chinesische Steuerpächter und Händler als Kapitalisten bildhaft zu machen. Die Autorin Marianne Dautrey interpretierte die ungewöhnliche Kombination verschiedener, in sich widersprüchlicher „jüdischer“ Merkmale als bewusst vieldeutige Sprache, die den eingeübten westlichen Blick dezentrieren soll.[8] Holocaustforscher Michael Rothberg erinnerte daran, „wie sehr die Geschichten von Rassismus, Kolonialismus, Antisemitismus und Völkermord miteinander verwoben sind“.[9] Derartige Beiträge, die Konzepte wie Mehrdeutigkeit, Ambiguitätstoleranz und multidirektionales Erinnern zugrunde legten, tauchten vermehrt auf, nachdem die documenta fifteen – erstaunlicherweise planmäßig – ihre Pforten geschlossen hatte.
Machtverschiebungen in der deutschen Kulturpolitik
Die Debatte um Antisemitismus auf der documenta fifteen fand und findet im Machtsektor der Kulturpolitik statt, und es geht um Deutungshoheit. Hoheitsrechte verleihen die Macht, über bestimmte Handlungs- oder Sprechweisen eines Territoriums staatliche Gewalt auszuüben, in Form von Verboten, Sanktionen und Geboten. Es ist ein Hoheitsrecht zu bestimmen, wann eine Handlungs- oder Sprechweise eine sanktionsbewehrte „rote Linie“ überschreitet. Klagen über skandalöse Verschiebungen der Grenze zugunsten der Gegner:innen richten sich sowohl an die eigenen Unterstützer:innen als auch an die Träger:innen staatlicher Gewalt. Auf die wird Druck aufgebaut, sie müssen Stellung beziehen, sich rechtfertigen, Konsequenzen ziehen, Kommissionen einsetzen und Förderrichtlinien ändern. So erging es dem Bundespräsidenten, der seine rote Linie verkündete, dem Bundeskanzler, der seinen Besuch absagte, und der Kulturstaatsministerin. Claudia Roth war 2019 wegen ihrer Stimmenthaltung bei der BDS-Resolution des Bundestags und 2020 wegen der Unterstützung ihres Staatssekretärs für die Initiative „GG 5.3 Weltoffenheit“ bereits in die Kritik geraten. Jetzt sah sie sich gezwungen, binnen weniger Tage mit einem Bündel von Maßnahmen die Abwehr von israelbezogenem Antisemitismus zu signalisieren. So erging es auch der hessischen Landesministerin, die sich den Antisemitismusvorwürfen anschloss, dem Oberbürgermeister, der zwischen Empörung und Verständnis für die Angegriffenen lavierte, und dem Aufsichtsrat der documenta gGmbH, der eilends ein Gutachten zur Organisationsreform in Auftrag gab.
Die Wirkungen der vom documenta-fifteen-Skandal ausgelösten Resonanzen unterscheiden sich in drei Dimensionen von gewöhnlichen politischen Machtverschiebungen zwischen verschiedenen Interessenverbänden und -koalitionen: Die anstößigen Botschaften beanspruchen erstens – als Teil von Kunstwerken – Autonomie, führen also zur Konkurrenz der autonomen Wertlogiken von Kunst- und Politikspiel. Das ist der Grund, warum die Akteur:innen im politischen Raum die künstlerischen Botschaften politisch lesen und die künstlerische Form für Tarnung halten. Die Botschaften werden zweitens vorgebracht von Kunstkollektiven, also einer Gemeinschaftsform mit vorkolonialen Praktiken der Ausbildung, der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens, die in gewisser Konkurrenz zu individualistisch verfassten Gemeinschaften steht. Basiskommunale Gemeinschaftsformen ermöglichen neue Arten des kooperativen Handelns, aber der Verzicht auf hierarchische Verantwortung führt auch zu der „wohlmeinenden Indifferenz“, mit der vom kuratorischen Team das Risiko der Verletzung von Grenzen der Menschenwürde in Kauf genommen wurde.[10] Drittens erschienen in den Werken von Taring Padi Botschaften aus einem anderen politischen Spiel, dessen Feld ein gewaltiges Inselarchipel umfasst, und dessen kollektive Erinnerung durch europäische Ausbeutung, den Unabhängigkeitskrieg, die Militärherrschaft Suhartos und die Kämpfe um seine Nachfolge geformt ist. So wenig, wie sich die Künstler:innen-Gruppe aus der javanischen Residenz- und Universitätsstadt vorstellen konnte, dass Betrachtende die revolutionäre Botschaft ihrer Werke übersehen, so wenig konnten sich in Deutschland aufgewachsene, für visuelle antisemitische Botschaften sensibilisierte Beobachter:innen vorstellen, dass Chiffren, die erfunden wurden, um Juden herabzuwürdigen, anders gemeint sein könnten.
[1] Hutter präsentiert Beispiele der wechselseitigen Irritation von Spielzügen in den „ernsten Spielen“ Kunst und Wirtschaft seit der Renaissance. Michael Hutter, Ernste Spiele. Geschichten vom Aufstieg des ästhetischen Kapitalismus, Paderborn: Fink, 2015.
[2] Harry Lehmann übernimmt den Gehaltsbegriff von Adorno und nennt die konzeptionelle Form dieser Phase der Kunstspielentwicklung „Gehaltsästhetik“. Harry Lehmann, Gehaltsästhetik. Eine Kunstphilosophie, Paderborn: Wilhelm Fink, 2016.
[3] Jürgen Kaube, „Die Judensau von Kassel. Eine Documenta der Verschlagenheit: Die Schau offenbart ihren Antisemitismus“, FAZ, 23.6.22.
[4] Claudius Seidl, „Die Wut wird größer“, FAZ, 13.9.22.
[5] Jakob Baier, „Antisemitische Filme auf der Documenta: Augen zu und durch“, taz, 23.8.22.
[6] Sandra Danicke, „Schulligum“, Frankfurter Rundschau, 25.6.22.
[7] Drohne et al., sowie Heinz Schütz, "documenta fifteen - ein Politikum: Was bleibt?" Kunstforum International 285, in Nora Drohne, Timo Dulle, Raphael Göpel, Monika Schlicher und Christina Schott (Hg.), Indonesien auf der documenta fifteen: Von der Kunst, in Dialog zu treten, Bonn: Stiftung Asienhaus, Abt. für Südostasienwissenschaft der Universität Bonn, 2022.
[8] Marianne Dautrey: “Censorship at documenta fifteen”, Universes in Universe, Erstveröff. 30.8.22.
[9] Michael Rothberg, „Antisemitismus als Bumerangeffekt“, Berliner Zeitung, 5.7.22.
[10] Zitiert wird Claudius Seidl, Blind – oder böse? Die Documenta sieht keinen Antisemitismus“, FAZ, 29.7.22.
Zitation
Michael Hutter, Ästhetisierte Deutungskämpfe. Der documenta-fifteen-Skandal als soziologisches Experiment, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/aesthetisierte-deutungskaempfe