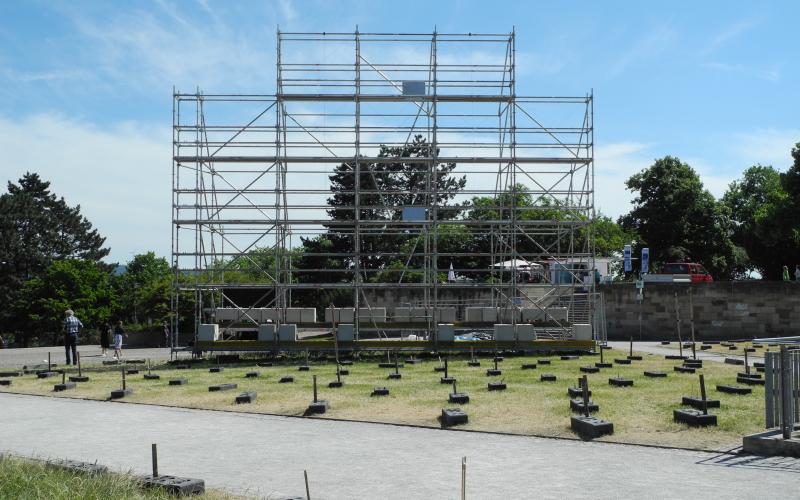Vor ca. einem Jahr erschien in der Frankfurter Rundschau ein Artikel von Hans Eichel, ehemals Oberbürgermeister von Kassel, hessischer Ministerpräsident und Bundesfinanzminister, in dem sowohl die Debatte über die documenta 15 als auch der Abschlussbericht des documenta-Expert*innen-Gremiums kritisch bilanziert wird.[1] In Bezug auf die Debatte heißt es zum Beispiel, sie habe nach der Entdeckung antisemitischer Bildelemente auf dem Banner People‘s Justice des indonesischen Kollektivs Taring Padi „hysterische Formen“ angenommen. Dem Expert*innen-Gremium wiederum wirft Eichel Einseitigkeit und Voreingenommenheit vor. Dabei spielt auch ein konstatiertes Missverhältnis zwischen der Aufmerksamkeit und Erregung auf der einen und dem konkreten Ergebnis des Expert*innen-Gremiums auf der anderen Seite eine Rolle, das maximal vier ausgestellte Werke als antisemitisch klassifiziert hatte: „Das war’s?! Fünfzehnhundert Künstlerinnen und Künstler, fünf- bis siebenmal so viele wie bei jeder documenta zuvor, oft in Kollektiven verbunden, nahmen an der documenta fifteen teil. ‚Antisemita‘, ‚documenta der Schande‘, ‚Feuerwerk des Antisemitismus‘? […] Wir könnten uns glücklich schätzen, wenn es in Deutschland so wenig Antisemitismus gäbe wie auf der documenta fifteen.“[2] Eichel jedenfalls kritisiert, dass das Expert*innen-Gremium diesem Missverhältnis zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dass es sich also letztlich – um bei seinem Begriff zu bleiben – an der Hysterisierung beteiligt habe.[3]
Im Folgenden will auch ich mich mit dem Abschlussbericht des Expert*innen-Gremiums auseinandersetzen.[4] Dabei werde ich mich hauptsächlich auf die inhaltlich-konzeptionellen Ausführungen zum Thema Antisemitismus konzentrieren (und weniger auf die Analysen einzelner Kunstwerke und auf die Bemerkungen zum kuratorischen Konzept und zur Governance der documenta). Letztlich – dies sei hier vorweggenommen – komme auch ich zu dem Schluss, dass ein Missverhältnis besteht, und zwar zwischen der Konturierung eines differenzierten Begriffs von Antisemitismus einerseits und der unangemessen-einseitigen Beschreibung des Nahost-Konflikts als Kontext für die Analyse von israelbezogenem Antisemitismus andererseits. In diesem Sinne bin ich vor allem an den Inkonsistenzen des Berichts interessiert, an einem Missverhältnis also, das dem Bericht selbst inhärent ist.
In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass der Abschlussbericht von einer Spannung zwischen postkolonialer Kritik und Antisemitismuskritik durchzogen ist. Genauer gesagt wird die Spannung vor allem dadurch ersichtlich, dass zwei Mitglieder, die postkoloniale Perspektiven repräsentieren sollten, noch vor der Veröffentlichung des Berichts aus dem Gremium ausgeschieden sind. Im Bericht wird dies lediglich mit einem Satz und beinahe beiläufig erwähnt. Das ist insofern bemerkenswert, als die documenta 15 weitgehend als postkoloniale Kunstschau rezipiert wurde, es also durchaus erwartbar gewesen wäre, dass der Abschlussbericht das Verhältnis zwischen postkolonialer Kritik und Antisemitismuskritik zu einem zentralen Thema macht.[5] So gesehen wäre es auch vorstellbar gewesen, dass der Austritt von postkoloniale Perspektiven repräsentierenden Mitgliedern das gesamte Unterfangen in Frage gestellt und möglicherweise zu einem Scheitern des Gremiums geführt hätte.[6] Doch wie gesagt, der Ausstieg findet in einem Satz Erwähnung, und in einer Fußnote wird den beiden ausgeschiedenen Gremiums-Mitgliedern Dank ausgesprochen (ebenfalls in einem Satz).
Kurzum, die Art und Weise, wie die (Un-)Möglichkeit der Verbindung von postkolonialen und antisemitismuskritischen Perspektiven hier verhandelt, besser gesagt: nicht verhandelt wird, überrascht. Hinzu kommt, dass sich – wie bereits angedeutet – ein sehr einseitiger Blick auf den Nahost-Konflikt entfaltet, der sich nicht um mögliche Einwände aus postkolonialer Richtung scheren muss. In diesem Sinne wäre Hans Eichels Diagnose einer „Schlagseite“ des Abschlussberichts durchaus zuzustimmen. Und mit dieser Schlagseite lassen sich Gremium wie Abschlussbericht als Ausdruck einer autoritären Formierung der Antisemitismuskritik bzw. – in den Worten von Marion Detjen – einer „autoritären Diskursbegradigung“ verstehen.[7]
Eindeutigkeit vs. Plausibilität – Unterscheidungen und Differenzierungen
Das Bemühen, einen differenzierten Begriff von Antisemitismus zu entwickeln, ist dem Bericht durchaus zugute zu halten. Bemerkenswert ist zum Beispiel, dass und auf welche Weise auf die beiden gängigen Antisemitismus-Definitionen – einerseits die Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), andererseits die Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) – Bezug genommen wird. Bekanntlich ist um diese Definitionen in den letzten Jahren ein veritabler Streit entstanden. Die Heftigkeit und scheinbare Unausweichlichkeit dieses Streits haben gerade in Deutschland auch damit zu tun, dass staatliche Institutionen die IHRA-Definition als ultimativ-verbindliche Referenz im Rahmen von Kultur- und Wissenschafts-Förderung zu implementieren versuchen. Das Expert*innen-Gremium jedenfalls schlägt einen anderen Weg ein: In angenehm unaufgeregter Weise wird der Versuch unternommen, die beiden Definitionen als sich wechselseitig ergänzend zu verstehen. Das heißt, bei der Entwicklung eines Antisemitismus-Begriffs werden beide Definitionen berücksichtigt und zueinander ins Verhältnis gesetzt, und offenbar haben Parteinahme oder Hierarchisierung an dieser Stelle keine Rolle gespielt.[8]
Ähnlich behutsam geht das Gremium auch dabei vor, auf der documenta 15 gezeigte Exponate als antisemitisch zu qualifizieren. Davon zeugt erstens die überschaubare Anzahl der beanstandeten Werke (wie gesagt handelt es sich um vier).[9] Zweitens wird der Diskussion dieser Werke viel Platz eingeräumt, was darauf schließen lässt, dass es sich die Mitglieder des Gremiums keineswegs leicht gemacht, sondern im Gegenteil für ihre Begründungen viel Zeit aufgewandt haben.[10] Drittens schließlich geben die Verfasser*innen des Abschlussberichts deutlich zu verstehen, dass es auch innerhalb des Gremiums divergierende Meinungen und Einschätzungen gab, und zwar auch noch nach dem Austritt der beiden Vertreter*innen postkolonialer Ansätze. So heißt es gleich zu Anfang in der dem Bericht vorangestellten Zusammenfassung, dass „die Einschätzungen“ bei zwei Exponaten „nicht ganz deckungsgleich“ seien (Gremium: 5). Entsprechend nehmen die Autor*innen eine Einschränkung vor: Manche Werke lassen sich als eindeutig antisemitisch klassifizieren, während andere „plausiblerweise als antisemitisch […] interpretiert werden“ können. Das heißt, es wird unterschieden zwischen eindeutig und „gut begründbar“ (ebd.).
Folglich müsste man spezifizieren: Laut dem Abschlussbericht enthalten zwei auf der documenta 15 gezeigte Exponate eindeutige antisemitische visuelle Codes (People’s Justice von Taring Padi und eine Zeichnung von Naji al-Ali in den Archives des luttes des femmes en Algérie). Bei den anderen beanstandeten Werken (die Filmreihe Tokyo Reels, der Bildzyklus Guernica Gaza sowie weiteren Zeichnungen von Burhan Karkutli in den Archives des luttes des femmes en Algérie) hingegen lasse sich der Antisemitismusvorwurf lediglich plausibilisieren. Zudem wird an dieser Stelle erläutert, dass die Plausibilität nur bei Tokyo Reels „völlig eindeutig scheint“ (ebd.), während bei Guernica Gaza und den Zeichnungen von Burhan Karkutlis die Meinungen auseinandergingen.
Allerdings kommt es mir hier nicht auf ein Zahlenspiel an. Eher interessiert die Diskrepanz zwischen der behutsamen und Unschärfen oder Grauzonen durchaus in Rechnung stellenden Klassifizierung einerseits und der einseitigen Beschreibung des Nahost-Konflikts andererseits, die mit einer hochgradig pauschalisierend-vereindeutigenden Anwendung der Kategorie des israelbezogenen Antisemitismus einhergeht.[11] In diesem Zusammenhang ist die von mir im obigen Zitat vorgenommene Auslassung von Bedeutung. Da, wo am Ende des vorletzten Absatzes die eckige Klammer mit drei Punkten steht, steht im Abschlussbericht: „im Sinne eines israelbezogenen Antisemitismus“ (ebd.). Das heißt, die Klassifizierung der nicht ganz eindeutig zuzuordnenden Werke als plausiblerweise antisemitisch erfolgt vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit israelbezogenem Antisemitismus. Mit anderen Worten taucht die Unschärfe bzw. die Unterscheidung zwischen eindeutig und plausiblerweise antisemitisch an der Stelle auf, an der der israelbezogene Antisemitismus als Kontext und Referenzrahmen fungiert. Ließe sich im Umkehrschluss also sagen, dass Formen des israelbezogenen Antisemitismus weniger eindeutig zuzuordnen und zu identifizieren sind als gewissermaßen klassische Formen?
Einseitigkeit und Pauschalisierung: Diagnose des israelbezogenen Antisemitismus
Zunächst sei deutlich gemacht, dass das Expert*innen-Gremium den israelbezogenen Antisemitismus als die „derzeit dominierende Erscheinungsform des Antisemitismus“ (ebd.: 16) begreift. Doch es gibt noch einen zweiten Grund, der erklären soll, warum es laut Expert*innen-Gremium „von besonderer Bedeutung [ist], sich auch mit dem israelbezogenen Antisemitismus zu befassen.“ (Ebd.) Die Rede ist von einer „überproportionalen Aufmerksamkeit, die Israel auf der documenta fifteen zuteilwurde.“ (Ebd.) An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass das Expert*innen-Gremium noch während der Laufzeit der documenta 15 eine erste Stellungnahme veröffentlichte, in der es vor allem um die Filmreihe Tokyo Reels ging. Genauer gesagt forderte das Gremium hier, die Präsentation der Filme zu stoppen.[12] In einer Zusatzerklärung wurde zudem konstatiert, „dass die gravierenden Probleme der documenta fifteen nicht nur in der Präsentation vereinzelter Werke mit antisemitischer Bildsprache und antisemitischen Aussagen bestehen, sondern auch in einem kuratorischen und organisationsstrukturellen Umfeld, das eine antizionistische, antisemitische und israelfeindliche Stimmung zugelassen hat.“[13] Interessanterweise wurde die Zusatzerklärung nicht von allen Mitgliedern des Gremiums unterschrieben – offenbar begannen sich die inhaltlichen Differenzen, die später zum Ausstieg der beiden postkolonialen Vertreter*innen führen sollten, hier bereits abzuzeichnen.
Auch ich empfand Tokyo Reels als eine Zumutung. Dies lag zum einen daran, dass die bisweilen propagandistischen Filme von einem krass einseitigen Blick auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser*innen geprägt sind. Zum anderen war auch der Film Cowboy des ägyptischen Filmemachers Sami Al-Salamoni Bestandteil der Reihe, der Versatzstücke antisemitischer Narrationen beinhaltet. Schließlich resultierte mein Unbehagen aus dem monumentalen Ausstellungsdisplay: An fast keiner anderen Stelle der documenta 15 gab es eine derartige Kino-Situation (großer dunkler Raum, ansteigendes Gestühl, voluminöser Sound). Entsprechend entstand der Eindruck, dass Tokyo Reels und somit auch der Kritik an Israel bzw. Israels Politik gegenüber den Palästinenser*innen in besonderer Weise Aufmerksamkeit verschafft werden sollte. Allerdings gilt das meiner Meinung nach vor allem und mehr oder weniger ausschließlich für Tokyo Reels und nicht für die gesamte documenta 15.[14]
Die Art und Weise jedenfalls, wie die Kategorie des israelbezogenen Antisemitismus im Abschlussbericht eingeführt wird, erweist sich als mehrfach problematisch. So heißt es zum Beispiel an einer Stelle, dass der israelbezogene Antisemitismus unter anderem „durch die spezifischen Bedingungen der post-nationalsozialistischen Moralkommunikation“ gekennzeichnet sei, „die die offene Ablehnung von Jüdinnen und Juden tabuisiert hat.“ Sodann erfolgt noch der Zusatz: „Teils spielt auch Schuldabwehr mit hinein.“ (Gremium: 16) Zweifellos ist es richtig, israelbezogenen Antisemitismus als „Kommunikation über Bande“ (ebd.: 17) zu charakterisieren. Immerhin bietet sich die Möglichkeit an, das nach 1945 weitgehend geächtete Ressentiment gegenüber Juden*Jüdinnen gewissermaßen zu camouflieren, und zwar durch Kritik an Israel. Gleichwohl wäre zu fragen, ob und inwiefern die spezifischen Bedingungen der post-nationalsozialistischen Moralkommunikation und insbesondere die Schuldabwehr von Deutschland als NS-Nachfolgestaat abstrahiert und also auf andere Kontexte übertragen werden können. Mit anderen Worten: Welche Rolle spielen Konzepte und Theoreme wie post-nationalsozialistische Moralkommunikation und Schuldabwehr, die im Angesicht der besonderen Verhältnisse in Deutschland nach 1945 entwickelt wurden, für die documenta 15 bzw. für die hier ausstellenden Kollektive vor allem aus dem sogenannten Globalen Süden? Macht es Sinn, Schuldabwehr als Referenz zu benennen, wenn es doch eigentlich um die indonesische Aktivist*innen-Gruppe Taring Padi geht?[15]
Auch wenn ich diese Fragen wichtig finde, weil sie letztlich auch das betreffen, was mit dem Schlagwort methodologischer Nationalismus bezeichnet wird – in der Tat ließe sich fragen, ob nicht die Debatte über die documenta 15 in Deutschland insgesamt durch methodologischen Nationalismus charakterisiert war –, scheint mir ein anderer Aspekt noch mehr von Bedeutung zu sein. Es geht um den engen Zusammenhang zwischen israelbezogenem Antisemitismus und Nahostkonflikt, den auch das Expert*innen-Gremium unterstellt. Bezeichnend ist nun, wie dieser Zusammenhang hergestellt wird: Einerseits wird konstatiert, dass der israelbezogene Antisemitismus die Wahrnehmung des Nahostkonflikts präge und strukturiere. Dies zeige sich vor allem darin, dass der Konflikt „zu einem manichäischen Ringen zwischen den Kräften des Guten und des Bösen, unschuldigen Opfern und blutrünstigen Tätern stilisiert“ (ebd.) würde. Bestimmt sind antisemitische Weltbilder durch eine eindeutige Aufteilung zwischen gut/Opfer und böse/Täter charakterisiert. Aber auch andere Ressentimentstrukturen und Diskriminierungsformen sind von derartigen Entgegensetzungen bestimmt. Und auch in anderen (bewaffneten) Konflikten kommen entsprechende Dynamiken zum Tragen. Was also wäre hier spezifisch, und zwar sowohl für den Nahostkonflikt als auch für Antisemitismus?[16]
Andererseits – und hierauf kommt es mir vor allem an – heißt es, dass „der Nahostkonflikt selbst als eine vom (israelbezogenen) Antisemitismus geprägte Ereignisfolge in den Blick zu nehmen“ (ebd.) sei. Ich will keineswegs abstreiten, dass Antisemitismus ein bedeutsamer Faktor hinsichtlich der Genese und Dynamik des Nahostkonfliktes war und ist, auch schon vor der Gründung des Staates Israel 1948. Ebenfalls will ich nicht abstreiten, dass dieser Faktor gerade im Kontext der Geschichte und Gegenwart des linken Antiimperialismus und Antizionismus häufig unterschätzt oder gar übersehen wurde und wird. Gleichwohl irritiert dieser Satz, und zwar vor allem deshalb, weil er Ausschließlichkeit suggeriert.
Zwar kommen an anderen Stellen des Berichts auch andere Faktoren und Dimensionen des Nahostkonflikts zur Sprache, zum Beispiel Israels „Besatzungspolitik“ (ebd.: 124). An dieser Stelle allerdings – es handelt sich wohlgemerkt um das methodisch-konzeptionelle Einleitungskapitel, in dem der Antisemitismusbegriff als analytische Kategorie konturiert und der zentrale Begriff des israelbezogenen Antisemitismus prominent eingeführt wird – erwecken die Autor*innen den Eindruck, dass der Nahostkonflikt eben ausschließlich auf Antisemitismus zurückzuführen sei. Interessanter Weise hat ein Mitglied des Expert*innen-Gremiums, Julia Bernstein, erst 2021 ein Buch über israelbezogenen Antisemitismus publiziert, in dem gewissermaßen deckungsgleich argumentiert wird, zum Beispiel wenn es heißt, dass „das Movens und der Charakter des politischen Konflikts als antisemitisch“ zu verstehen seien.[17] Auffallend ist allerdings, dass Bernstein im nun folgenden Satz eine Einschränkung zumindest andeutet, wenn sie schreibt, dass der „Nahostkonflikt […] also praktisch auch vom Antisemitismus bestimmt“ wird.[18] Im Abschlussbericht wiederum fehlt eine solche Einschränkung, hier ist der Nahostkonflikt nicht als auch von Antisemitismus geprägte Ereignisfolge in den Blick zu nehmen, sondern offenbar als antisemitischer Konflikt per se, wobei Antisemitismus gleichermaßen als Ursache wie als zentraler Motor zu fungieren scheint.
Auslassungen und Vereindeutigungen
Kurzum – die eingangs diagnostizierte Schlagseite manifestiert sich vor allem in der Art und Weise, wie im Abschlussbericht der Zusammenhang zwischen israelbezogenem Antisemitismus und Nahostkonflikt eingeführt wird. Besatzung, Vertreibung und Siedlungsbau sind hier – zumindest im Einführungskapitel – nicht der Rede wert. Stattdessen wird Antisemitismus als einzig gültiger Deutungsrahmen in Anschlag gebracht. Dies ist nicht nur deshalb problematisch, weil es die Legitimität palästinensischer Perspektiven (zum Beispiel die Kritik am Siedlungsbau als faktische Verunmöglichung eines palästinensischen Staates) in Abrede stellt. Es ist auch insofern wissenschaftlich unlauter, als die Anwendung des Begriffs des israelbezogenen Antisemitismus mit einem an Ignoranz grenzenden Umgang mit Forschungsliteratur korrespondiert, was sich vor allem darin ausdrückt, dass die seit mindestens 20 Jahren äußerst kontrovers und bisweilen sehr heftig geführte Debatte über israelbezogenen Antisemitismus lediglich mit einem lapidar anmutenden Satz erwähnt wird: „Über die Definition des israelbezogenen Antisemitismus und seine Abgrenzung von legitimer Kritik an Israel ist innerhalb und außerhalb der Wissenschaft eine kontroverse Debatte entbrannt.“ (Gremium: 17-18) Bemerkenswert ist außerdem, dass nach diesem Satz nicht mal eine Fußnote mit Literaturverweisen folgt.
Zum Beispiel hätte man auf das Buch Neuer Antisemitismus? verweisen können. 2004 erstmals erschienen und vor ein paar Jahren wieder aufgelegt und dabei aktualisiert, handelt es sich um eine Art Standardwerk auch und vor allem zum Thema israelbezogener Antisemitismus, das vor allem dadurch hervorsticht, dass es tatsächlich die Debatte abzubilden versucht, indem es sehr unterschiedliche und teilweise antagonistisch anmutende Positionen versammelt. In der Einleitung zur Neuausgabe jedenfalls schreiben die Herausgeber: „Der Antisemit […] hat sein klares Profil verloren.“[19] Dieser Satz bringt eine methodisch-hermeneutische Schwierigkeit auf den Punkt, die dem Phänomen des neuen und insbesondere des israelbezogenen Antisemitismus eingeschrieben zu sein scheint: eben weil es sich um eine Form von Antisemitismus handelt, die über Bande kommuniziert wird, eben weil nicht mehr von Juden*Jüdinnen, sondern von Israel die Rede ist, lässt sich Antisemitismus nicht mehr so leicht erkennen. Das heißt aber auch, dass die Grenze zwischen legitimer Kritik an israelischer Regierungspolitik und antisemitischem Ressentiment bisweilen schwer zu ziehen ist.
Zwar bringen einige Antisemitismusforscher*innen an dieser Stelle den sogenannten 3-D-Test ins Spiel: Wenn die Kritik darauf hinauslaufe, Israel zu delegitimieren und zu dämonisieren und andere bzw. doppelte Standards anzulegen (also mit strengeren Maßstäben als sonst zu messen), dann handele es sich eindeutig um Antisemitismus. Allerdings – ich hatte dies bereits angedeutet – ließe sich die Frage stellen, in welchen (auch militärischen) Konflikten eigentlich nicht dämonisiert und delegitimiert wird. Auch der Abschlussbericht problematisiert den 3-D-Test zumindest implizit, und zwar im Zusammenhang mit der ausführlichen Diskussion der Archives des luttes des femmes en Algérie. Hier wird konstatiert, dass die „entmenschlichende Darstellung israelischer Soldat*innen beziehungsweise ‚zionistischer Milizen‘ als Maschinenwesen“ zwar „der Logik antisemitischer Dämonisierung“ entsprechen könne, aber nicht „eindeutig auf visuelle antisemitische Codes“ verweise, da die „Darstellung von Soldat*innen als herzlose Tötungsmaschinen […] ein etabliertes Motiv ohne spezifische antisemitische Anklänge“ (Gremium: 64) sei. So gesehen mag der 3-D-Test manchmal hilfreich sein und eine Annäherung ermöglichen. Das heißt aber keineswegs, dass er ein irgendwie verlässliches Instrument darstellt. Man kommt also nicht umhin anzuerkennen, dass die Diagnose eines mangelnden Profils (des israelbezogenen Antisemitismus) mit dem Problem der Erkennbarkeit und Identifizierbarkeit einhergeht.
Der Abschlussbericht des Expert*innen-Gremiums umgeht dieses Problem. Genauer gesagt ist er durch einen fundamentalen Widerspruch gekennzeichnet: Auf der Ebene der Empirie, auf der Ebene der während der documenta 15 gezeigten Ausstellungsexponate also wird das Problem der Erkennbarkeit durchaus eingeräumt. Immerhin wird hier zwischen eindeutig und plausiblerweise antisemitisch unterschieden, wobei letztere Ein- und Zuordnung ausschließlich bei Fällen von israelbezogenem Antisemitismus vorgenommen wird. Auf methodisch-konzeptioneller Ebene wiederum spiegelt sich die Problematisierung nicht wider. Zumindest wird im Zusammenhang mit einem äußerst einseitigen Blick auf den Nahostkonflikt ein hochgradig vereindeutigender Begriff des israelbezogenen Antisemitismus in Anschlag gebracht, und zwar unter Absehung von relevanter Forschungsliteratur, wobei der seit Jahrzehnten sich hinziehende und hochgradig komplexe Nahostkonflikt auf das antijüdische Ressentiment reduziert wird. Der Umstand, dass die Debatte über israelbezogenen Antisemitismus nicht nur kontrovers geführt wird, sondern die Forschungslandschaft polarisiert und spaltet, zum Teil mit dramatischen Konsequenzen, ist dem Expert*innen-Gremium kaum einer Erwähnung wert. Dabei hatte es offenbar innerhalb des Gremiums selbst eine Spaltung gegeben. Und es würde nicht verwundern, wenn diese Spaltung auch mit dem einseitigen Blick auf den Nahostkonflikt und dem vereindeutigenden Begriff des israelbezogenen Antisemitismus zusammengehangen hätte. Einer postkolonialen Perspektive auf den Nahostkonflikt jedenfalls, für die es möglicherweise naheliegend wäre, mit Blick sowohl auf die Geschichte des Zionismus als auch auf die Praxis von Siedlungsbau und Besatzungspolitik koloniale Herrschaftsmuster zu assoziieren, wird durch diese Einseitigkeit und Vereindeutigung eine unmissverständliche Absage erteilt.
Schluss
Im Abschlussbericht wird einleitend auch die Arbeitsweise des Gremiums erläutert. An einer Stelle heißt es: „Im Ergebnis können wir einen Bericht vorlegen, der trotz der teilweise großen inhaltlichen Differenzen vom gesamten Gremium getragen wird. Klar ist aber auch, dass wohl keines der Mitglieder von sich behaupten würde, dass es jede Einschätzung des Berichts genau so getroffen und jeden Satz genau so formuliert hätte.“ (Ebd.: 12) Meiner Lesart, die vor allem Widersprüche und Inkonsistenzen fokussiert, könnte man also vorhalten, dass sie letztlich ins Leere läuft, da Ungereimtheiten gewissermaßen methodisch eingepreist gewesen waren. Und doch fällt das Gremium ein durchaus starkes Gesamturteil, zum Beispiel wenn es schreibt, die documenta 15 habe „als Echokammer für israelbezogenen Antisemitismus“ (ebd.: 71) fungiert. An dieser Stelle ist auch der nächste Halbsatz von Bedeutung: „und manchmal auch für Antisemitismus pur“ (ebd.). Das heißt, das Gremium unterscheidet zwischen israelbezogenem Antisemitismus und sogenanntem puren Antisemitismus. Diese Unterscheidung erinnert an die zuvor auf methodisch-konzeptueller Ebene vorgenommene Entgegensetzung von eindeutig antisemitisch und plausiblerweise antisemitisch (im Sinne eines israelbezogenen Antisemitismus). Erneut stellt sich die Frage nach dem Charakter und der Erkennbarkeit des israelbezogenen Antisemitismus. Offenbar scheint dieser im Verständnis des Gremiums nicht pur, also nicht rein zu sein. Es muss sich demnach um eine Mischform handeln, die zwischen unterschiedlichen Bestandteilen (Antizionismus, Kritik an israelischer Besatzungs- und Siedlungspolitik, Dämonisierung und Delegitimierung, antijüdisches Ressentiment etc.) oszilliert. Aber wie kann ich von einer Mischform ausgehen, deren Bestandteile stets genau zu eruieren wären (was in der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Exponaten auch geschieht), und dann zu derart pauschalisierenden Gesamturteilen („Echokammer für israelbezogenen Antisemitismus“) kommen?
Letztlich wird man den Eindruck nicht los, dass der Bericht selbst oszilliert: zwischen dem Eingeständnis von Uneindeutigkeit gerade bei israelbezogenem Antisemitismus und krass vereindeutigenden Schlussfolgerungen, die israelbezogenen Antisemitismus betreffen. Durch diese Tendenz zur Vereindeutigung bei israelbezogenem Antisemitismus besteht eine Nähe zu dem, was ich eingangs als autoritäre Formierung der Antisemitismuskritik bezeichnet habe. Zumindest wird sich das Gremium die Frage gefallen lassen müssen, ob und inwiefern das Gesamturteil – „Echokammer für israelbezogenen Antisemitismus“ – der zunehmenden Delegitimierung postkolonialer sowie propalästinensischer und antizionistischer Perspektiven (auch unter Juden*Jüdinnen) zugearbeitet hat.
[1] Einen Überblick über die Debatte bietet Dirk A. Moses: The German Campaign against Cultural Freedom: Documenta Fifteen in Context. In: grey room 92 (2023), S. 75-93. Das Expert*innen-Gremium wurde im Juli 2022 von den Gesellschafter*innen der documenta eingesetzt, um die Kunstschau im Hinblick auf Antisemitismus wissenschaftlich zu überprüfen.
[2] Hans Eichel: Abschlussbericht Documenta: Von Anfang an Schlagseite. In: Frankfurter Rundschau, 13.3.2024.
[3] Die von Eichel zitierten skandalisierenden Formeln „Antisemita“, „Documenta der Schande“ und „Feuerwerk des Antisemitismus“ zirkulierten in Medien wie dem Spiegel und wurden von verschiedenen Protagonist*innen in Umlauf gebracht. Eichel hatte sich schon vorher kritisch zur Debatte über die documenta 15 geäußert und dabei auf eine Leerstelle bzw. ein Versäumnis hingewiesen: Im Zuge der Aufregung um die antisemitische Figur auf dem Wimmelbild von Taring Padi sei zwar nicht untergegangen, dass hier (der Kampf gegen) das Suharto-Regime in Indonesien Thema war sowie der in den 1960er Jahren verübte Massenmord vor allem an Kommunist*innen; was allerdings überhaupt nicht zur Sprache kam, sei der Umstand gewesen, „dass unser Land diese Diktatur unterstützt hat, unser Kanzler, damals Helmut Kohl, Suharto als Freund betrachtete.“ Hans Eichel: „Jetzt geht es immer weniger um die Kunst, die auf der documenta fifteen gezeigt wird“. In: Frankfurter Rundschau, 18.7.2022. Eichel zufolge wäre ein öffentlich-offizielles Bedauern dieses Umstands angemessen gewesen, gerade auch im Sinne einer Begegnung auf Augenhöhe.
[4] Für Anregungen und Kommentare danke ich Christoph Gollasch, Urs Lindner und Aram Ziai.
[5] Hierzu heißt es an einer Stelle in der Einleitung: „Auch das Verhältnis von Antisemitismus und postkolonialer Kritik, das in der Debatte um die documenta wieder einmal ins Zentrum öffentlicher Auseinandersetzungen gerückt ist, bedarf einer offeneren und sachlicheren Diskussion, als sie die hiesige Öffentlichkeit derzeit zu liefern vermag. Die Mitglieder des Gremiums werden an diesen Debatten teilnehmen, aber nicht in diesem Bericht.“ Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta 15: Abschlussbericht, 6.2.2023, S. 11 (im Folgenden zitiert als Gremium).
[6] Dirk Moses (2023: 82) z.B. resümiert: „The panel now possessed no expertise on the contexts in which the incriminated art was produced.“
[7] Marion Detjen: documenta fifteen: Was ist das für eine Wissenschaft?. In: Die Zeit, 18.9.2022. Detjen hatte sich noch während der Laufzeit der documenta 15 und also lange vor der Publikation des Abschlussberichts zu Wort gemeldet. Gegenstand ihrer Kritik war eine Stellungnahme des Expert*innen-Gremiums, die kurz zuvor veröffentlicht worden war. Ich werde hierauf zurückkommen. Allgemein zur autoritären Formierung der Antisemitismuskritik siehe Peter Ullrich: Wird ausgerechnet Anti-Antisemitismus zu einem Katalysator der autoritären Wende?. In: Luxemburg – Gesellschaftsanalyse und linke Praxis, Dezember 2024.
[8] Vielleicht müsste ergänzt werden, dass Parteinahme und Hierarchisierung zumindest vordergründig keine Rolle gespielt haben. Aram Ziai, Professor für Entwicklungspolitik und Postkoloniale Studien in Kassel, nämlich hat sich kürzlich intensiv mit dem Abschlussbericht sowie dem hier zu beobachtenden Umgang mit beiden Antisemitismus-Definitionen auseinandergesetzt. Dabei kommt er zu folgendem Schluss: „Der vom Bericht erhobene Anspruch, sich auf beide Definitionen zu stützen, ist […] irreführend, er ist sehr deutlich an der IHRA-Definition und ihrem Fokus aus israelbezogenen Antisemitismus orientiert.“ Aram Ziai: Konflikte um Antisemitismus bei der documenta 15. Zum Abschlussbericht des Expert:innen-Gremiums. In: Peripherie 174/175 (2024), S. 288-305 (hier: S. 294).
[9] Erläuternd heißt es, dass „das Gremium nur diejenigen Werke in den Bericht aufgenommen [hat], bei denen alle Mitglieder der Überzeugung waren, dass zumindest problematische Aspekte vorliegen. Das impliziert im Übrigen auch, dass eine Reihe von Werken, die nur einzelne Mitglieder des Gremiums, außenstehende Beobachter*innen oder Betroffene als ebenfalls problematisch ansehen, keinen Eingang in den Bericht gefunden haben.“ (Gremium: 13)
[10] Ob man den Begründungen des Gremiums im Einzelnen folgen mag oder nicht, ist eine andere Frage, die hier nicht weiter interessieren soll. Einige Kritiker*innen des Abschlussberichts haben sich ausführlich mit den beanstandeten Exponaten auseinandergesetzt und kommen teilweise zu anderen Ergebnissen als das Gremium: Joseph Croitoru: documenta 15 in Kassel: Historiker zum Streit um Filmreihe Tokyo Reels. In: Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA), 15.9.2022. Hauenstein/Eyal Weizman: Der zurückfliegende Bumerang. Die documenta 15, deutsche Debatten und Leerstellen. In: Jürgen Zimmerer (Hg.): Erinnerungskämpfe. Neues deutsches Geschichtsbewusstsein. Ditzingen 2023, S. 328-351; Stefanie Schüler-Springorum: „Guernica Gaza“. Zur Diskussion über den Zyklus des palästinensischen Künstlers Mohammad Al Hawajri. In: Soziopolis, 14.6.2023. Siehe auch Ziai (2024).
[11] Zum Begriff der Grauzonen im Kontext der Debatten über Antisemitismus siehe Peter Ullrich/Alban Werner: Ist ‚DIE LINKE‘ antisemitisch? Über Grauzonen der „Israelkritik“ und ihre Kritiker. In: Zeitschrift für Politik 58/4 (2011), S. 424-441.
[12] Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta 15: Presseerklärung, 10.9.2022.
[13] Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta 15: Presseerklärung der unterzeichnenden Mitglieder, 9.9.2022.
[14] Das heißt, mich überrascht der Befund des Expert*innen-Gremiums, Israel sei überproportionale Aufmerksamkeit zuteilgeworden und die documenta durch eine israelfeindliche Stimmung geprägt gewesen. Eher teile ich den Eindruck des Literaturwissenschaftlers Patrick Eiden-Offe, der festhält, dass bei „der überwiegenden Mehrzahl der ‚Vielzahl‘ an Werken und Projekten, die bei der documenta präsentiert werden, […] der israelisch-arabische Konflikt schlicht überhaupt keine Rolle“ gespielt hat. Patrick Eiden-Offe: Ein befremdlich freundlicher Aktivismus. Einige Gedanken nach einem Besuch der documenta 15 an ihrem vorletzten Wochenende. In: Merkur, 15.9.2022. In ihrer Kritik an der Stellungnahme und dem darin geäußerten Befund hat Detjen (2023) zurecht angemerkt, dass nicht mal eine „halbwegs objektive Übersicht“ existiere, „wie viele Werke oder Teilwerke sich überhaupt dem Thema Nahost widmen.“
[15] Mit Blick auf die Reaktionen von Protagonist*innen der globalen Linken auf das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 argumentiert die Soziologin Karin Stögner, dass sich das Theorem des Schuldabwehrantisemitismus durchaus von Deutschland abstrahieren lasse: „Es liegt nahe, die ausbleibende Solidarität seitens maßgeblicher internationaler linker und feministischer Communities mit den israelischen Opfern zuweilen als eine neue Manifestation des alten Schuldabwehrantisemitismus zu interpretieren. Die Verhältnisse der postnazistischen Gesellschaft sind nicht auf die unmittelbaren Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus beschränkt, wie auch der Antisemitismus ein globales Phänomen ist.“ Karin Stögner: Der neue Unwille zu trauern. Kritische Theorie und Antisemitismus nach dem 7. Oktober. CARS Working Papers 19 (2024), S, 1-12 (hier: S. 4). Wie genau der Schuldabwehrmechanismus bei internationalen linken und feministischen Protagonist*innen funktionieren bzw. worin genau deren Schuld bestehen soll, bleibt allerdings unklar.
[16] Interessanter Weise nimmt der Abschlussbericht an anderer Stelle eine entsprechende Einschränkung vor – ich werde sogleich darauf zu sprechen kommen.
[17] Julia Bernstein: Israelbezogener Antisemitismus. Erkennen – Handeln – Vorbeugen. Weinheim/Basel 2021, S. 105.
[18] Ebd., Kursivsetzung durch mich. In einer kritischen Besprechung von Bernsteins Buch haben der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik und der Politikwissenschaftler Gert Krell übrigens angemerkt: „Das Hauptproblem sehen wir darin, dass die Autorin mit der palästinensischen bzw. arabischen Konfliktpartei genau dasselbe macht, was sie im Falle Israels als Antisemitismus bekämpft: Dämonisierung, Delegitimierung und Doppelstandards.“ Micha Brumlik/Gert Krell: Israel und der Nahostkonflikt: Dämonisierung, Delegitimierung und Doppelstandards. In: Frankfurter Rundschau, 7.12.2021.
[19] Doron Rabinovici/Natan Sznaider: Neuer Antisemitismus. Die Verschärfung einer Debatte. In: Dies./Heilbronn, Christian (Hg.): Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte. Berlin 2019, S. 9-27 (hier: S. 9).
Zitation
Felix Axster, Zwischen Differenzierung und Vereindeutigung. Kommentar zum Abschlussbericht des Expert*innen-Gremiums der documenta 15, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/zwischen-differenzierung-und-vereindeutigung