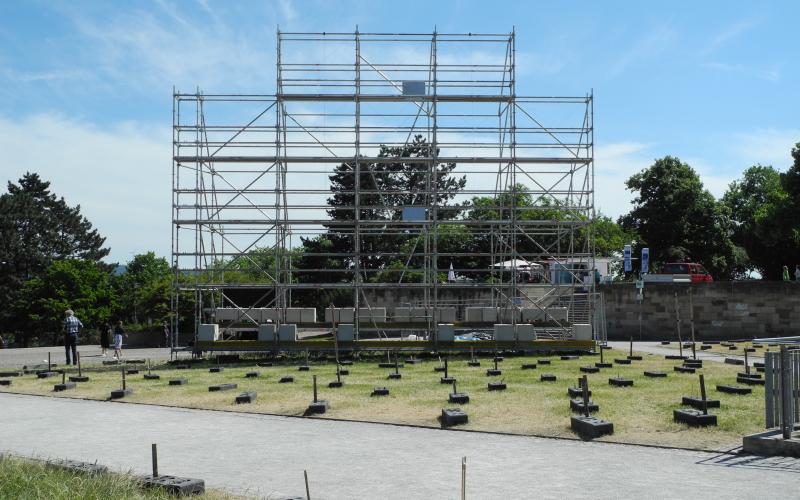Die documenta fifteen, die vom 18. Juni bis zum 25. September 2022 in Kassel stattfand, hatte schon im Vorfeld für Aufregung gesorgt. Dies lag zum einen daran, dass die Kuration erstmals einem Kollektiv übertragen wurde, und zwar einem Kollektiv aus Indonesien, welches weitere Kollektive vor allem aus dem sogenannten Globalen Süden zum Ausstellen einlud. Zum anderen brachten hiesige Akteur*innen einige Mitglieder sowohl des Kurator*innen-Kollektivs als auch anderer eingeladener Kollektive schon früh mit der Israel-Boykottbewegung BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) in Verbindung. Und da diese Bewegung seit einigen Jahren pauschal mit Antisemitismus assoziiert wird, nicht zuletzt von staatlichen Institutionen und Behörden, stand der Vorwurf des israelbezogenen Antisemitismus im Raum. Kurz nach der Eröffnung der documenta schließlich tauchten Exponate mit antisemitischen Bildelementen auf. Entsprechend wurde der Abbruch der Kunstschau gefordert.
Wenn wir uns heute, ca. drei Jahre später, mit der documenta fifteen befassen, so tun wir dies vor allem aus zwei Gründen: 1. finden immer noch Tagungen zum Thema statt, erscheinen Aufsätze, Sammelbände und Monographien. Anders gesagt dauert die Auseinandersetzung über die documenta fifteen, sowohl was die Kunstschau selbst als auch die sie begleitende Debatte betrifft, an. 2. wird gegenwärtig über nahezu die gleichen Themen gestritten – über (israelbezogenen) Antisemitismus, Wissenschafts- und Kunstfreiheit, Eingriffe des Staates, die Reichweite kolonialismuskritischer Perspektiven. In diesem Sinne ließe sich die documenta fifteen als Symptom einer grundsätzlichen Kontroverse über Weltdeutungen verstehen, bei der sich bisweilen unversöhnlich anmutende Narrative und Entitäten gegenüberstehen: postkoloniale Kritik vs. Antisemitismuskritik, palästinasolidarische Bewegung vs. israelsolidarische Bewegung, Globaler Süden vs. Globaler Norden (oder Westen).
Bereits vor der documenta fifteen hatte es heftige Auseinandersetzungen gegeben, die ähnlich gelagert waren – erinnert sei zum Beispiel an den Streit über das Werk des kamerunischen Philosophen und postkolonialen Theoretikers Achille Mbembe, der 2020 die Eröffnungsrede bei der Ruhr-Triennale hatte halten sollen und dem ebenfalls israelbezogener Antisemitismus vorgeworfen worden war. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 und der danach einsetzenden und bis heute andauernden Zerstörung des Gaza-Streifens durch die israelische Armee haben sich die Fronten noch einmal verhärtet.
Gewiss, auf der documenta fifteen, eine der bedeutendsten Kunstausstellungen der Welt, wurde auch über einiges andere gestritten, zum Beispiel über das Verhältnis zwischen individualistischen und kollektivistischen Kulturtechniken und entsprechend über jeweils spezifische Kunstverständnisse. Doch auch hier ließe sich die Diagnose einer Kontroverse um Weltdeutungen in Anschlag bringen. In diesem Sinne besteht die Hoffnung, dass sich aus der Beschäftigung mit der documenta fifteen etwas über sie Hinausgehendes lernen oder verstehen lässt – etwa über die fehlende Sensibilität gegenüber Antisemitismus in Teilen der globalen und sich als post- oder dekolonial verstehenden Linken sowie über die schon länger zu beobachtende autoritäre Formierung der Antisemitismuskritik mitsamt ihren rassistischen Effekten.
Wie die Debatte zur documenta fifteen, geschweige denn zum Verhältnis von Antisemitismus- und Rassismuskritik, weitergehen wird, bleibt offen. Und auch dieses Dossier bleibt offen. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Texte veröffentlichen und bedanken uns bei den Autor*innen der bereits geschriebenen und noch zu schreibenden Texte.
Zitation
Felix Axster, Christoph Gollasch (Hg.), Documenta fifteen. Kunstfreiheit, Postkolonialismus, Antisemitismus, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/documenta-fifteen