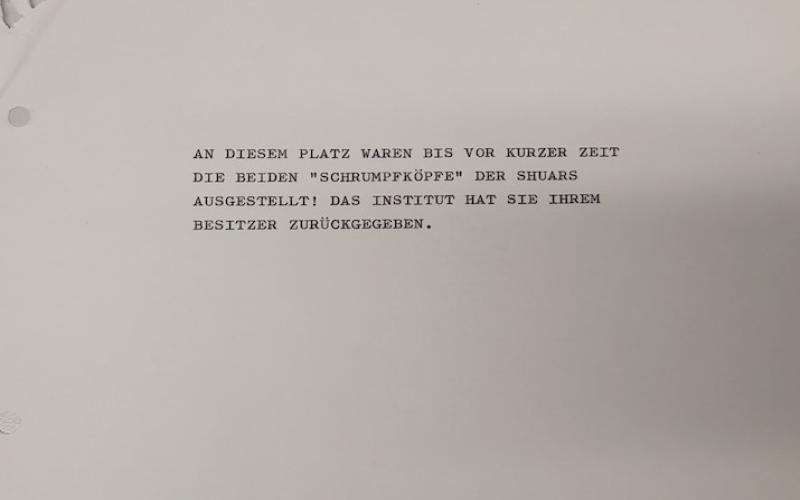Ursprünglich anlässlich der Eröffnung des Humboldt-Forums geplant, fiel die Konzeption dieses Themenschwerpunkts in ein Jahr, das, bereits während es noch stattfand, zum einschneidenden Epochenjahr, ja zur historischen Zäsur erklärt wurde. Geprägt von der Lebens- und Arbeitswirklichkeit, den öffentlichen und akademischen Debatten dieses Ausnahmejahres, dehnte sich auch dieses Dossier aus, und sollte nicht länger allein (zeitgeschichtliche Perspektiven auf) postkoloniale Restitution in Deutschland thematisieren, sondern die Besonderheiten und Schwerpunkte seines Entstehungsjahres spiegeln, das postkoloniale Fragen immer wieder und auf mannigfaltige Weise in den Vordergrund spielte. An dieser Stelle möchte ich den unter erschwerten Bedingungen arbeitenden Autor:innen, deren Texte ich im Folgenden einzeln vorstellen werde, herzlich danken.
Im ersten Beitrag Über das Zurückgeben spricht Gabriele Metzler, Historikerin an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Bénédicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der Technischen Universität Berlin, über deren Bericht zur Restitution afrikanischer Kulturgüter im Auftrag des französischen Präsidenten. Im Interview vergleicht Savoy nicht nur anschaulich den französischen Standpunkt mit dem deutschen, sondern auch die heutige globale Restitutionsdebatte mit jener nahezu gleichen, die bereits vor mittlerweile über 40 Jahren begann.
Darauffolgend legen Nelson Adebo Abiti, Kurator am Uganda National Museum, und Thomas Laely, Kulturanthropologe, in Towards a Renewed Concept of Museum in Africa – and in Europe dar, wie ethnographische Museumspraxis in Zukunft gelingen kann. Ausgehend von einer ugandisch-schweizerischen Kooperation, an der sie beide mitgewirkt haben, entwickeln sie Konzepte für die Museumsarbeit auf dem afrikanischen (und europäischen) Kontinent, die die Restitution zurückgeforderter Objekte aus dem Globalen Norden erfordert und für ein offeneres Museumsverständnis unter starker Einbindung lokaler Communities plädiert.
Während diese beiden Betrachtungen ihren Bezugpunkt in der (historisch gewachsenen, postkolonialen) Gegenwart, wenn nicht sogar Zukunft, haben, befasst sich Ellen Pupeter, Doktorandin im DFG-Graduiertenkolleg „Identität und Erbe“, mit der Begriffsgeschichte. Ihr Beitrag Restitution, Rückgabe oder Transfer? bildet die institutionellen Debatten der 1970er Jahre ab, als – wie anfangs erwähnt – zum ersten Mal auf globalen Bühnen über Restitutionsfragen gestritten und mit Hilfe von Terminologien um Deutungshoheit gerungen wurde. Bereits im März 2020 veröffentlichte Pupeter außerdem einen Beitrag über postkoloniale Restitution und DDR-Kulturpolitik in den 1970er und -80er Jahren auf Zeitgeschichte | Online, der nun ebenso diesem Dossier hinzugefügt wurde. Unter dem Titel Eine Frage der Glaubwürdigkeit? untersucht sie die 'antiimperialistische Zusammenarbeit mit den jungen Nationalstaaten' des Globalen Südens, die die DDR auch beim Thema Restitution propagierte.
Zu ebendieser Zeit, genauer gesagt über die Weihnachtsferien 1977, wurden auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs in Göttingen drei Tsantsas aus einer Vitrine entwedet. In der Fallstudie Raub von Raubgut? zeigt Lars Müller, wissenschaftlicher Projektkoordinator für das PAESE-Projekt, nicht nur den kuriosen Verlauf einer 'illegalen Restitution' von der Bundesrepublik nach Südamerika auf, sondern verortet diesen auch in den akademischen und musealen Debatten der Zeit. Dabei wird erneut deutlich, wie unterschiedlich die Perspektiven auf die Frage, wem Kultur gehört, sein können.
Die Kontroversen um das frisch eröffnete Humboldt-Forum im ebenso neu erbauten Berliner Stadtschloss fassen die Beiträge von Aleida Assmann, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin im Ruhestand, und Yves Müller, Dotorand am Fachbereich Geschichte der Universität Hamburg, zusammen. Erstere erläutert in Ping Pong in der Mitte Berlins die Debatte um den Umgang des Humboldt-Forums mit dem kulturellen Kolonialerbe und das Verhältnis des vereinten Deutschlands mit seiner geteilten Geschichte, die beide auf einzigartige Weise in diesem Projekt aufeinanderstoßen. Derweil argumentiert Yves Müller in Kein „Volksbau“ (einem ursprünglichen Reprint aus der taz, der hier im September zweitveröffentlicht und nun in das Dossier eingefügt wurde), dass weder das ursprüngliche Schloss noch sein Nachbau jemals „dem Volk – wie auch immer es definiert sein mag – gewidmet“ waren.
Im Sommer 2020 ließ außerdem die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizeibeamten in den USA die Black-Lives-Matter-Bewegung weltweit auf die Straßen gehen und erstmals auch die deutsche Debatte tatsächlich aufrütteln. Nicht nur die beinahe tägliche Aufdeckung rechtsextremer Chats in der Polizei und die vehemente Weigerung des Innenministeriums, den Rassismus in den eigenen Institutionen untersuchen zu lassen, haben seitdem gezeigt: Das Thema bedarf (auch) in Deutschland dringender Auseinandersetzung. Neben der Unterbindung rassistischer Polizeigewalt geht es vor allem um Sprache, Darstellung und Sichtbarkeit, die die Basis für eine antirassistische Gleichberechtigung von Migrant:innen und BIPOC (Black Indigenous People of Color)-Bürger:innen schaffen müssen, denn Deutschland ist trotz scheinbar großteilig konträrem Selbstverständnis längst (auch postkoloniales) Zuwanderungsland. Wer wann hierhin – vorwiegend aus den (ehemaligen) Kolonien – migrierte und Deutschland seither kulturell prägte, haben Jean-Pierre Félix-Eyoum, Mitbegründer von Deutschland Postkolonial, und Florian Wagner, Historiker an der Universität Erfurt, in dem umfassenden Überblickstext Das verdrängte Politikum festgehalten.
Nachdem Bénédicte Savoy bereits zu Beginn vergleichend auf Frankreich geschaut hatte, wendet Christine Schoenmakers, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hannover, den Blick nun nach England und untersucht die Kontroverse um ein Wandbild in Manchester, das die Gedächtniskultur eines britischen Jahrestags durcheinanderwirbelte. Das Fallbeispiel mit dem Titel Decolonizing Peterloo behandelt wiederum (post-)koloniale Migration, zeigt die (Un-)Vereinbarkeiten von historischem Erinnern auf und fragt nach den Verbindungen zwischen Vergangenem und Gegenwärtigen.
Andreas Eckert, Afrikahistoriker an der Humboldt-Universität zu Berlin, gibt anschließend mit seinem Beitrag Verheerende Folgen für den Wissenschaftsstandort Deutschland?, einem Reprint vom Sommer 2020, eine zusammenfassende Einführung in die postkoloniale Theorie, um schließlich auf die in Deutschland kontrovers diskutierten Äußerungen des kameruner Historikers Achille Mbembe einzugehen, die sogleich zur Causa avancierten und Kritik, Distanzierungen und Ausladungen im deutschsprachigen Raum zur Folge hatten. Im Dickicht der Vergleiche, zwischen einem niemals endenden Historikerstreit, Antisemitismus- und Holocaustrelativierungsvorwürfen fragt Eckert nach der Verortung postkolonialen Denkens in Deutschland und den Folgen für den Wissenschaftsstandort. Darauf aufbauend ist es sicherlich interessant, die Perspektive zu wenden, und sich solchen Forschungen zu widmen, die Solidarität und Bezugnahme zwischen Jüd:innen und Schwarzen zum Thema machen, sei es während der Judenverfolgung in Europa oder dem Civil Rights Movement einige Jahrzehnte später in den USA.[1]
Neben all diesen Debatten lässt es sich allerdings kaum leugnen, dass ein Thema unser aller Leben und Denken im letzten Jahr wohl maßgeblich bestimmt hat: Die Corona-Pandemie, die bekanntermaßen, genau wie die mittlerweile gegen sie entwickelte Impfstrategie, globale Ungleichheiten noch verstärkt. Seit spätestens März 2020 sind wir es gewohnt, täglich mit neuen Fallzahlen, Auswertungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts konfrontiert zu werden. Doch auch der Namensgeber der selbstständigen Bundesoberbehörde hat eine koloniale Vergangenheit.[2] Seine medizinischen Versuche im östlichen Afrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind Teil einer ganzen Reihe 'medizinhistorischer' Kolonialverbrechen, in die auch die Geschichte der Ihnestr. 22, dem früheren Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (1927–1945), einzuordnen ist. Diese wie auch ihr Erbe legt Manuela Bauche, Leiterin des Projekts am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, in Sehnsüchte nach genetischer Eindeutigkeit dar.
Zu guter Letzt (und zusätzlich zu den Fußnoten der jeweiligen Beiträge) habe ich gemeinsam mit meinen Kolleg:innen von der Redaktion eine multimediale Materialsammlung zum Thema erstellt, in der sich auf der Suche nach weitergehender Forschung, Rezeption in den Medien oder Podcast-Inspirationen stöbern lässt. Natürlich kann diese keinen vollständigen Katalog all dessen bieten, was es zum Themenfeld gibt. Wer aber meint, wir hätten etwas besonders Wichtiges übersehen, kann uns gern per Mail darauf aufmerksam machen. Ebenso soll das Dossier selbst laufend erweitert werden, da so manches themenverwandtes Feld, wie beispielsweise das koloniale Erbe im städtischen Raum oder die historiographiegeschichtliche Untersuchtung der Kolonialgeschichtsschreibung[3], lediglich angerissen wurde und ausgiebiger diskutiert werden sollte. Hier gilt ebenso: Skizzieren Sie Forschung und Vorhaben gern grob an genske@zzf-potsdam.de und beachten Sie bestenfalls schon bei der Erwägung, einen Beitrag für Zeitgeschichte | Online zu schreiben, die redaktionellen Hinweise.
[1] Vgl. Kim Todzi, Presseschau. Sollte das Robert-Koch-Institut umbenannt werden? – Prof. Dr. Jürgen Zimmerer in Spiegel, Freitag und Deutschlandfunk über die koloniale Forschung Robert Kochs, in: Hamburgs (post)koloniales Erbe, Juni 2020.
[2] Bspw.: Gil Shohat, Kolonialismus und Nationalsozialismus. Zur Politik des Vergleichs in den 1930er Jahren, in: Geschichte der Gegenwart, September 2020, oder Michael E. Staub, The Jewish Sixties. An American Sourcebook, Waltham, MA, 2004.
[3] Hierzu: Sophie Genske, Der imaginierte Kontinent. „African Mirror“ spiegelt die späte und unvollkommene Reflexion des Neokolonialismus, in: Zeitgeschichte-online, Juli 2019.
Zitation
Sophie Genske, Einleitung. Inhaltsübersicht zum Dossier „Restitution und Postkolonialismus“, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/einleitung