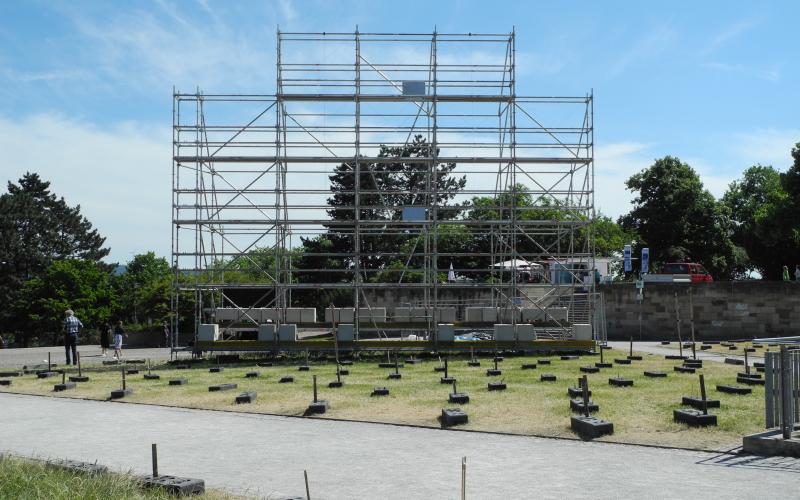Die Aufgabe, die sich dem Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta fifteen stellte, als es Ende Juli 2022, eineinhalb Monate nach Ausstellungsbeginn, seine Arbeit aufnahm, war nicht nur undankbar. Wie sich schnell herausstellte, war sie für die letztlich acht Wissenschaftler:innen zudem weder einhellig noch eindeutig zu lösen. Umso klarer lässt die Arbeit des Gremiums und deren öffentliche Rezeption ein Problem hervortreten, das sich wissenschaftlichen Expertisen in gegenwärtigen Antisemitismusdebatten grundsätzlich stellt. Ein Problem, das man das Problem polemischer Expertisen nennen könnte – und das daher auch jeden weiteren Aufarbeitungsversuch des Antisemitismusskandals auf der documenta fifteen betreffen wird.
Die Arbeit des Gremiums während der Ausstellung
Als das Expert:innengremium Ende Juli 2022 mit seiner Arbeit begann, war das Urteil der veröffentlichten Mehrheitsmeinung, wonach die documenta fifteen in erster Linie Schauplatz eines Antisemitismusskandals sei, längst gefällt. Das Gemälde People’s Justice des indonesischen Kollektivs Taring Padi, auf dem kurz nach der Eröffnung ein nahezu unbestritten als antisemitisch eingestufter Bildinhalt entdeckt worden war, war bereits abgebaut und die Rede von der „antisemita fifteen“ (SPIEGEL-Kolumnist Sascha Lobo) in der Welt. Sogar der Bundestag hatte sich am 7. Juli mit dem Skandal befasst – und die AfD mit ihrem Antrag die populären Forderungen nach Entlassung von Generaldirektorin Sabine Schormann und Entzug staatlicher Förderung für die „postkolonialistische Ideologie“ in Kultur und Forschung erhoben, weil sie Ursache der antisemitischen Entgleisungen auf der documenta fifteen sei.[1] Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, der nach dem Eklat um People’s Justice als externer Berater hinzugezogen worden war, um weitere Exponate auf Antisemitismus zu prüfen, war am 8. Juli von diesem Posten schon wieder zurückgetreten, weil er bei Schormann und der künstlerischen Leitung, dem indonesischen Kollektiv ruangrupa, Aufklärungswille und Dialogbereitschaft vermisste. Am 15. Juli hatte der Aufsichtsrat der documenta dann den Vertrag mit Schormann einvernehmlich aufgelöst und das Gremium eingesetzt.
In der Folge führte das Gremium den Auftrag, der ursprünglich Mendel übertragen worden war, systematisch aus und erarbeitete zudem Vorschläge für organisatorische Reformen, während parallel dazu in der Öffentlichkeit über weitere antisemitische Verdachtsfälle debattiert und vielfach konträre Expertisen abgegeben wurden. Obwohl von Anfang an klar war, dass sich der Abschluss dieser Arbeiten bis über das Ausstellungsende im September hinweg ziehen würde, entschloss sich das Gremium aufgrund der potentiell aufhetzenden Wirkung eines Exponats, noch in jenem Monat mittels Pressemitteilungen die öffentliche Konfrontation mit der künstlerischen Leitung zu suchen. Geschlossen forderte es ruangrupa dazu auf, die Aufführung historischer pro-palästinensischer Propagandafilme im Rahmen des Tokyo Reels Film Festival zu stoppen, bis eine kritische Kontextualisierung der darin enthaltenen israelfeindlichen bis antisemitischen Darstellungen und Terrorglorifizierungen erfolgt sei. Die formale Autorität, diese Forderung durchsetzen zu können, fehlte dem Gremium jedoch. Hatte sich Interims-Geschäftsführer Alexander Farenholtz schon öffentlich gegen weitere Entfernungen von Exponaten ausgesprochen, sofern sie nicht strafrechtlich relevant seien, so warf ruangrupa als Teil der „lumbung community“ dem Gremium schließlich vor, eine tendenziell rassistische Zensur zu betreiben.[2]
In der öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen Expert:innengremium und ruangrupa kulminierte aber nicht nur in aller Schärfe jener Konflikt um die Grenzen der Kunstfreiheit, der die Debatte um die documenta fifteen von Anfang an auch gewesen ist. Sie ließ zudem Meinungsverschiedenheiten unter den beteiligten Wissenschaftler:innen sichtbar werden. Denn nur fünf der acht Mitglieder des Gremiums unterzeichneten auch eine zweite, erweiterte Presseerklärung, die über den Fall Tokyo Reels hinaus ein „kuratorische[s] und organisationsstrukturelle[s] Umfeld“ anprangerte, „das eine antizionistische, antisemitische und israelfeindliche Stimmung“ auf der documenta fifteen zugelassen habe.[3] Dass das Gremium zu diesem Zeitpunkt schon eine solche Stimmung überhaupt empirisch belastbar gemessen haben könnte, zog die Historikerin und Publizistin Marion Detjen in einem Artikel mit dem Titel „Was ist das für eine Wissenschaft?“ umgehend in Zweifel und warf ihm vor, sich vielmehr von der öffentlichen Meinung zu Vorverurteilungen treiben gelassen zu haben (die „lumbung community“ hatte dem Gremium sogar abgesprochen, überhaupt wissenschaftlich vorgegangen zu sein).[4] Gerade dass sich das Gremium vor Abschluss seiner Forschungen so dezidiert in der Öffentlichkeit positionierte, führte also zur Infragestellung der Wissenschaftlichkeit seines Vorgehens.
Der Abschlussbericht des Gremiums und seine Rezeption
Zwei der Mitglieder, Elsa Clavé und Facile Tesfaye, die eine abweichende Meinung vertreten hatten, zogen sich danach aus dem Gremium zurück, da sie in diesem für postkoloniale Perspektiven keinen Platz mehr sahen, und wirkten daher auch nicht an der Erstellung des Abschlussberichts mit, der im Februar 2023 veröffentlicht wurde. Darin hielten die Verbliebenen zwar daran fest, dass die documenta fifteen eine „Echokammer für israelbezogenen Antisemitismus und manchmal auch für Antisemitismus pur“ gewesen sei. Bei der Beurteilung der unterschiedlichen Fälle war das Gremium jedoch offenkundig um Abwägung unterschiedlicher Interpretationsoptionen bemüht. In zwei Fällen stellte es eindeutig antisemitische Codes fest und in drei weiteren Fällen schien allen verbliebenen Mitgliedern eine Interpretation als Ausdruck von israelbezogenem Antisemitismus als „gut begründbar“, wobei in zwei dieser drei Fälle diese Einschätzung nicht von allen geteilt wurde, was die Schwierigkeit einer unstrittigen Feststellung von israelbezogenem Antisemitismus erkennen lässt. Andere Schwierigkeiten seiner Arbeit benannte das Gremium in seinem Bericht auch explizit – allen voran seine Grenzen und Leerstellen. Die Erhebung immer neuer Antisemitismusvorwürfe sei mit der Erwartung an das Gremium verbunden gewesen, „dazu in kürzester Zeit autoritativ Stellung zu nehmen“, seine öffentlichen Stellungnahmen selbst seien „kritisch kommentiert“ worden, aber gleichzeitig sei sein Arbeitsauftrag „deutlich enger und fokussierter“ gewesen, als die „öffentliche Debatte um die documenta fifteen“. Die „rassistischen Untertönen eines Teils der Kritik an ruangrupa“ würden etwa noch der wissenschaftlichen Aufarbeitung bedürfen, das „Verhältnis von Antisemitismus und postkolonialer Kritik“ verlange nach einer offeneren Diskussion, als es die deutsche Öffentlichkeit leisten konnte, und auch eine differenzierte Forschung zur „Rezeption der documenta fifteen aus jüdischer Perspektive“ fehle.[5] So wie das Gremium also anerkannte, dass es seine Arbeit unter großem öffentlichen Druck hatte durchführen müssen und diese auch allein auf die Aufarbeitung des Antisemitismusskandals verpflichtet war, so lassen die Forschungsdesiderate, die es selbst benannte, eine Aufarbeitung der gesamten öffentlichen Debatte um die documenta fifteen als dringlich erscheinen.
Selbstredend wurde auch der Abschlussbericht umgehend kritisch kommentiert. Der Medienwissenschaftler Erhard Schüttpelz etwa warf dem Gremium vor, dass es sich bei seiner Arbeit die Richtung von der Dynamik des Debattenverlaufs habe vorgeben lassen, dass es mit seinem Gutachten „die Skandalisierung auf einer fragwürdigen empirischen Basis ohne die Einbeziehung konträrer oder auch nur fachgerechter Expertise fortgesetzt [hat], statt die Skandalisierung selbst in den Blick zu nehmen, ja sogar, ohne den Verlauf der Skandalisierung überhaupt in Erwägung zu ziehen.“[6] In der Tat enthalten die Passagen des Berichts zur Bewertung der unterschiedlichen Exponate kaum ausdrückliche Bezüge auf gegenläufige Fachmeinungen, die im Zuge der öffentlichen Debatte geäußert wurden. Und den Debattenverlauf fasste der Bericht im Einleitungskapitel allenfalls entlang seines dominanten Strangs, der Skandalisierung, knapp zusammen, um dann in der Folge nur genauer auf den Umgang mit Antisemitismusvorwürfen von Seiten der Geschäftsleitung einzugehen. Er bezog einzig die von offiziellen jüdischen Organisationen geäußerte Kritik mit ein (daher auch der Verweis auf das Desiderat einer differenzierten Forschung zur Rezeption der documenta fifteen aus jüdischer Perspektive). Und Antisemitismusvorwürfe, die sich als falsch herausgestellt hatten oder offenkundig unbegründet waren, arbeitete der Bericht kaum auf (zu den Vorwürfen gegen ein weiteres Gemälde von Taring Padi, All Mining is Dangerous, wird zumindest vermerkt, dass sie sich nicht erhärtet hätten).
Interimsgeschäftsführer Alexander Farenholtz, an dem der Abschlussbericht recht unverhohlen Kritik geübt hatte, hielt dem Gremium vor, „kein[] unbefangene[r] Beobachter“, sondern „Konfliktpartei“ zu sein und ein Gutachten „mit polemische[n] Einfärbungen“ verfasst zu haben.[7] Für den australischen Historiker A. Dirk Moses, wichtiger Kritiker und Protagonist jüngerer Debatten um die deutsche Erinnerungspolitik, hatte das Gremium spätestens nach dem Ausstieg von Clavé und Tesfaye gar nicht mehr die für eine sachgerechte Beurteilung der inkriminierten Exponate unerlässliche Expertise in asiatischer wie auch arabischer Geschichte und Kunst.[8] Stattdessen habe es auf Grundlage einer parteiischen Antisemitismusdefinition, nämlich der Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), mechanisch nach antisemitischen Stereotypen gesucht, aber dabei selbst eine einseitige Perspektive auf den Nahostkonflikt zum Ausdruck gebracht.[9] Noch genauer argumentiert Felix Axster in diesem Dossier, dass der Abschlussbericht zwar ein differenziertes Antisemitismuskonzept verwende, aber letztlich zu einer einseitigen Beschreibung des Nahostkonflikts und zu vereindeutigenden Urteilen über israelbezogenen Antisemitismus neige, was ihn zum Ausdruck einer „autoritären Formierung der Antisemitismuskritik“ mache.
Israelbezogener Antisemitismus als (wissenschaftliches) Debattenproblem
Was ist also das grundsätzliche Problem wissenschaftlicher Expertisen in gegenwärtigen Antisemitismusdebatten, das in der Arbeit des Expert:innengremiums und seiner Rezeption aufscheint? Die Vorwürfe, der Bericht sei polemisch eingefärbt, das Gremium Konfliktpartei oder Teil einer autoritären Formation der Antisemitismuskritik, dokumentieren zunächst allesamt, dass der Status von Expertisen als neutrale Beobachtungen in gegenwärtigen Antisemitismusdebatten prekär ist und sie keine Anerkennung auf allen Seiten der Debatte finden. Diese Prekarität zeigt sich auch daran, dass Antisemitismusdefinitionen, für viele die Grundlage einer wissenschaftlichen Befassung mit dem Phänomen, oft nachgesagt wird, mit politischen Interessen verbunden oder zumindest politisch instrumentalisierbar zu sein. Es ist bekannt, dass einer der zentralen Autoren der IHRA-Arbeitsdefinition, Kenneth Stern, inzwischen davor warnt, dass diese Definition von rechten zionistischen Lobby-Gruppen als politische Waffe gebraucht werde, um unliebsame Gegenstimmen zum Schweigen zu bringen.[10] Die Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA), die angetreten ist, manche Schwächen der IHRA-Definition zu beheben, wird in einem Fachartikel wiederum sogar direkt auf eine Kampagne von Aktivist:innen der deutschen radikalen Linken aus dem Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin zurückgeführt.[11] Und Julia Bernstein (ein späteres Mitglied des Expert:innengremiums) hatte schon 2021 gemeinsam mit Lars Rensmann und Monika Schwarz-Friesel der JDA vorgeworfen, „keine wissenschaftliche Definition, sondern eine politische Manifestation [zu sein], die gegen Israel gerichtet ist.“[12]
Wenn selbst Antisemitismusforscher:innen anderen Antisemitismusforscher:innen Unwissenschaftlichkeit oder eine politische Agenda vorwerfen, stellt das den Status der gesamten Antisemitismusforschung als Wissenschaft in Frage, da damit ja gerade nicht auf allgemein anerkannte Kriterien Bezug genommen wird, die es erlauben würden, den Wahrheitsanspruch von Gegenpositionen zugleich anzuerkennen und wissenschaftsimmanent zu kritisieren. Dabei stehen diese polemischen Vorwürfe mit einer Formwandlung des Gegenstands der Antisemitismusforschung in Verbindung, die auch das Expert:innengremium vor ein letztlich nicht eindeutig zu lösendes Problem gestellt hat: der sogenannte „neue“ oder „israelbezogene Antisemitismus“. Wie Doron Rabinovici und Natan Sznaider festgehalten haben, ist mit diesen Begriffen ein grassierendes Misstrauen in die akademische Befassung mit dem Antisemitismus eingezogen: „Alle Beteiligten der Debatte arbeiten mit der Rhetorik des Verdachts: Der Antisemitismusvorwurf gründet auf der Vermutung, dass das Gesagte nicht das Gemeinte ist – dass Kritik an Israel nur ein Vorwand ist, um antisemitische Ideen oder Gefühle zu artikulieren, bewusst oder auch unbewusst. Die andere Seite hingegen argwöhnt, der Antisemitismusvorwurf diene nur dem Interesse Israels, legitime Kritik zum Schweigen zu bringen. Zuweilen liegen wohl beide Seiten mit ihren Verdächtigungen nicht ganz daneben“.[13] Israelkritik kann also Antisemitismus camoufliert bzw. über kommunikative Umwege verbreiten, genauso wie solche Antisemitismusvorwürfe darauf abzielen können, eine vielleicht harsche, extrem einseitige, aber nicht per se antisemitische Kritik am Staat Israel oder der israelischen Regierung zu ächten. Mithin sind sowohl Israelkritik als auch Kritik des israelbezogenen Antisemitismus potentiell polemische und politisch aufladbare Kritikformen, die strategisch für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden können (etwa zur Verbreitung von Antisemitismus oder der Delegitimierung politischer Gegner:innen). Sich beiden Seiten dieses Problems zu stellen, anstatt es einseitig auf rhetorischem oder definitorischem Wege aufzulösen, wäre insofern die methodische Minimalanforderung für einen wissenschaftlichen Umgang mit israelbezogenen Antisemitismus als diskursivem Phänomen.
Doch obwohl sich viele Wissenschaftler:innen daran versucht haben, beide Seiten dieses Problems zu adressieren, bricht jedes Mal wieder ein unversöhnlich anmutender Streit aus, wenn heute konkrete Antisemitismusdebatten geführt werden.[14] Die unauflösliche Verquickung des israelbezogenen Antisemitismus mit dem Nahostkonflikt scheint dazu zu führen, dass jede wissenschaftliche Positionierung zu einer politischen Positionierung in diesem Konflikt und damit auch zu einer polemischen Expertise wird – oder zumindest, dass ihr dieser Vorwurf gemacht werden kann, was aber auf das Gleiche hinausläuft.
Wie die Auseinandersetzung in der deutschen Öffentlichkeit mit dem terroristischen Massaker der Hamas am 7.Oktober 2023 und seinen Folgen zur Genüge bewiesen hat, ist der israelbezogenen Antisemitismus allerdings nicht bloß ein wissenschaftliches Debattenproblem, sondern er führt zu einem wachsenden Bedrohungsgefühl unter hier lebenden Jüdinnen und Juden und drückt sich in einem merklichen Anstieg antisemitischer Vorfälle aus. Gleichzeitig ist zuletzt aber ebenso deutlich geworden, dass er als Anklage mit ausgreifenden Einhegungsbemühungen des öffentlich Sagbaren einhergeht – und der Anstieg antisemitischer Vorfälle auch auf ein sehr weites Antisemitismusverständnis zurückzuführen ist.[15]
Was noch der Aufarbeitung bedarf – oder: Bausteine einer Theorie gegenwärtiger Antisemitismusdebatten
Die sogenannte Antisemitismus-Resolution, die der Bundestag am 7. November 2024 verabschiedet hat, fordert noch immer, dass der Antisemitismusskandal auf der documenta fifteen umfassend aufgearbeitet werden müsse.[16] Allerdings darf man dem Abschlussbericht des Expert:innengremiums attestieren, den Skandal so weit als möglich aufgearbeitet zu haben. Einigkeit bei der Beurteilung mehrerer Kunstwerke als Ausdruck von israelbezogenem Antisemitismus aber konnte er nicht herstellen – nicht einmal intern. Worauf dieser Bericht, wie gesehen, selbst hinweist, sind verschiedene Forschungslücken zum Verlauf der Debatte um die documenta fifteen. Was also noch der Aufarbeitung bedarf, ist weniger der Antisemitismusskandal als vielmehr die öffentliche Debatte um die documenta fifteen in ihrer ganzen Breite. Die Skandalisierung, die den Skandal in mancher Hinsicht auch erst hervorgebracht hat, war gewiss der dominante Strang dieser Debatte. Aber letztlich schoben sich in ihr verschiedene Streitfragen ineinander – wie Antisemitismus erkannt werden kann, welche Rolle er in Deutschland und dem „Globalen Süden“ spielt, die Grenzen der Kunst- und Meinungsfreiheit, der (deutsche) Umgang mit jüdischer Diversität, die Bedeutung von Rassismus und politisch-ökonomischen Machtverhältnissen in Geschichte und Gegenwart. Erst wenn die Forschung den Zusammenhang dieser unterschiedlichen Streitfragen in den Blick nimmt, ließe sich sinnvoll aufarbeiten, was das Expert:innengremium als Desiderate benannt hat: die Vielfalt jüdischer Perspektiven auf die documenta fifteen, die teils rassistische Kritik an ruangrupa, das Verhältnis von Antisemitismus und postkolonialer Kritik. Und, so kann als weiteres Desiderat ergänzt werden, die Verfahren, mit denen die (Kunst-)Kritik – auch die des Gremiums – zu ihren Antisemitismusurteilen gelangte.
Was eine wissenschaftliche Aufarbeitung der documenta-Debatte verspricht, ist eine Reflexion darüber anzuregen, wie über die genannten Fragen gestritten wurde und gestritten wird. Um die Urteile der Debattenteilnehmer:innen untersuchen zu können, müsste einstweilen eine zentrale Funktion aufgegeben werden, die wissenschaftliche Expertisen in gegenwärtigen Antisemitismusdebatten zukommt: nämlich selbst Urteile zu fällen. Und doch wären auch Beiträge zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der documenta-Debatte, die sich diesem methodischen Postulat verschreiben, nicht vor dem Vorwurf gefeit, parteiische Beobachtungen vorzunehmen und eine polemische Expertise zu liefern. Denn gegenüber dem israelbezogenen Antisemitismus kann man sich letztlich nicht in eine fiktive Neutralität flüchten, weil es sich um einen politisch in besonderer Weise instrumentalisierbaren Vorwurf handelt und daher jede wissenschaftliche Aussage über ihn, selbst Beobachtungen zweiter Ordnung, die nicht eindeutig (ver-)urteilen, als politische Positionierung im Nahost-Konflikt (miss-)verstanden werden können – und der „israelbezogene Antisemitismus“ war eben auch das zentrale und verbindende Debattenproblem des Disputs um die documenta fifteen, beginnend mit den ersten Antisemitismusvorwürfen, die fünf Monate vor Ausstellungsbeginn auf dem Blog des „Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel“ erhoben worden waren. Gerade eine Untersuchung der vielfältigen Verfahren der Kritik in der documenta-Debatte – um einen Begriff zu gebrauchen, der in den vom Abschlussbericht benannten Desideraten immer wieder auftaucht – könnte deshalb aber auch Bausteine für eine Theorie gegenwärtiger Antisemitismusdebatten liefern.
In diese Richtung zu denken, erlaubt ein weiteres Gutachten des Verfassungsrechtlers und Gremiumsmitglied Christoph Möllers, das im Auftrag von Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine minimalinvasive Lösung des Konflikts zwischen Garantie der Kunstfreiheit und Schutzpflichten gegen antisemitische und rassistische Diskriminierung in der staatlichen Kulturförderung auslotet – und sogar Dirk Moses erkennt es als theoretische Grundlage an, um den Schutz von Meinungs- und Kunstfreiheit mit einem effektiven Kampf gegen Antisemitismus zum Ausgleich bringen zu können.[17] Dieses Gutachten, das beiläufig erwähnt, dass während der documenta fifteen nach dem eindeutigen Fall People’s Justice eine „polemische öffentliche Debatte über den antisemitischen Charakter anderer Exponate“ geführt worden sei, geht von der Feststellung aus, dass selbst antisemitische und rassistische Äußerungen von der Kunst- und Meinungsfreiheit geschützt sind, soweit sie nicht „zu Rechtsguteinbußen führen“ (etwa bei den Persönlichkeitsrechten Dritter oder durch Gefährdung des öffentlichen Friedens).[18] Bei aller Freiheit in der künstlerischen Praxis seien Kunstschaffende, die von staatlichen Kulturinstitutionen gefördert werden, aber in der Pflicht, sich mit „der Kritik“ ihrer Tätigkeit, die in der Öffentlichkeit geübt werde, auseinandersetzen. Die Leitungen dieser Institutionen seien wiederum selbst in einem geklärten Fall antisemitischer Kunst, die von ihnen gefördert ausgestellt wird, allein dazu verpflichtet, zunächst intern und, wenn nötig, öffentlich eine „kritische Bewertung“ abzugeben, die präzise und zurechenbar erfolgen und als letztes Mittel als Kommentierung des Kunstwerks vor Ort angebracht werden müsse. Möllers fasst diese Reaktionen unter den Begriff einer „informellen staatlichen Einflußnahme“.[19]
In der Begründung einer Pflicht, kritische Bewertungen abzugeben und sich mit öffentlicher Kritik auseinanderzusetzen, kann man eine Rechtfertigung für das Vorgehen des Expert:innengremiums im Fall Tokyo Reels erkennen, öffentlich eine kritische Kontextualisierung zu fordern, nachdem künstlerische Leitung und Geschäftsführung dieser Pflicht nicht nachgekommen waren. Es wäre aber auch möglich, dieses Gutachten in einem wesentlich allgemeineren Sinn zu lesen: Da antisemitische und rassistische Äußerungen weitgehend von der Kunst- und Meinungsfreiheit geschützt sind, wäre der einzige Umgang, der mit ihnen in liberalen Gesellschaften gefunden werden kann, demnach der der öffentlichen Kritik. Diese grundsätzliche Einsicht lässt sich zu einer theoretischen Erklärung für den polemischen Verlauf der documenta-Debatte wenden, die über diesen konkreten Fall hinausweist, aber auch, wenn man so will, die dunkle Seite dieser Einsicht preisgibt. Da sich gerade auch eine Israelkritik, die Antisemitismus camoufliert, d.h. strategisch und kaum unstrittig ersichtlich verbreitet, von der Kunst- und Meinungsfreiheit geschützt wissen darf, könnte der einzige Weg, um sie in liberalen Gesellschaften einzuhegen und ihrer unterstellten Wirkungsabsicht umgehend entgegenzuwirken, der einer öffentliche Kritik sein, die ebenso strategisch verfährt und sie umso schärfer attackiert. Denn nur so könnte es erreicht werden, die als Verbreiter:innen von israelbezogenem Antisemitismus Kritisierten vom Gebrauch ihrer Meinungsfreiheit abzuschrecken und ihnen weitere Äußerungsmöglichkeiten zu verschließen. Eine solche „Gegenkritik“, die mehr skandalisiert als argumentiert, wandert in wissenschaftliche Expertisen ein, die im öffentlichen Meinungsstreit agieren, wie auch die zweite, nicht von allen Mitgliedern unterzeichnete Presseerklärung des Expert:innengremiums zu Tokyo Reels zeigte, die ohne empirische Belege eine „antisemitische […] Stimmung“ auf der documenta anprangerte – wohl, um den eigenen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Der Druck, den diese „Gegenkritik“ erzeugt, ist aber in jedem Fall informell. Und damit könnte sie auch nur ein Beispiel aus einer Vielzahl informeller Einhegungsbestrebungen sein, zu denen sich staatliche und gesellschaftliche Akteure in liberalen Gesellschaften durch jenes Debattenproblem gemeinschaftlich provoziert sehen, das der israelbezogene Antisemitismus ist. Als informelle Einhegungsbestrebungen ließen sich auch die Einrichtung eines Gremiums zur wissenschaftlichen Feststellung von Antisemitismus selbst oder die Antisemitismus-Resolution des Bundestags begreifen. Ihr maßgebliches Abstellen auf die IHRA-Definition hält den Meinungsdruck auf Verwaltung und Kulturinstitutionen hoch, beeinflusst womöglich die Rechtsauslegungspraxis, aber wäre in Gesetzesform wohl verfassungswidrig – und ist daher nicht rechtsverbindlich, mithin informell. Ob diese informellen Einhegungsbestrebungen eine „autoritäre Formierung der Antisemitismuskritik“ oder die einzige Möglichkeit sind, wie der Kampf gegen den israelbezogenen Antisemitismus in einer liberalen Gesellschaft effektiv geführt werden kann, liegt letzten Endes aber allein im Auge der beteiligten Betrachter:in.
[1] Deutscher Bundestag (2022): Debatte über den Antisemitismus-Skandal bei der Documenta, 7.7.2022.
[2] o.A. (2022): „Farenholtz lehnt Abbruch der documenta ab”, in: FAZ.net, 30.7.2022; Lumbung community (2022): “We are angry, we are sad, we are tired, we are united“, 10.9.2022, in: e-flux, 10.9.2022.
[3] Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta 15 (2022): Presseerklärung der unterzeichnenden Mitglieder, 9.9.2022.
[4] Marion Detjen (2022): Was ist das für eine Wissenschaft, in: Zeit online, 18.9.2022.
[5] Gremium zur fachwissenschaftlichen Begleitung der documenta fifteen (2023): Abschlussbericht, 2.2.2023, S. 5-11, 71-92, hier: 71, 5, 10, 11, 72 (H.i.O.).
[6] Erhard Schüttpelz (2023): „Die Documenta nach ihrem Ende“, in: Merkur-Blog, 18.2.2023.
[7] Mathias Lohr (2023): „Ex-documenta-Geschäftsführer: Expertenbericht zum Antisemitismus ist Teil des Problems“, in: Hessische Allgemeine, 21.3.2023.
[8] A. Dirk Moses (2023): The German Campaign against Cultural Freedom: Documenta Fifteen in Context, in: grey room (92): 74-93, S. 82-85.
[9] Ähnlich und zugleich systematischer schon während der documenta fifteen: Erhard Schüttpelz, Ikonographie am Scheideweg. Ein Dialog zur documenta fifteen, in: Merkur-Blog, 31.8.2022.
[10] Kenneth Stern (2019): I drafted the definition of antisemitism. Rightwing Jews are weaponizing it, in: The Guardian, 13.12.2019.
[11] Gerald Steinberg (2022): The Central Political Role of German Left Actors in the Campaign to Replace the IHRA Working Definition of Antisemitism, in: Journal of Contemporary Antisemitism 2(5): 67-82, hier: S. 67.
[12] Julia Bernstein et al. (2021): Faktisch falsche Prämissen. ‚Jerusalemer Erklärung‘: Drei Antisemitismus-Experten werfen der Deklaration Unwissenschaftlichkeit vor, in: Jüdische Allgemeine, 8.4.2021, S. 8.
[13] Doron Rabinovici/Natan Sznaider (2019): Neuer Antisemitismus: Verschärfung einer Debatte, in: Christian Heilbronn et al. (Hg.): Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, Berlin: Suhrkamp, 9-27, hier: 12.
[14] Siehe Dov Waxman et al. (2022): Arguing about antisemitism: why we disagree about antisemitism, and what we can do about it, in: Ethnic and Racial Studies 45 (9): 1803-1824.
[15] Die Berliner Polizeipräsidentin gab zuletzt an, die große Mehrheit antisemitischer Gewalttaten seit dem 7. Oktober 2023 sei auf Demonstrationen verübt worden und zwar gegen die Polizei – und nicht etwa gegen Jüdinnen und Juden (o.A. (2024): Polizeipräsidentin warnt Juden und Homosexuelle vor gefährlichen Orten, in: Zeit online, 18.11.2024.
[16] Deutscher Bundestag (2024), Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP: Nie wieder ist jetzt – Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken, Drucksache 20/13627, 5.11.2024, S. 3.
[17] Moses (2023): The German Campaign, a.a.O. (En. 8), S. 83.
[18] Christoph Möllers (2023): Grundrechtliche Grenzen und grundrechtliche Schutzgebote staatlicher Kulturförderung. Rechtsgutachten im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, 10.10.2022, S. 44, 48.
[19] Möllers (2023): Grundrechtliche Grenzen, a.a.O. (En. 17), S. 27-28, 40-44, hier: 27, 41, 42.
Zitation
Georg Simmerl, Polemische Expertisen. Über die (Un-)Möglichkeit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung des Antisemitismusskandals auf der documenta fifteen, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/polemische-expertisen