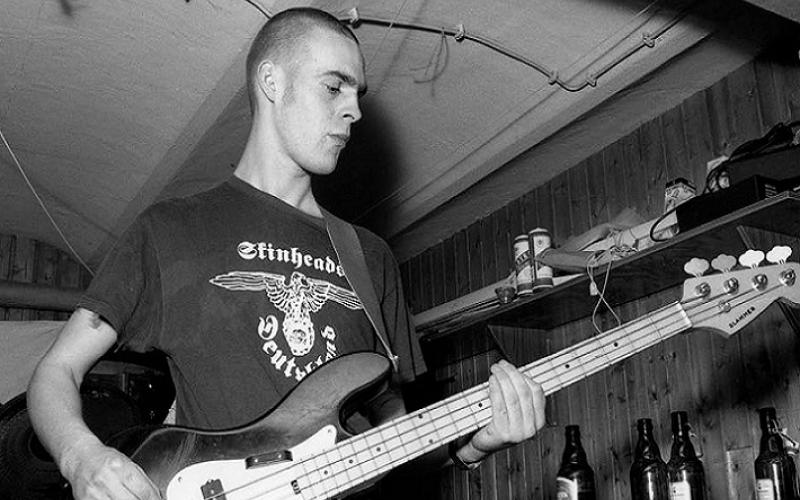In der vergleichenden Forschung zu politischer Gewalt in Deutschland spielen Unterscheidungen, die sich auf die weltanschauliche oder strategische Ausrichtung der Gewalt beziehen, eine zentrale Rolle. Gewalt gilt als ‚politisch‘, wenn sie auf die Herstellung oder Veränderung einer gesellschaftlichen Ordnung zielt, oder in diesem Sinne gedeutet wird. Und da es sehr verschiedene politische Visionen und Utopien gibt, erscheint es wichtig, diese begrifflich voneinander abzugrenzen. Der politische Horizont der Gewaltakteure wird dabei häufig zu einem Attribut der Gewalt selbst. So ist etwa von ‚linker Gewalt‘ und ‚rechter Gewalt‘ die Rede, die von ‚sezessionistischer Gewalt‘, ‚djihadistischer Gewalt‘ oder auch ‚ökoterroristischer Gewalt‘ unterschieden wird.
In der Regel dienen diese Formulierungen dazu, den Gegenstandsbereich einzugrenzen. Sie signalisieren, dass hier das (Gewalt-)Handeln jeweils bestimmter Bewegungen untersucht wird, die sich politisch spezifischen Ideologien oder Weltsichten zuordnen lassen. Gewalt gilt als ‚rechts‘, wenn sie von Rechtsextremist:innen verübt wird oder sich in den Horizont rechtsextremistischer Weltvorstellungen einordnen lässt, nicht weil unterstellt wird, die Dynamik der Gewalt selbst weise Merkmale auf, die sie eindeutig als dem rechtsextremen Spektrum zugehörig identifizieren. In der Regel verweisen die zitierten Attribute also auf den Horizont der Gewaltakteure; selten stehen dahinter starke gewalttheoretische Thesen über den spezifischen Charakter der Gewalt der genannten Gruppen.
Intuitiv ist diese semantische Übertragung vom politischen Projekt der Gewaltakteure auf die Gewalt selbst einleuchtend. Und gerade mit Blick auf rechte Militanz mag sie beinahe zwingend erscheinen. Angesichts der anhaltenden Zögerlichkeit von Politik und Behörden, Übergriffe beispielsweise auf Menschen mit Migrationsgeschichte in den Horizont rechtsextremer Weltvorstellungen einzuordnen, mag sich gerade die Wissenschaft aufgerufen fühlen, eine ‚klare Sprache‘ zu sprechen und die Dinge beim Namen zu nennen.
Doch bergen solche Formulierungen auch Risiken. Und zwar deshalb, weil sie die Forschung in einer Weise in gesellschaftliche und politische Diskurse verstricken, die die gesellschaftskritischen Absichten der Forschenden zu unterlaufen drohen.
Perspektiven der Neueren Gewaltsoziologie
Ein Forschungsfeld, das sich in den letzten fünfundzwanzig Jahren intensiv mit diesem Problem befasst hat, ist die Neuere Gewaltsoziologie. Die wachsende Bedeutung politischer Gewalt in Deutschland verleiht deren Überlegungen neue Aktualität. Denn sie wirft unter anderem die Frage auf, welche Rolle die Forschung in der Bearbeitung dieser gesellschaftlichen Probleme spielt, spielen kann und spielen sollte. Vor diesem Hintergrund werde ich im Folgenden die Relevanz der Überlegungen der Neueren Gewaltsoziologie zur Analyse politischer Gewalt diskutieren.
Das Forschungsfeld formierte sich in den 1990er Jahren und leitete eine paradigmatische Wende im interdisziplinären Feld der deutschsprachigen Gewaltforschung ein. Sie kritisierte die zentrale Stellung von politischen Zuschreibungen in der Gewaltanalyse und entwarf ein alternatives Forschungsprogramm, das gewaltaffizierte Kontexte im Horizont allgemeiner sozial- und gesellschaftstheoretischer Konzepte in den Blick nahm: es ging um Prozesse der Staatstransformation und gesellschaftlichen Wandel, um bewaffnete Gruppen als Organisationen und die Transformation von Subjektstrukturen.
Bereits zum Zeitpunkt der Formierung der Neueren Gewaltsoziologie war diese Positionierung in mancherlei Hinsicht eine Provokation. Vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse – die Ermordung von Walter Lübcke 2019, der Anschlag auf die Synagoge in Halle und einen ihr nahe gelegenen Imbiss im selben Jahr, der Mord an acht Menschen mit Migrationsgeschichte in einem Amoklauf in Hanau 2020 – mag sich dieser Eindruck der Provokation noch verstärken. Kommt die Einbettung menschenverachtender Akte der Zerstörung in allgemeine gesellschaftstheoretische Begriffe nicht einer Verharmlosung des Geschehens gleich? Wendet der Verzicht auf klare politische Attribuierung sich nicht in letzter Konsequenz gegen die Opfer? Oder zugespitzt formuliert: Spielt, wer ‚rechte Gewalt‘ nicht als solche bezeichnet, rechtsextremen Akteuren nicht in die Hände?
Doch nichts von dem hatten die Protagonist:innen der Neueren Gewaltsoziologie im Sinn. Ziel der Abkehr von der analytischen Orientierung an politischen Unterscheidungen war nicht die Entpolitisierung der Gewaltforschung, sondern – im Gegenteil – die Revitalisierung ihrer gesellschaftskritischen Potentiale. Denn mit der einfachen Übernahme griffiger Typologien verliert die Forschung Distanz zu ihren Gegenständen und riskiert die Verstrickung in Dynamiken der Tagespolitik. Aufklärerisch kann sie vor allem dann wirken, wenn sie Zusammenhänge herausarbeitet, die durch gängige Interpretationsschemata, etwa des politischen Betriebs, verdeckt werden.
Die paradigmatische Wende der Neueren Gewaltsoziologie
Worin genau besteht also nun die paradigmatische Wende der Neueren Gewaltsoziologie, die das Nachdenken über politische Gewalt radikal verändert? Im Zentrum der frühen Diskussionen des Forschungsfelds stand die Arbeit an einer Normalisierung von Gewalt als Forschungsgegenstand der Gesellschaftswissenschaften. Dies bedeutet keineswegs, dass die Forschung der Gewalt gleichgültig gegenüberstehen soll oder sie als im normativen Sinne ‚normal‘ beschreiben würde. Es geht vielmehr um die Neubestimmung des Ortes der Gewalt in der Sozial- und Gesellschaftstheorie sowie eine daran anschließende Diskussion um Forschungsmethoden, die dieser theoretischen Neuverortung gerecht werden.[1]
Während soziologische Theorien der modernen Gesellschaft Gewalt aus ihrem Horizont ausblenden und bestenfalls als Anomalie oder Krisenfall des Sozialen berücksichtigen, begreift die Neuere Gewaltsoziologie Gewalt als systematische Möglichkeit menschlichen Handelns, deren soziale Dynamiken im Horizont von allgemeinen Begriffen sozialer und gesellschaftlicher Ordnungsbildung rekonstruiert werden müssen. Denn Gewalt ist kein Problem bestimmter historischer oder kultureller Kontexte, sondern Teil der conditio humana. Menschen sind verletzbar, oder wie der Soziologe Heinrich Popitz schreibt: „verletzungsoffen“.[2] Wie sich angesichts der allgemein menschlichen Fähigkeit, verletzt werden zu können und andere zu verletzen, verbindliche Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders etablieren lassen, ist deshalb eine Frage, die sich immer und überall stellt. Zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten wurden unterschiedliche Antworten gefunden. Doch verschwindet damit das Problem nicht, sondern bleibt für Prozesse sozialer Ordnungsbildung konstitutiv.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen zur allgemeinen Relevanz von Gewalt in gesellschaftlichen Prozessen entwickelte die Neuere Gewaltsoziologie ein Forschungsprogramm, in dessen Zentrum die Rekonstruktion der Rolle von Gewalt in der Produktion, Reproduktion und Transformation sozialer Ordnung steht.
Die Gewaltblindheit der Sozial- und Gesellschaftstheorie
Ausgangspunkt dieser Überlegungen war eine scharfe und differenzierte Kritik am bisherigen Status von Gewalt in der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung: Während in der Gesellschaftstheorie Gewalt nur als Unfall des Sozialen vorkam, interessierten sich empirische Arbeiten, die unter dem Stichwort ‚Gewaltforschung‘ firmierten, weniger für die Gewalt selbst, sondern vor allem für deren Ursachen und Motive. Darüber hinaus war die empirische Beschäftigung mit Gewalt an Disziplinen ausgelagert, die als Expertinnen für das Anomische, das Problematische oder das Vergangene gelten: Kriminologie und Konfliktforschung, Kultur- und Sozialanthropologie sowie die Geschichtswissenschaft. In der Forschung zu gesellschaftlichen ‚Normalverhältnissen‘ wurde Gewalt systematisch ausgeblendet.
Diese Blindheit der Gesellschaftswissenschaften für die systematische Rolle der Gewalt in Prozessen sozialer Ordnungs(re)produktion war, so der Ausgangsbefund der Neueren Gewaltsoziologie, kein Zufall. Sie rührte von der Verstrickung der modernen Sozialwissenschaften in die Geschichte der Moderne selbst: In der Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft gilt die Abkehr von der Gewalt als ein entscheidendes Distinktionsmerkmal, das ‚moderne‘ von ‚vor-‘ oder auch ‚noch-nicht-modernen‘ Gesellschaften zu unterscheiden erlaubt.
Die im 19. Jahrhundert entstehenden Sozialwissenschaften übernahmen diese Selbstbeschreibung der Moderne als normativ gewaltavers und lebensweltlich gewaltarm in die unhinterfragten Grundannahmen der Disziplin. Denn sie verstanden sich als Wissenschaften für die moderne Gesellschaft, die mit ihren Erkenntnissen nicht nur beschreiben, sondern aktiv zum gesellschaftlichen Fortschritt beitragen wollten.
Gewalt als Störfall
Weil die Sozialwissenschaften also selbst aufs Engste in das Projekt der Moderne verstrickt waren, konzipierten sie Gewalt als ein Phänomen, das außerhalb gesellschaftlicher ‚Normalverhältnisse‘ situiert ist. Gewalt ist in dieser Perspektive immer ‚anderswo‘: in anderen Zeiten (Historisierung), in anderen Weltregionen (Spatialisierung) oder auch in den Tiefen von Psyche und Nervensystem (Pathologisierung). Die Verdrängung der Gewalt aus dem theoretischen Zentrum der gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen ist eine direkte Folge dieser modernistischen Perspektive. Wo die Gewalt nur als Stör- oder Rückfall gedacht werden kann, hat sie in allgemeinen Gesellschaftstheorien keinen Platz.[3]
Auch die Beschäftigung mit politischer Gewalt fand klassischerweise in Kategorien statt, die Gewalt als Ausnahmezustand rekonstruierten. Der Moderne gilt politische Gewalt als Störfall des gesellschaftlichen Normalbetriebs, dessen Bearbeitung – politisch wie wissenschaftlich – an Expert:innen für das Anomische übertragen wird. In der Forschung zu sogenannten westlichen Gesellschaften drückt sich dies beispielsweise darin aus, dass die Gewaltausübung staatlicher Institutionen in der Regel außerhalb des Definitionsbereichs des Begriffs ‚politische Gewalt‘ verortet wird.
Gewalt als Ordnungsproblem
Das Forschungsprogramm der Neueren Gewaltsoziologie zielte darauf, diese Konstellation grundsätzlich zu verändern. Die Rekonstruktion von Gewalt als Ordnungsproblem erlaubte dessen Einordnung in den Horizont allgemeiner Sozial- und Gesellschaftstheorien. Dezidiert fokussierte die Forschung die Rekonstruktion der sozialen und leiblichen Eigendynamik von Gewalt; der Untersuchung von Ursachen und Handlungsmotivationen wurde konzeptuell keine tragende Rolle zugewiesen. Methodologisch führte die Forderung, der Ordnung erzeugenden und transformierenden Eigenlogik der Gewalt auf die Spur zu kommen, zu einer Präferenz für qualitative Forschung, die an der Mikroperspektive ansetzt. Der Tradition qualitativer Sozialforschung folgend wurden Nähe zum Gegenstand und methodologische Empathie mit dem Feld Leitmotive der Forschung. Auf diese Weise wurde sowohl theoretisch als auch methodisch an einer Normalisierung von Gewalt als Forschungsgegenstand gearbeitet.
Im Kern kreisten die frühen Debatten der Neueren Gewaltsoziologie um sehr grundsätzliche (erkenntnis-)theoretische Fragen, die auf den ersten Blick fast pedantisch erscheinen mögen. Ist es wirklich wichtig, wie sich die Forschung mit Gewaltphänomenen beschäftigt? Ist nicht der eigentlich wichtige Punkt, dass sie dies überhaupt tut? Und warum sollte es problematisch sein, Gewalt als ‚Problem‘ zu betrachten, wenn man sich doch rasch wird darauf einigen können, dass anderen absichtlich Schmerzen zuzufügen keine grundsätzlich wünschenswerte Handlung darstellt?
Die realen Effekte der Theorie
Die Auseinandersetzungen in der Neueren Gewaltsoziologie wurden scharf geführt, weil die Beteiligten im Bewusstsein der realen Effekte gesellschaftswissenschaftlicher Wissensproduktion diskutierten. Denn modernistische Narrative, die Gewalt als ein Problem vormoderner Zeiten und noch-nicht-moderner Orte rekonstruierten, bilden die Grundlage politischer Diskurse und Praktiken weltweit.
Bis heute behindern beispielsweise temporalisierende Gewaltdiskurse die Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus, weil sie die Gewalt des NS-Regimes als ‚Zivilisationsbruch‘ und zeitweiligen ‚Rückfall‘ in frühere Zeiten rekonstruieren und die Relevanz von Vernichtungsgewalt als der Moderne systematisch eingeschriebene Möglichkeit verleugnen. Spatialisierende Gewaltdiskurse, die bestimmte Orte als ‚failed states‘ oder ‚Gewalträume‘ aus gesellschaftlichen Normalverhältnissen herausdefinieren, tragen zur Legitimation politischer Interventionen bei, die anderswo nicht zu rechtfertigen wären. Modernistische Vorstellungen führen auch dazu, dass die in modernen Gesellschaften systematisch und notwendig vom Staat ausgeübte Gewalt aus dem Blick gerät.[4]
Die zentrale Bedeutung von Beobachter:innen
Theoretisch-konzeptionell kamen diese realen Effekte modernistischer Gewaltdiskurse vor allem in Arbeiten in den Blick, die sich für die Legitimität der Gewalt interessierten. Diese arbeiteten heraus, dass Gewalt keineswegs ein empirisch evidentes Phänomen ist. Was als Gewalt gelten darf und soll, ist – auch im Alltag – immer wieder umstritten. Gewalt als soziales Phänomen beruht also nicht nur auf der Dynamik von Tat und Erleiden, sondern ist an Beobachtungsleistungen und Deutungen gebunden, in die unter anderem Urteile über die Intentionalität und die Legitimität des Verletzungshandelns eingehen. Letztere sind historisch wandelbar.
Triadische Ansätze, die das Beobachten als konstitutives drittes Element der sozialen Dynamik der Gewalt verstehen, unterstreichen also, dass der empirische Gehalt von als ‚Gewalt‘ bezeichneten Handlungsweisen nicht konstant ist, sondern historisch und kulturell kontingent.[5] Mit Blick auf Gewalt im Kontext von Politik ist diese theoretische Perspektive besonders relevant, weil sie zeigt, dass Gewalt nicht nur Mittel zur Durchsetzung bestimmter Ziele ist, sondern immer auch ein kommunikatives Geschehen, das komplexen gesellschaftlichen und historischen Bedingungen unterliegt.
In der Moderne hat die normative Gewaltaversion zu einer fortschreitenden Kodifizierung von Normen zum Schutz des menschlichen Lebens und der Integrität der Person geführt. Das hat die Gewalt nicht zum Verschwinden gebracht, doch haben sich die Bedingungen ihrer Ausübung verändert. Als Verstoß gegen universalistische Normen ist Gewalthandeln grundsätzlich kritisierbar geworden. Und die Kritik kann auch Akteure treffen, die sich (völker-)rechtlich zur Gewaltanwendung legitimiert sehen.
Unter den Bedingungen der Moderne gewinnt deshalb die öffentliche Wahrnehmung von Gewalt strategische Bedeutung. Nicht nur die Ausübung von Gewalt kann Vorteile bringen, sondern auch der inszenierte Gewaltverzicht, die Skandalisierung der Gewalt des Gegners oder die Verschleierung eigenen Gewalthandelns.[6] Aus Sicht der Akteure ist die Arbeit am framing der eigenen und der gegnerischen Handlungen also unter Umständen selbst Teil der Konfliktdynamik. Triadische Ansätze der Neueren Gewaltsoziologie sensibilisieren für das Verstrickungspotential, das sich daraus für die Forschung ergibt. Denn wissenschaftliche Theorien und Begriffe stellen Rahmungen (frames) bereit, die – weil moderne Wissenschaft öffentlich ist – auch ohne das Zutun der Forscher:innen in außerwissenschaftlichen Kontexten aufgegriffen werden können.
Politische Gewalt jenseits politischer Klassifikationen
Die Grundüberlegungen der Neueren Gewaltsoziologie lassen sich auf folgende Forderung engführen: Gesellschaftswissenschaftliche Gewaltforschung muss im Bewusstsein ihrer eigenen Verstrickungen in das politische Geschehen agieren. Dies gelingt durch Theorien und Methoden, die jeweils Distanz zu den Selbstbeschreibungen der Moderne herstellen. Damit lässt sich die Neuere Gewaltsoziologie als ein im engeren Sinne gesellschaftskritisches Projekt verstehen. Gesellschaftliche (Gewalt-)Verhältnisse werden in ihrem Gewordensein und ihrer Kontingenz rekonstruiert. Und bewusst wird analytische Distanz zur Gesellschaft hergestellt um innerhalb der Gesellschaft aufklärerisch wirken zu können.[7]
Als im engeren Sinne kritisches Forschungsprogramm verteidigt die Neuere Gewaltsoziologie die Eigenständigkeit akademischer Forschung. Diese besteht auch darin, sich mit selbstgestellten Problemen zu befassen und sich nicht voreilig Problemzuschnitte von Feldakteuren zu eigen zu machen.
Dabei spielte politische Gewalt von Anfang an eine zentrale Rolle im Forschungsprogramm der Neueren Gewaltsoziologie. Dem eben geschilderten kritischen Impuls folgend wurde dabei jedoch nach neuen analytischen Perspektiven gesucht. Bislang hatte die Forschung zum Thema der politischen Ausrichtung oder Einbettung der Gewalt eine analytische Schlüsselrolle zugewiesen. Sie unterschied beispielsweise zwischen ‚rechter‘ und ‚linker Gewalt‘. Die Neuere Gewaltsoziologie stellt diesen politischen Kategorisierungen ordnungstheoretisch informierte Analysen und Typologien entgegen. Diese analytische Perspektivverschiebung ist primär durch zwei Vorbehalte motiviert, die sich unmittelbar aus den axiomatischen Überlegungen des Forschungsfeldes ergeben:
Dies ist zum ersten die bereits erwähnte Skepsis der Neueren Gewaltsoziologie gegenüber einer allgemeinen explanatorischen Relevanz von Handlungsmotiven. Indem Motive ihre theoretische Schlüsselstellung verlieren, verändert sich auch die analytische Bedeutung politischer Motivationen. Empirische Analysen zeigen, „dass außerordentlich unterschiedliche Weltanschauungen (ebenso wie deren gänzliche Absenz) zu […] ähnlichen Resultaten führen können.“[8] Die systematische Analyse unterschiedlicher politischer Gewaltphänomene bedarf deshalb einer breiteren sozial- und gesellschaftstheoretischen Einbettung. Ob Akteure einen Angriff mit dem Ziel der Weltrevolution, des Gottesstaats, humanitärer Hilfe oder eines gereinigten Volkskörpers begründen, ist nicht mehr a priori von entscheidender Bedeutung. Im Zentrum steht stattdessen die Dynamik des Gewaltgeschehens selbst sowie dessen Relevanz in verschiedenen Ordnungsgefügen.
Ein zweiter Vorbehalt gegenüber einer primär an politischen Kategorien orientierten Gewaltanalyse ist durch die Bedeutung dieser Begrifflichkeiten in der politischen Praxis motiviert. Die Unterscheidung von ‚linker‘ und ‚rechter Gewalt‘ beispielsweise spielt nicht nur in politischen Auseinandersetzungen eine Rolle, sondern ist auch im Handeln von Sicherheitsbehörden kodifiziert. Deshalb können an politischen Kategorien orientierte Gewaltanalysen nur sehr bedingt Distanz zu gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen herstellen. Sie bleiben in besonderem Maße verstrickt in (tages-)politische und gesellschaftliche Diskurse. Innerhalb eines solchen begrifflichen Systems kann kein auch noch so authentisches Bemühen um wissenschaftliche Objektivität diese Verstrickung auflösen. Denn die (tages-)politisch und behördlich unmittelbar anschlussfähige begriffliche Rahmung macht die Vereinnahmung der Forschung gänzlich unabhängig von den Intentionen der Forschenden besonders leicht.
Die Relevanz des Politischen als empirische Frage
Diese Vorbehalte der Neueren Gewaltsoziologie gegenüber primär politischen Klassifizierungen in Analysen politischer Gewalt implizieren jedoch keinesfalls, dass die ideologische Ausrichtung von Gewaltakteuren oder die weltanschauliche Einbettung eines Gewaltgeschehens für belanglos erklärt würden.
Die Relevanz des Politischen wird nicht vernachlässigt oder negiert, sondern in eine empirische Frage verwandelt, die nur mit Blick auf ein konkretes Geschehen in einem konkreten Kontext beantwortet werden kann. Primär an der ordnungslogischen Eigendynamik der Gewalt interessierte empirische Analysen zeigen, dass für die soziale Dynamik politischer Gewalt zumeist die Funktionen ausschlaggebend sind, die sie innerhalb eines gegebenen Kontexts erfüllt, sowie die materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen, auf die dabei zurückgegriffen werden kann. Der leib- und ordnungstheoretisch orientierte Neuzuschnitt des Gegenstands lenkt den Blick auf die Einbettung politischer Gewalt in andere soziale Dynamiken und Prozesse und damit systematisch auch auf die Schnittstellen zwischen Gewaltforschung und anderen Forschungsfeldern.
Seit der Formierung der Neuere Gewaltsoziologie in den späten 1990er Jahren hat sich deren Beschäftigung mit politischer Gewalt in verschiedene Forschungsstränge ausdifferenziert: Zum einen entstand eine Vielzahl typologisch interessierter mikroperspektivischer Studien, die die Spezifik bestimmter Gewaltphänomene und -dynamiken (Folter, Massaker, Attentat etc.) herauszuarbeiten suchten. Als der US-amerikanische Emotionssoziologe Randall Collins gänzlich unabhängig von den Entwicklungen im deutschsprachigen Raum 2008 eine ebenfalls an Mikrodynamiken interessierte interaktionistische Gewalttheorie vorlegte,[9] erhielt diese Forschungsbewegung weitere Impulse mit dem Effekt, dass sich die situationistische Gewaltsoziologie als weitgehend eigenständiges Forschungsfeld formierte.[10]
Parallel zu diesen mikroperspektivisch-situationistisch fokussierten Studien entwickelte sich ein anderer Forschungsstrang, in dem Gewalt im Horizont größer skalierter Ordnungszusammenhänge untersucht wurde. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei zum einen der Rolle von Gewalt in Prozessen der Staatsbildung und Staatstransformation, zum anderen Organisationen, die zur Verfolgung ihre Ziele und Programme die (Re-)Produktion von Gewalt auf Dauer zu stellen hatten. In diesem zweiten Forschungsstrang wurden die programmatischen Vorschläge der Neueren Gewaltsoziologie mit verschiedenen anderen soziologischen Theorietraditionen zusammengeführt, beispielsweise mit der Weberianischen Herrschaftssoziologie,[11] der Luhmann’schen Organisationssoziologie[12] oder Bourdieus Soziologie von Habitus und Feld.[13] Andere Studien nahmen die Dynamik der Gewalt in institutionell weniger formalisierter Ordnungsgefüge in den Blick, etwa in den Ordnungen des Alltags,[14] in der Familie[15] oder der Geschlechterordnung.[16]
Ausblick
Wer angesichts des wachsenden Einflusses rechtsextremer Parteien und Szenen auf Politik und Alltag für eine Forschung eintreten will, die sich diesen Problemen stellt, dem mag die skrupulöse, auf methodologische und theoretische Disziplinierung zielende Positionierung der Neueren Gewaltsoziologie unbefriedigend erscheinen. Aus Sicht der Soziologin jedoch scheint es gerade dann geboten, dieses Forschungsprogramm in Erinnerung zu rufen. Denn auch die Neuere Gewaltsoziologie verstand sich als Intervention in damals drängende politische und gesellschaftliche Debatten.
Vor dem Hintergrund der unauflöslichen Verstrickungen wissenschaftlicher Wissensproduktion in gesellschaftliche Diskurse machte sie es sich zur Aufgabe, Wissen zu erzeugen, das blinde Flecken offenlegt und gesellschaftlich etablierte Vorstellungen irritiert. Um in diesem Sinne aufklärerisch wirken zu können, müssen politische und gesellschaftliche Diskurse mithilfe geeigneter Methoden und Theorien zunächst auf Distanz gebracht werden. Vor diesem Hintergrund kultivierte das Forschungsfeld eine Skepsis gegenüber der Verwendung von Begriffen, die im politischen Diskurs oder der politischen Praxis eine wichtige und kontroverse Rolle spielen – ganz gleich, ob sie von Behörden, Parteien oder Aktivist:innen im Munde geführt wurden. Ziel der Forschung ist es nicht, Begriffe (neu) zu definieren. Es geht darum, die soziale Dynamik politischer Gewalt zu verstehen, einschließlich deren Einbettung in andere soziale und gesellschaftliche Vollzüge.
Die Relevanz dieses Ansatzes im Kontext aktueller Debatten, besteht in seinem Beitrag zur Dekonstruktion gesellschaftlich entlastender Narrative, die Gewalt – dem Anomie-Diskurs folgend – als isoliertes Problem beschreiben, das bedauerlich ist, letztlich aber immer nur einige wenige (Täter:innen, Opfer, Sicherheitsbehörden) betrifft. Die Arbeit an der theoretischen und methodologischen Normalisierung stellt sich gegen solche Erzählungen. Indem politische – also auch rechte – Gewalt im Horizont allgemeiner ordnungs- und gesellschaftstheoretischer Begriffe erfasst wird, zeigt sich, dass dieses Thema alle betrifft.
[1] Hierzu und zum Folgenden vgl. grundlegend Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust. Cambridge 1989; wegweisend für die deutschsprachige Debatte Trutz von Trotha (Hg.), Soziologie der Gewalt. Opladen 1997; Jan Philipp Reemtsma, Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne, Hamburg 2008; für einen Überblick vgl. Teresa Koloma Beck, Welterzeugung. Gewaltsoziologie als kritische Gesellschaftstheorie, in: Zeitschrift für Theoretische Soziologie, 8/1 (2019), S. 12-23.
[2] Heinrich Popitz, Phänomene der Macht. Autorität. Herrschaft, Gewalt, Technik, Tübingen 1992, S.44.
[3] Vgl. Bauman, Modernity; Reemtsma, Vertrauen.
[4] Vgl. Teresa Koloma Beck, (Staats-)Gewalt und moderne Gesellschaft. Der Mythos vom Verschwinden der Gewalt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), 67/4 (2017), S. 16-21.
[5] Vgl. Reemtsma, Vertrauen; Teresa Koloma Beck, The Eye of the Beholder. Violence as a Social Process, in: International Journal of Conflict and Violence 5/2 (2011), S. 346-356.
[6] Vgl. Teresa Koloma Beck, Tobias Werron, Gewaltwettbewerbe. ‚Gewalt’ in globalen Konkurrenzen um Aufmerksamkeit und Legitimität, in: Stephan Stetter (Hg.), Ordnung und Wandel in der Weltpolitik. Konturen einer Soziologie der Internationalen Beziehungen, Baden-Baden 2013, S. 239-267; Dies., Violent Conflictition: Armed Conflicts and Global Competition for Attention and Legitimacy, in: International Journal of Politics, Culture, and Society 31/3 (2018), S. 275-296.
[7] Vgl. Max Horkheimer, Traditionelle und Kritische Theorie. Vier Aufsätze, Frankfurt/Main 1970.
[8] Jan Philipp Reemtsma, Was heißt „die Geschichte der RAF verstehen“?, in: Wolfgang Kraushaar, Karin Wieland, ders. (Hg.), Rudi Dutschke, Andreas Baader und die RAF. Hamburg 2005, S. 8.
[9] Vgl. Randall Collins, Violence. A Micro-Sociological Theory, Princeton 2008.
[10] Vgl. Thomas Hoebel, Stefan Malthaner (Hg.), Im Brennglas der Situation. Neue Ansätze in der Gewaltsoziologie, Hamburg 2019.
[11]Vgl. Klaus Schlichte, In the Shadow of Violence. The Micropolitics of Armed Groups, Frankfurt a. M. u.a. 2009.
[12] Vgl. Stefan Kühl, Ganz normale Organisationen. Zur Soziologie des Holocaust, Berlin 2014.
[13] Vgl. Daniel Bultmann, Inside Cambodian Insurgency. A Sociological Perspective on Civil Wars and Conflict, Farnham 2015.
[14] Vgl. Teresa Koloma Beck, Jenseits des Ausnahmezustands, in: Stephan Lessenich (Hg.), Routinen der Krise – Krise der Routinen. Verhandlungen des 37. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Trier 2014 o. O. 2015 , zuletzt: 21.6.2020; Dies., Krieg und Gewohnheit. Phänomenologische und Pragmatistische Perspektiven auf verkörpertes Gedächtnis in Bürgerkriegen, in: Michael Heinlein, Oliver Dimbath, Larissa Schindler, Peter Wehling (Hg.), Der Körper als soziales Gedächtnis. Wiesbaden 2016, S. 153-169.
[15] Vgl. Susanne Nef, Ringen um Bedeutung. Die Deutung häuslicher Gewalt als sozialer Prozess, Weinheim 2020.
[16] Vgl. Laura Wolters, Strafaffekte und Legitimitätsempfinden. Zur Frage von Motiven in der Gewaltforschung, in: Zeitschrift für Theoretische Soziologie 8/1 (2019), S. 38-49.
Zitation
Teresa Koloma Beck, ‚Rechte Gewalt‘?. Ein soziologischer Kommentar, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/rechte-gewalt