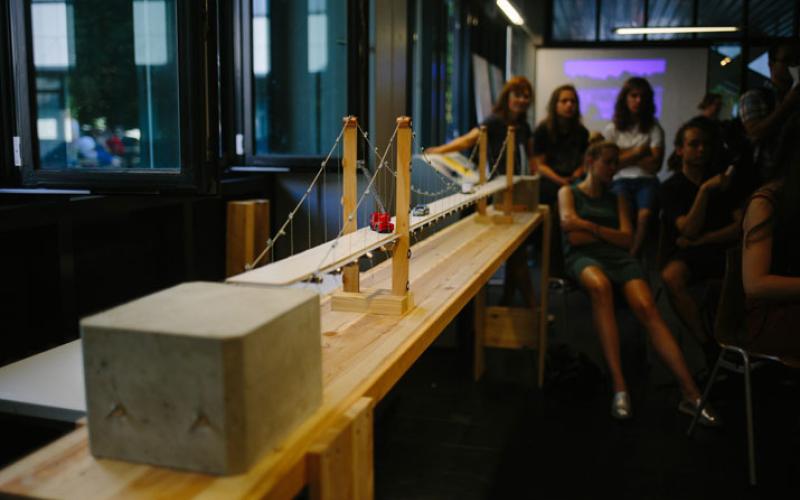Am 22. und 23. November 2019 ist das histocamp zum ersten Mal in Berlin. Das erste histocamp fand 2015 in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn statt. Danach folgten das histocamp 2016 in Mainz und 2017 in Darmstadt. Mit einem Schnupper-histocamp am 27. September 2018 war es letztes Jahr Teil des Sonderprogramms des 52. Deutschen Historikertags in Münster. Organisiert wird das histocamp durch Open History e.V., ein Verein für eine aktive und öffentliche Geschichtswissenschaft. Das Gründungsziel von Open History e.V. ist es, verschiedene Formen des Austauschs zwischen Wissenschaftler*innen und einer interessierten Öffentlichkeit zu fördern.
Als Medienpartnerin des diesjährigen histocamps hat zeitgeschichte|online mit Karoline Döring, Mitbegründerin und Vorsitzende von Open History e.V., gesprochen.
zeitgeschichte|online: Warum sollte ein*e Historiker*in das histocamp besuchen?
Döring: Historiker*innen sollten das histocamp besuchen, weil sie dort mit ganz unterschiedlichen Leuten aus vielen verschiedenen Berufsfeldern über vielfältige Geschichtsthemen ins Gespräch kommen können. Gerade für Historiker*innen, die an der Universität tätig sind und sich überwiegend in ihren eigenen engen Fachkreisen bewegen, ist das histocamp eine sehr schöne Erfahrung. Sie sehen, wie und wo überall Geschichte und Geschichtsarbeit außerhalb des eigenen gewohnten Erfahrungshorizonts stattfinden kann.
zeitgeschichte|online: Was macht das Format histocamp besonders? Wodurch genau unterscheidet es sich vom traditionellen Konferenzformat?
Döring: Das Format histocamp ist deswegen besonders, weil es ein Wagnis ist. Das Barcampformat ist in Form und Inhalt offen. Man weiß vorher nie, welche Leute kommen, welche Themen sie mitbringen und wie sie darüber sprechen werden. Erst in der Sessionplanung wird das inhaltliche Programm des histocamps von allen Teilnehmer*innen gemeinsam zusammengestellt. Wie dieses dann in den Sessions durchgeführt wird, ob als Praxisworkshop, als kurzes Impulsreferat mit Diskussion, als Gespräche im Stuhlkreis, mit aktivierenden Methoden oder ganz anders, bleibt den Sessiongeber*innen überlassen. Nur Frontalvorträge wollen wir nicht. Das kennen viele von den Konferenzen, die sie sonst besuchen. Zu denen soll das histocamp in der Form wie in der Durchführung ein ergänzendes Angebot sein.
Abgesehen von diesen Besonderheiten beim Veranstaltungsformat macht das histocamp aus, dass man als Teilnehmer*in herausgefordert wird. Man muss den „Barcamp-Spirit“ leben oder sich zumindest darauf einlassen. Dazu gehört die Bereitschaft auf Augenhöhe zu diskutieren und aktiv mitzumachen. Denn damit das histocamp einem „was bringt“ – und darum geht es ja oft bei Konferenzbesuchen –, muss man sich ziemlich anstrengen. Das histocamp wird nämlich von seinen Teilnehmer*innen gestaltet und erfordert deswegen ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative und Aktivität. Man kommt ja schon hin ohne zu wissen, welches Programm einen erwartet. Dann steht man in der Vorstellungsrunde auf und danach kennen alle Gesicht, Namen und eine Mini-Selbstbeschreibung. Es wird geduzt und in den Sessions ist man meist auch aufgefordert, sich irgendwie zu beteiligen. Praktisch nie kann man sich anonym im Hintergrund rumdrücken wie auf traditionellen Konferenzen, bei denen große Namen auf dem Programm stehen und sich die Teilnehmenden ansonsten wieder nur in den eigenen Kreisen kennen und bewegen. Hat man den Mut und die Lust dazu sich auf das ungewohnte Format ganz einzulassen, wird man Teil einer Veranstaltung, bei der man aktiv zu ihrem Gelingen beitragen kann und eben nicht nur passiver Gast eines Vortragsprogramms ist, das abläuft, egal ob man nun dabei ist oder nicht.
Das histocamp unterscheidet sich also in Form und Durchführung und vor allem im mindset sehr stark vom traditionellen Konferenzformat. Es ist hierarchiefrei, integrativ und gibt den Teilnehmer*innen viele Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist genauso ihre wie unsere Veranstaltung. Wir bieten den Rahmen, die Teilnehmer*innen schaffen das Bild.
zeitgeschichte|online: Welche (langfristigeren) Ziele verfolgt das histocamp, was sollen die Teilnehmer*innen am Ende mitnehmen?
Döring: Zu allererst sollen die Teilnehmer*innen mit einem guten Gefühl herausgehen. Das klingt esoterisch, ist aber ein wichtiges Ziel, aus dem sich weitere ableiten lassen. Sie sollen Spaß gehabt haben mit den Leuten und Themen, neue Ideen entwickelt, wertvolle Kontakte geknüpft, andere Denk- und Herangehensweisen kennengelernt, vielleicht sogar auch den Startschuss für ein neues Projekt gegeben haben. Sie sollen einfach eine gute, produktive Zeit gehabt haben. Denn ein Grund, warum wir das histocamp von Anfang an überhaupt veranstalten wollten, war, dass viele von uns von den konventionellen Konferenzen ermüdet waren. Meist werden dort Ergebnisse vorgelesen, über einen Forschungsstand informiert usw. Für gute, bereichernde Gespräche ist meist wenig Platz, höchstens in der Kaffeepause. Beim Barcamp ist die Kaffeepause und das gute Gespräch praktisch zum Prinzip erhoben. Das Ziel ist eben nicht ein sofort verwertbares Ergebnis in einen Tagungsband zu gießen, sondern die Zusammenarbeit, aus der sich manchmal noch gar nicht so recht absehen lässt, wohin sie führen wird.
zeitgeschichte|online: Inwiefern trägt das zur Zukunft der Zunft bei?
Döring: Ich hoffe, dass sich Barcamps als ergänzendes Veranstaltungsformat auch im Wissenschaftsbetrieb durchsetzen. Mittlerweile laufen ja auch Workshops nach dem traditionellen Konferenzmuster mit seinen Hierarchien und vorgelesenen Vorträgen ab. Die Ergebnispräsentation des eigenen Arbeitens und nicht das gemeinsame Arbeiten oder work in progress stehen im Vordergrund. Da wünsche ich mir einen Ort, wo das wieder möglich wird, und ich denke, Barcamps wären dieser Ort. Ich glaube auch, dass die Zukunft wissenschaftlicher Veranstaltungen in diese Richtung geht. Das histocamp ist das erste Mal ausverkauft und das in kürzester Zeit. Das Archivcamp und das Camp Colonia sind zwei weitere Barcamps, die mittlerweile regelmäßiger stattfinden und ich organisiere mit einer Kollegin und zwei Kollegen eine Tagung im März 2020 zu „Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken digitaler Geschichtswissenschaften“, die ein Barcamp im Anschluss an das Vortragsprogramm vorsieht. Der Vorschlag dazu kam von meinem Kollegen und nicht, wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre, von mir.
zeitgeschichte|online: Das histocamp wird nun zum vierten Mal veranstaltet. Was waren vergangene Herausforderungen, wo gab es Nachbesserungsbedarf?
Döring: Wir bessern nach jedem histocamp nach. Meist im Frühjahr ziehen wir uns dafür für ein Wochenende zurück, um über das vergangene histocamp zu sprechen und die Organisation für das anstehende vorzubereiten. Dazu eingeladen ist das aktuelle Organisationsteam, aber auch alle, die sich für eine Mitarbeit interessieren. Als Grundlage für die Nachbesprechung dienen uns die individuellen Erfahrungen des Teams und auch lessons learned, die wir schon im Verlauf der Organisation aufschreiben und diskutieren.
Eine große Herausforderung ist jedes Mal genügend ehrenamtliche Organisator*innen zu finden, die bereit sind, verbindlich einen Großteil ihrer wertvollen Zeit in unsere gemeinsame Veranstaltung zu investieren. Wir beobachten seit Jahren, dass sich zwar jedes Mal aufs Neue viele Leute begeistern und auch zunächst sagen, dass sie mitmachen wollen. Trotzdem steigen dann, wenn die Organisation tatsächlich anläuft, manche gar nicht erst ein oder mittendrin wieder aus. Die Gründe sind natürlich oft sehr nachvollziehbar. Aber eine so große Veranstaltung, die so viel Vorlauf benötigt, braucht verbindliches Engagement. Wir arbeiten mit einem Modell, dass Ressorts für einzelne Bereiche wie Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter vorsieht. Die Koordination der Aufgaben übernehmen die Ressortleitungen. Sie und der Vorstand springen natürlich auch immer zuletzt ein, wenn Arbeiten liegen bleiben. Immer wieder versuchen wir die Aufgaben und Workflows neu- und umzuorganisieren, um sie gut auf alle Schultern zu verteilen und Ausfälle besser kompensieren zu können. 2018 fand dann aber tatsächlich kein reguläres histocamp statt, sondern das kleinere „schnupperhistocamp“, das organisatorisch weitgehend am Historikertag hing. Obwohl uns unsere Veranstaltungspartner*innen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Schader-Stiftung sehr bei der Organisation unterstützt haben, haben wir 2018 einfach eine Pause gebraucht. Ich war sehr dagegen damals und sah das histocamp sterben. Zum Glück hatte ich unrecht! Und wenn ich mir ansehe, wie gut die Organisation dieses Jahr klappt, bin ich mittlerweile sehr für diesen Zwei-Jahresrhythmus. Nun sind wieder alle im Team dabei und es kamen sogar noch neue engagierte Mitstreiter*innen dazu.
Zuletzt haben wir den vierköpfigen Vorstand um zwei Mitglieder erweitert, um die Last der Vorstandsaufgaben und eben auch die Projektarbeit besser verteilen zu können, denn mit GeschichtsCheck haben wir begonnen auch andere Vereinsprojekte aufzubauen. Und die brauchen ebenfalls Zeit, Leute und commitment.
Eine weitere Herausforderung ist die Kommunikation. In meinem Verein im Studierendenwohnheim, der jedes Jahr ein Theater- und Musikfestival mit 10.000 Besucher*innen organisiert, hat sich unser Organisationsteam regelmäßig getroffen, in den letzten beiden Monaten vor Termin wöchentlich und wir sind uns allein beim Mittagessen und in der Kneipe abends ständig über den Weg gelaufen. Als dezentraler Verein müssen wir virtuell zusammensitzen, was wir über den Messaging-Dienst Slack oder am Telefon tun. Das bringt einige Probleme mit sich bringt, denn obwohl Slack ein Chat, also schriftlich ist, sind Absprachen nicht immer klar genug und am Telefon mit acht bis zehn Leuten gleichzeitig produktiv zu sprechen, ist auch nicht leicht. Im Slack ufern Diskussionen manchmal aus und es kostet viel Zeit wieder zur ursprünglichen Linie zurück zu finden. Manchmal gibt es auch Missverständnisse oder wir warten bei Entscheidungen viel zu lange aufeinander beziehungsweise schreiben dann wieder viel zu schnell und zu durcheinander. Weil asynchron kommuniziert wird, muss man sehr diszipliniert und eindeutig kommunizieren, um mit diesem Tool eine Veranstaltung zu organisieren. Ich übe das bis heute und scheitere auch immer wieder.
zeitgeschichte|online: Was waren vergangene Highlights des histocamps?
Döring: Meine schönste persönliche Erinnerung ist, dass ich 2017 mit meinem kleinen Baby im Tragetuch auf der Bühne das histocamp eröffnet habe. Es hat sich völlig normal und selbstverständlich angefühlt, dass das Baby dabei war. Möglich gemacht hat dieses Gefühl unser Team. Zu jeder Zeit hatte und habe ich das Gefühl, dass ich auch mit Kleinkind und Baby dazugehöre. Bei anderen Veranstaltungen hätte ich eher das Gefühl, dass ich störe.
Sehr schön und echte Highlights sind, so finde ich, auch immer unsere Aktionen. Sie machen Spaß, sind aber auch kritisch oder erkenntnisreich. 2017 haben wir auf Twitter darum gebeten, dass alle für die Vorstellungsrunde ihr historisches Lieblingsding, ein #histodings fotografieren und kurz beschreiben. Wir haben die Fotos ausgedruckt und aufgehängt.
In der Vorstellungsrunde haben alle erzählen dürfen, was sie mit ihren histodingsen verbinden. Da war vom DDR-Zuckerstreuer aus Plastik über wertvollen, Familienschmuck und dicke Geschichtslexika alles mögliche Sehenswerte dabei. 2018 haben wir beim schnupperhistocamp Kondome mit dem Aufdruck „Wissenschaftlichen Nachwuchs verhüten“ verteilt und einen kritischen Artikel, der die Aktionen erklärt, gepostet. Wir wollten über die Risiken aufklären, die durch ungeschützten Promotionsverkehr entstehen.
zeitgeschichte|online: Worauf freust du dich dieses Jahr am meisten?
Döring: Wie jedes Jahr freue ich mich sehr darauf unser Team wiederzusehen und ich bin sehr gespannt auf die Themen, die dieses Jahr angeboten werden. Ich komme wieder mit Baby, meinem zweiten Kind, und werde hoffentlich wieder die #histobaby Session anbieten können, vielleicht auch noch eine zum wissenschaftlichen Schreiben.
zeitgeschichte|online: Was würdest du histocamp-Newbies – wir sind dieses Jahr das erste Mal dabei – für die Vorbereitung auf das histocamp empfehlen?
Döring: Wenn Ihr ganz ins kalte Wasser springen und alles mitnehmen wollt, dann überlegt euch doch ein Thema und schlagt bei der Sessionplanung eine Session vor. Das ist ja wirklich sehr anders als schriftlich ein Abstract für einen wissenschaftliche Tagung einzureichen.
zeitgeschichte|online: Seit wann bist du dabei, und was bedeutet das histocamp für dich?
Döring: Ich bin von Anfang an, das heißt seit 2015 durchgehend bis auf zwei kleine Pausen für meine Kinder dabei. Auf meinen eigentlich spöttisch gemeinten Tweet zum StARTcamp in München 2015, dass ich das Format einmal mit Historiker*innen ausprobieren möchte, haben wir zusammen das histocamp auf die Beine gestellt und den Verein Open History e. V. gegründet, dessen Vorsitzende ich seitdem bin. Ich hab das damals eigentlich gar nicht ernst gemeint. Mir gefiel das StARTcamp sehr. Es war so ganz anders als die Konferenzen, auf denen ich bisher war. Mir hat die Vorstellung gefallen, dass die Historiker*innen beim Gedanken daran, dass sie ihre Ärmelschonersakkos nicht anziehen und ihre Vorträge nicht vorlesen konnten, bestimmt ganz verrückt werden würden.
Das histocamp bedeutet für mich, dass ich zusammen mit anderen Begeisterten, besonders unserem Team, Geschichte über Fach- und Disziplinengrenzen, Berufsfelder und Tätigkeitsbereiche usw. hinweg (möglich) machen kann. Das unterscheidet es sich für mich in der Bedeutung wahrscheinlich nicht zu sehr wie in der für andere Teilnehmer*innen. Das histocamp zu organisieren hat aber auf mich persönlich viel mehr gewirkt, als ich es mir 2015 vorgestellt hatte. Ich habe die universitäre Wissenschaft nie als den einzigen Bereich gesehen, in dem Geschichtsarbeit stattfindet, mich selbst aber schon immer beruflich dorthin orientiert. Alle Erfahrungen, die ich in den letzten fünf Jahren als Organisatorin und Teilnehmerin des histocamps und als Vereinsvorsitzende gemacht habe, haben mich darin bestärkt, die universitäre Wissenschaft nicht mehr als den einzigen Weg für mein Lebensglück zu sehen. Ich bin zwar aktuell noch in einem Projekt an der Universität beschäftigt, habe mich aber mit zwei Kindern und Haus auf dem Land in der Nähe von München festgelegt, was meine berufliche Perspektive angeht. Teil dieses Reflexionsprozesses war das histocamp.
Zitation
Karoline Döring, Eine Unkonferenz auf Augenhöhe. Ein Interview mit Karoline Döring, Organisatorin des histocamps, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/eine-unkonferenz-auf-augenhoehe