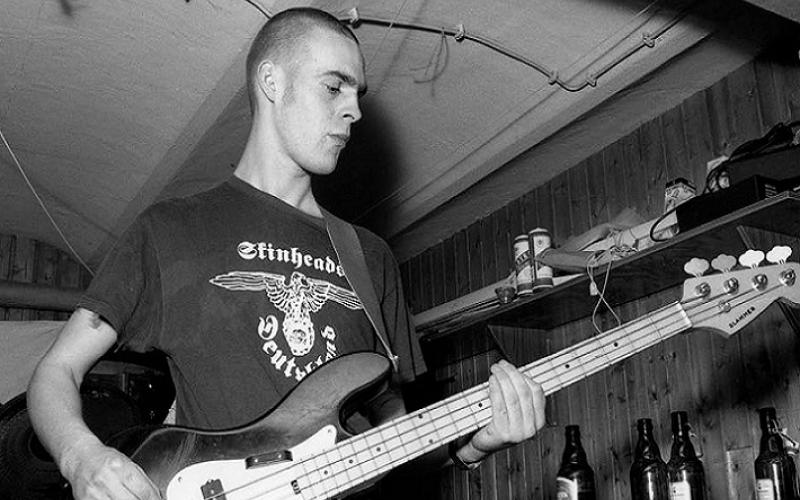Die deutsche Zeitgeschichtsschreibung hat den Ruf, sich über Jahre hinweg nicht ernsthaft mit der extremen Rechten in der Bundesrepublik und der DDR beschäftigt zu haben, während Studien zur Geschichte des Nationalsozialismus ganze Bibliotheken füllen. Der zu früh verstorbene Zeithistoriker Axel Schildt bekundete, dass „die Geschichtswissenschaft bisher sehr wenig zur Analyse rechtsextremer Bewegungen nach 1945 beigetragen“ habe.[1] Doch stimmt dieser Befund in seiner Pauschalisierung überhaupt?
Tatsächlich ist die zeithistorische Beschäftigung mit der extremen Rechten nach 1945 so alt wie die extreme Rechte selbst. Allerdings ist das Phänomen „Rechtsextremismus“ bisher nicht als „Normalfall“ in die Forschung integriert worden, wie der Politikwissenschaftler Gideon Botsch feststellt. Im Angesicht der AfD-Erfolge, die durch eine gestiegene Zahl rassistischer und extrem rechter Gewalttaten begleitet werden, steht die Zeitgeschichte – wiederholt – vor einer großen Herausforderung: Sie hat die Aufgabe, gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen in ihrer geschichtlichen Dimension greifbar zu machen.
In der Tat ziehen Historiker*innen in den gegenwärtigen Debatten um das Erstarken der AfD zwar Vergleiche zu den 1920er und 1930er Jahren, leisten dabei jedoch zu selten eine Verortung der Partei in der Geschichte der extremen Rechten in der Bundesrepublik und der DDR. Der Zeithistoriker Paul Nolte beispielsweise machte mit Blick auf die von Wahlsieg zu Wahlsieg eilende AfD 2016 im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung „eine quasi-revolutionäre Unruhe“ aus, die ihn an die „frühen 30er-Jahre“ erinnere. In seinem „Appell an die Vernunft“ fragte zuletzt der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) Andreas Wirsching, ob wir es bereits mit „Weimarer Verhältnisse[n]“ zu tun hätten.
Es soll hier gezeigt werden, dass es immer wieder Versuche einer zeithistorisch informierten Rechtsextremismusforschung gab. Diese Versuche kamen aber zunächst nicht unbedingt aus dem Zentrum der (west-)deutschen Zeitgeschichtsforschung. Sie setzten bereits in den Gründungsjahren der Bundesrepublik ein und stellten die damals drängende Gegenwartsfrage nach der Gefahr einer „Restauration“ oder „Renazifizierung“. Nach dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP) 1952 tauchte in den 1960er Jahren mit dem Aufstieg der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) erneut eine „nationale Opposition“ auf, auf deren Erstarken die Zeitgeschichte Antworten in der Weimar-Forschung suchte. Eine Zäsur aus heutiger Sicht stellt sicherlich der Niedergang der DDR 1989/90 dar, wird eine Geschichte des „Rechtsextremismus“ doch stets an dieser Wegmarke gemessen. Doch der Reihe nach.
Forschung am Rande
Anregungen für eine zeithistorisch informierte Beschäftigung mit der extremen Rechten nach 1945 kamen zunächst nicht aus dem akademischen Betrieb der Bundesrepublik, sondern von seinen Rändern oder von emigrierten Wissenschaftler*innen: Heute fast vergessen sind die beiden dickleibigen Bände Beyond Eagle and Swastika (1967) des Politologen Kurt Philip Tauber, der 1922 in Wien geboren wurde und 1939 in die USA emigriert war. Tauber nahm als Captain der US Air Force am Zweiten Weltkrieg teil. An der Harvard University studierte er, hatte später eine Professur am Williams College in Massachusetts inne. In seinem Buch fragte Tauber danach, „wie tot der antidemokratische Nationalismus“ im Jahr 1967 war, nicht danach, als wie „lebendig die Demokratie“ angesehen werden konnte. Also sezierte er den radikalen Nationalismus in Westdeutschland zwischen 1945 und 1964. Tauber warnte schon damals davor, das rechte Spektrum unter dem Begriff des „Neonazismus“ zu subsumieren, denn dies werde der Breite dieses radikalen Nationalismus nicht gerecht. Er widersprach der zeitgenössischen pessimistischen Annahme einer Renazifizierung, die in den frühen 1950er Jahren vor allem von Linken und Linksliberalen geäußert wurde. Zwar habe in verschiedenen Teilen des gesellschaftlichen Lebens ein „civis germanicus harzburgiensis“ überdauert, dies führe aber eher zu der Gefahr einer „Restauration“ unter demokratischen Vorzeichen.[2]
Die von Tauber 1967 beantwortete Frage, ob die Bundesrepublik in den 1950er Jahren eine Renazifizierung oder doch eher eine Restauration durchgemacht habe, stellte man sich in der bundesdeutschen Zeitgeschichtsforschung eher nicht. Die nach dem Zusammenbruch 1945 etablierte Disziplin der Zeitgeschichte entwickelte sich grundlegend anders als die sozial- und politikwissenschaftlichen Nachbardisziplinen. Ein personeller Bruch im akademischen Betrieb der Geschichtswissenschaft blieb aus. Während für Politologie und Soziologie gerade die Bedeutung der zumeist aus den USA zurückkehrenden Emigrantinnen und Emigranten immer wieder betont wurden, blieben die Impulse für die Zeitgeschichte offenbar begrenzt.
Das wirkte sich auf Ausrichtung und Themen aus und bestimmte lange den Selbstverständigungsprozess der Historiker*innen. Die Zeitgeschichtsforschung nahm zumindest bis in die 1960er Jahre eine Defensivposition ein, indem sie das NS-Regime zwar als totalitären Staat sezierte, sich aber gleichsam nicht von ihrem eigenen autoritären Staatsverständnis lösen konnte. Schließlich diente die Zeitgeschichte, um mit der Zeithistorikerin Gabriele Metzler zu sprechen, als „Stabilisierungswissenschaft“, die die zweite republikanische Demokratie stützte. Befasste sich die Soziologie gerade mit den Legitimationsdefiziten des demokratischen Staates, lehnte man in der Zeitgeschichte derlei Perspektiven weitgehend ab.[3] Ein Blick auf das in München ansässige Institut für Zeitgeschichte IfZ untermauert diesen Eindruck: Zwar bezog die im Institut geleistete Forschungsarbeit bereits ab Anfang der 1950er Jahre die Zeit vor 1933 und nach 1945 mit ein, doch konzentrierte sich die große Mehrheit der über 9000 vom IfZ für Gerichte und Behörden angefertigten wissenschaftlichen Gutachten lange auf die Zeit des Nationalsozialismus und übernahm hier eine Position als „Pionier“ der NS-Forschung.
Mit der extremen Rechten kamen westdeutsche Zeithistoriker (weniger Zeithistorikerinnen) zunächst vor allem bei der Abwehr der Leugnung und Revision der deutschen Kriegsschuld und der nationalsozialistischen Verbrechen in Berührung. Das Buch Der erzwungene Krieg (1961) des US-amerikanischen Historikers David L. Hoggans ist nur eines der prominenteren Beispiele für die Geschichte des Geschichtsrevisionismus in der Bundesrepublik. Erschienen im extrem rechten Verlag der Deutschen Hochschullehrer-Zeitung, dem späteren Grabert Verlag, konnte sich das Buch des Beifalls der extremen Rechten gewiss sein, rief aber auch massive Kritik vonseiten der Geschichtswissenschaft hervor. Bedeutende Historiker wie Hermann Graml, Wolfgang Schieder und Gotthard Jasper haben sich gegen das Werk Hoggans‘ gewandt. Mit der Forschung von Tauber hatte dies allerdings wenig gemein.
Vom Weimar-Komplex zur Erforschung der extremen Rechten
Das Erstarken der erst 1964 gegründeten NPD und ihr Einzug in sieben Landesparlamente zwischen 1966 und 1968 ließ die Zeithistoriker*innen zwar nicht eine Wiederholung der Geschichte fürchten, rief jedoch gegenwartsbezogene Vergleichsperspektiven auf den Plan. Gotthard Jasper, Historiker und Politologe, hob in einem von ihm 1968 herausgegebenen Sammelband über die Endphase der Weimarer Republik die „bestürzende[n] Parallelen zwischen Bonn und Weimar“ hervor, die sich angesichts der Wahlerfolge der NPD gezeigt hätten.[4] Der historisch arbeitende Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer warnte in der Studie Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik (zuerst 1962) vor dem „erneuten Einbruch des Irrationalen in unser politisches Denken“. Die 1968 publizierte Studienausgabe seines Buchs über „[d]ie politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933“ – so der Untertitel – wurde nicht von ungefähr durch ein Kapitel über „Antidemokratisches Denken in der Bundesrepublik“ ergänzt. Darin beschrieb er „[d]ie NPD als ‚Ausgeburt‘ der bundesrepublikanischen Verhältnisse“. Sie sei „Fleisch vom Fleisch der Bundesrepublik, kein Fremdkörper“, so Sontheimer. Bereits vier Jahre zuvor hatte der Zeithistoriker Karl Dietrich Bracher in seiner Studie über die „Katastrophe“ des Nationalsozialismus vor einem Erstarken des „Rechtsradikalismus“ gewarnt. Bracher wollte seine historiographischen Einlassungen als tagespolitische Interventionen verstanden wissen und betonte unter dem Eindruck einer Welle antisemitischer Propagandadelikte im Winter 1959/60 die „Dringlichkeit einer wissenschaftlichen Zeitgeschichte“. Zwar verfügte die Nachkriegsgesellschaft, so Bracher, „jetzt über Erfahrungen, die jedenfalls einer Wiederholung der Katastrophe von 1933 entgegenstehen sollten“. Zwar war „Bonn nicht Weimar“[5], doch blieben dem Zeithistoriker Bedenken und Zweifel an der Festigkeit der demokratischen Institutionen.[6]
Der damals unbekannte Historiker Lutz Niethammer argumentierte in seiner 1969 erschienenen Studie Angepaßter Faschismus, dass die NPD (wie bereits ihre Vorgängerin, die Deutsche Reichspartei [DRP]) einen integral ausgerichteten „organisierten Nationalismus“ repräsentiere. Die Partei sei nicht als das rechtsextreme Andere zu verstehen, sondern müsse in ihrer „faschistische[n] Grundstruktur“ und der Wechselwirkung mit „der Funktion der Partei in der Gesellschaft“ der damaligen Bundesrepublik ergründet werden. So sah Niethammer den „Nährboden einer den bundesrepublikanischen Voraussetzungen angepassten faschistischen Organisation“ nicht in erster Linie in etwaigen Kontinuitäten, sondern gerade in den Strukturveränderungen der postnationalsozialistischen Nachkriegsgesellschaft, in der die Immobilität bestimmter Schichten mit einem befürchteten Prestigeverlust einhergehe. Hier zeige sich die Bündnisfähigkeit dieses „angepaßten Faschismus“, der sich zwar als Modernisierungsopfer geriere, mit der „Parole ‚Leistung, Ordnung, Sicherheit‘“ aber ausgerechnet in den Technokraten seine Verbündeten finden könne. Dabei knüpfte Niethammer vor allem an Taubers bereits genannte Arbeit an.[7]
Bei der Bundestagswahl 1969 verpasste die NPD mit 4,3 Prozent der Wählerstimmen den Einzug ins Parlament. Die Bundesrepublik habe sich, wie Konrad H. Jarausch viel später ausdrückte, „als wetterfest gegenüber rechtsradikalen Bestrebungen“ erwiesen.[8] Die extreme Rechte fragmentierte, isolierte und radikalisierte sich zusehends. Die folgende Radikalisierung beispielsweise in den Wehrsportgruppen mündete Anfang der 1980er Jahre in einer seit 1945 beispiellosen Gewaltwelle, deren Höhepunkt das Attentat auf Besucher des Münchner Oktoberfests im Jahr 1980 war, bei dem zwölf Menschen ums Leben kamen.
Die sich bis dahin als geschichtswissenschaftliche Teildisziplin etablierte Zeitgeschichtsforschung – 1984 beinhalteten immerhin 31 Lehrstühle die Denomination „Zeitgeschichte“ oder „Neueste Geschichte“ – nahm diese gegenwartsnahen gesellschaftlichen Entwicklungen nicht zur Kenntnis.
Disziplinäre Arbeitsteilung
Die sozial- und politikwissenschaftliche, auch erziehungswissenschaftliche Beschäftigung mit dem Phänomen, die uns heute als „Rechtsextremismusforschung“ geläufig ist, beginnt in diesen Jahren und ist verknüpft unter anderen mit den Namen Peter Dudek, Hans-Gerd Jaschke und Richard Stöss. Die ereignisgeschichtlichen Betrachtungen dieser „frühen“ Rechtsextremismusforschung konzentrieren sich meist auf die parteiförmige extreme Rechte oder andere rechte Organisationen. Sie bemühen sich um Periodisierungen des Phänomens, vernachlässigen jedoch die Zäsuren. Insbesondere die mehrfach erweiterten Phasenmodelle des verdienten Parteienforschers Stöss werden bis heute immer wieder herangezogen. Schon 1983 beklagte Jaschke die „Ahistorizität“ der damaligen Rechtsextremismus-Debatte, fehle doch eine „Ereignisgeschichte des Rechtsextremismus nach 1945“.[9]
Hier verfestigte sich die disziplinäre „Arbeitsteilung“, in der die Zeitgeschichte lange die Epochen der Zwischenkriegszeit und des Nationalsozialismus bearbeitete, während sich Soziologie und Politologie dem zeitgenössischen „Rechtsextremismus“ widmeten. Die Zeitgeschichtsforschung entdeckte die Alltagsgeschichte. Man stellte Fragen an die soziale Praxis der NS-Gesellschaft und nur von diesem Standpunkt schließlich auch an das Nachkriegsdeutschland. Die NS-Täterforschung entstand gerade erst – 1992 wurde Christopher Brownings Ganz normale Männer veröffentlicht.[10] Lediglich Frank Bajohr und Detlev J. K. Peukert stellten sich in zwei 1990 erschienenen Essays der „Herausforderung für Historiker“[11] durch die extreme Rechte.
Umbruch 1989
„1989“ war eine Überraschung – auch für die westdeutsche Zeitgeschichtsforschung. Man erklärte die „Wiedervereinigung“ als Ende eines deutschen „postnationalen Sonderweg[s]“ (Heinrich August Winkler). Nach einem „langen Weg nach Westen“, so der Titel der von Heinrich August Winkler verfassten „Deutsche[n] Geschichte“, galt die Bundesrepublik als erfolgreich „im Westen angekommen“ (Axel Schildt). Die Zeitgeschichte erklärte die Stabilisierung der westdeutschen Demokratie als Teil einer transatlantischen „Westernisierung“ (Anselm Doering-Manteuffel), als Prozess einer „Liberalisierung“ (Ulrich Herbert) oder einfach als „Modernisierung“ (Axel Schildt et al.). Restrospektiv erklärte man auch die noch vom Zeitgenossen Kurt P. Tauber konstatierte „Restauration“ in den 1950er Jahren als obsolet, weil die Integrationspolitik der Adenauer-Ära alternativlos gewesen sei. Die demokratischen „Geburtsfehler“ der Bundesrepublik fanden wenig Beachtung.
Anstatt nun eine Historisierung jener demokratischen Defizite zu beginnen, entwickelte nach 1990 die neue DDR-Forschung eine unglaubliche Produktivität. Der Politikwissenschaftler und Zeithistoriker Hans-Peter Schwarz hat die DDR-Forschung daher einmal treffend als das „Bonanza historiographischer Zeitgeschichtsforschung“[12] bezeichnet. „Rechtsextremismus“ kam lange nur als „Überbleibsel“ des DDR-Autoritarismus oder als Folge der Transformationsphase vor. Bis heute jedoch sind die antikommunistischen Untergrund-Aktivitäten in der frühen DDR ebenso wenig einer gründlichen Studie unterzogen wie die grenzüberschreitenden Verbindungen der Neonaziszene(n) der 1980er Jahre.
Impulse für eine zeithistorische Rechtsextremismusforschung kommen immerhin vom Zeithistorikern Patrice G. Poutrus, die sich aus der Perspektive der Migrationsgeschichte mit Rassismus und Fremdheitserfahrungen in dem „zweiten deutschen Staat“ auseinandersetzen und eine aus den spezifischen Entwicklung im „Osten“ resultierende Konservierung extrem rechter Einstellungen konstatieren. Die Ursachen des Erstarkens des Neonazismus und der rassistischen Gewalt in den Neuen Bundesländern nach 1990 könnten nicht in der Transformationsphase nach dem Zusammenbruch der DDR gesucht werden; stattdessen sei es lediglich „zur Steigerung eines bereits vorhandenen gesellschaftlichen Spannungszustandes“ gekommen, dessen Ursachen in den Vorurteilsstrukturen der DDR-Bevölkerung zu finden seien.[13] Tatsächlich müssen künftige Untersuchungen dieses Aufeinandertreffen von rassistischer Prädisposition und eruptiver Gewalt in der Nachwendezeit aufzeigen.
Aktuelle Entwicklungen
Was können wir nun mit dieser – zugegebenermaßen unvollständigen – Bestandsaufnahme anfangen? Meine Darstellung plädiert dafür, sich auf die vielfach vorhandenen zeithistorischen Ansätze zu besinnen und sie für die Rechtsextremismusforschung nutzbar zu machen. So könnte die Stärke einer zeithistorischen Rechtsextremismusforschung also in einer Perspektiverweiterung bestehen, die die historische Entwicklung der extremen Rechten nicht als eine Nachgeschichte des Nationalsozialismus begreift, sondern als Vorgeschichte der Gegenwart. Vielmehr mögen historiographisch geleitete Zugänge dabei helfen, die extreme Rechte zu verorten und mit gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen in Beziehung zu setzen. Dabei sei, so der Historiker Wolfgang Benz, „[b]ei der Betrachtung des Problems ‚Rechtsextremismus in der Mitte‘ die historische Perspektive als analytisches Hilfsmittel unerlässlich“.[14] Benz befasst sich bereits seit den 1980er Jahren immer wieder mit der extremen Rechten. Sein Vorschlag die zeithistorische Dimension bei der Betrachtung des aktuellen Erstarkens der extremen Rechten zu berücksichtigen, wird erst jüngst vermehrt aufgegriffen.
Tatsächlich haben sich zuletzt sowohl Volker Weiß (Die autoritäre Revolte, 2017) als auch Michael Wildt (Volk, Volksgemeinschaft, AfD, 2017) mit der AfD und den historisch gewachsenen Konstruktionen von „Abendland“ und „Volk“ befasst, während Andreas Wirsching et al. (Weimarer Verhältnisse?, 2018) nach Parallelen zur antidemokratischen Strukturen in der Weimarer Republik fragt.[15] Norbert Frei et al. (Zur rechten Zeit, 2019) haben unter dem Eindruck der Chemnitzer Ereignisse von August 2018 ein Buch veröffentlicht, das nicht nur „die Nachgeschichte des Nationalsozialismus und der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit“ erzählt, sondern auch „die Ideen-, Organisations- und Gewaltgeschichte des Rechtsradikalismus“ in den Blickpunkt rückt.[16] Wer sich in dem Feld der Rechtsextremismusforschung bewegt, wird zudem schnell feststellen, dass es sie vieler Orten durchaus gibt, die zeithistorische Erforschung der extremen Rechten. Verschiedene Dissertationen und Postdoc-Studien sind im Entstehen begriffen oder wurden gerade abgeschlossen. Aber auch viele „Praktikerinnen und Praktiker“, die in Beratungsprojekten, Abgeordnetenbüros oder zivilgesellschaftlichen Initiativen tätig sind, beforschen eine „Zeitgeschichte des Rechtsextremismus“. Es sind die in dem breiten Feld der Rechtsextremismusforschung und -prävention so zahlreich vorhandenen personalen wie strukturellen Schnittstellen zwischen außeruniversitären Projekten und akademischen Einrichtungen, die sich auch für die Zeitgeschichtsforschung als fruchtbar erweisen können. Andersherum können Historiker*innen durchaus einen fachspezifischen sowie transdisziplinären Beitrag leisten, wenn es darum geht, die Geschichtspolitik der extremen Rechten zu bewerten, eine Geschlechtergeschichte der extremen Rechten und ihrer Darstellung nachzuzeichnen, die Geschichte des deutschen Rechtsterrorismus darzustellen oder organisationsgeschichtliche Ansätze am Beispiel der extremen Rechten zu erproben. Die disparate Quellenbasis – Geheimdienstmaterial oder Gerichtsakten unterliegen oft langen Sperrfristen und sind zu selten archivarisch aufbereitet – kann positiv gefasst werden, bieten doch unabhängige Archive wie das apabiz in Berlin oder das Archiv Lichtenhagen im Gedächtnis in Rostock eine Fülle an Material. Ebenso böte sich eine Wissenschaftsgeschichte der Rechtsextremismusforschung an, mit deren Hilfe Trends und Konjunkturen der Be-Forschung des „Rechtsextremismus“ kritisch hinterfragt werden können. Die Zeitgebundenheit von Rechtsextremismusforschung (beziehungsweise ihres Ausbleibens) könnte erstmals in den Blick genommen werden. Der positive Effekt einer stärkeren zeithistorischen Fokussierung bei der Erforschung von Kontinuitäten, Brüchen und Wandlungen der extremen Rechten liegt also auf der Hand.
Wir müssen den Blick aber auch weiten, wollen wir das aktuelle Erstarken der extremen Rechten als gesellschaftliches Phänomen betrachten. So kann es eine zeithistorische Rechtsextremismusforschung wohl kaum ohne Relation zur Demokratiegeschichte geben. Diese Debatte anzustoßen, ist eminent. Denn es kann nicht darum gehen, lediglich eine weitere Nischen-Disziplin innerhalb des geschichtswissenschaftlich-akademischen Betriebs zu positionieren und mal eben eine durch AfD-Wahlerfolg und NSU-Mordserie bedingte Aufmerksamkeitskonjunktur „mitzunehmen“. Ziel sollte es daher keineswegs sein, mit einem innovativ daherkommenden Ansatz das „nachwuchs“-wissenschaftliche Selbst-Unternehmertum bei der Drittmittelvergabe zu fördern. Stattdessen sollen die Überlegungen in Richtung einer zeithistorischen Rechtsextremismusforschung dazu dienen, einen nachhaltigeren Effekt zu erzeugen.
[1] Axel Schildt, Faschismustheoretische Ansätze in der deutschen Geschichtswissenschaft. Sieben Thesen, in: Claudia Globisch/Agnieszka Pufelska/Volker Weiß (Hg.), Die Dynamik der europäischen Rechten. Geschichte, Kontinuitäten und Wandel, Wiesbaden 2011, S. 267-279, hier 275.
[2] Kurt P. Tauber, Beyond Eagle and Swastika. German Nationalism Since 1945, Bd. 1, Middletown 1967, S, XV f. Übersetzung durch den Verfasser.
[3] Gabriele Metzler, Der Staat der Historiker. Staatsvorstellungen deutscher Historiker seit 1945, Berlin 2018, S. 120-122 u. 186 f.
[4] Einleitung, in: Gotthard Jasper (Hg.), Von Weimar zu Hitler 1930-1933, Köln 1968, S. 9-24, hier 10.
[5] Fritz René Allemann, Bonn ist nicht Weimar, Köln 1956.
[6] Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. Studienausgabe mit einem Ergänzungs-Teil. Antidemokratisches Denken in der Bundesrepublik, München 1968, S. 318 u. 347; Karl Dietrich Bracher, Deutschland zwischen Demokratie und Diktatur. Beiträge zur neueren Politik und Geschichte, Bern, München 1964, S. 298, 305 u. S. 301 f.
[7] Lutz Niethammer, Angepaßter Faschismus. Politische Praxis der NPD, Frankfurt a. M. 1969, S. 95 u. 260. Niethammer folgte in seiner eigenen Studie Taubers „Phaseneinteilung des organisierten Nationalismus“ (S.11). Siehe dazu auch Yves Müller, „Faschistische Grundstruktur“. Lutz Niethammers Analyse der extremen Rechten (1969), in: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 16 (2019), 1, S. 197-205.
[8] Konrad H. Jarausch, Die Umkehr. Deutsche Wandlungen 1945-1995, München 2004, S. 196.
[9] Dudek, Jaschke, Rechtsextremismus (Bd. 1: Zur Tradition einer besonderen politischen Kultur), S. 17.
[10] Christopher Browning, Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung“ in Polen, Reinbek 1993.
[11] Vorwort, in: Detlev J. K. Peukert, Frank Bajohr, Rechtsradikalismus in Deutschland. Zwei historische Beiträge, Hamburg 1990, S. 7-8, hier 7.
[12] Hans-Peter Schwarz, Die neueste Zeitgeschichte, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 51 (2003), 1, S. 5-28, hier 24.
[13] Jan C. Behrends, Tomas Lindenberger, Patrice G. Poutrus, Fremde und Fremd-Sein in der DDR. Zur Einführung, in: Dies. (Hg.), Fremde und Fremd-Sein in der DDR. Zu historischen Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland, Berlin 2003, S. 9-21, hier 12.
[14] Wolfgang Benz, Einführung, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 63 (2015), 9, S. 717-720, hier: 719.
[15] Volker Weiß, Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes, Stuttgart 2017; Michael Wildt, Volk, Volksgemeinschaft, AfD, Hamburg 2017; Wirsching, Andreas; Kohler, Berthold; Wilhelm, Ulrich (Hrsg.): Weimarer Verhältnisse?. Historische Lektionen für unsere Demokratie, Ditzingen 2018.
[16] Norbert Frei, Franka Maubach, Christina Morina, Maik Tändler, Zur rechten Zeit. Wider die Rückkehr des Nationalismus, Berlin 2019, S. 14.
Zitation
Yves Müller, „Normalfall“ Neonazi – Oder: Gibt es eine zeithistorische Rechtsextremismus-Forschung?, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/normalfall-neonazi-oder-gibt-es-eine-zeithistorische-rechtsextremismus-forschung