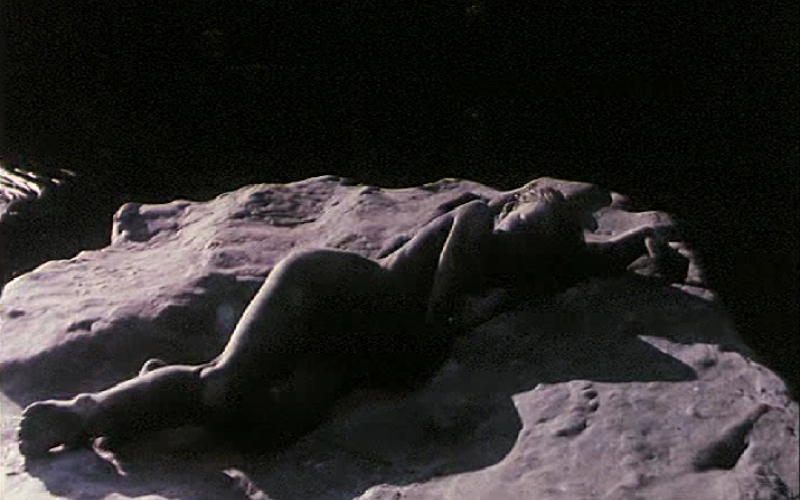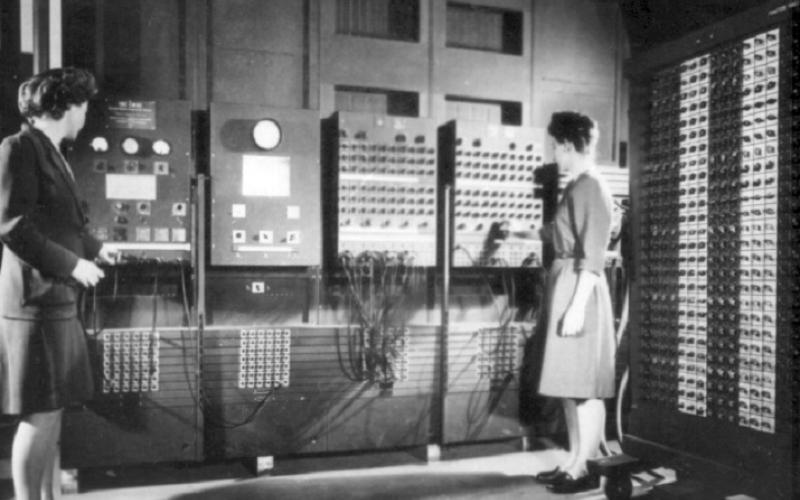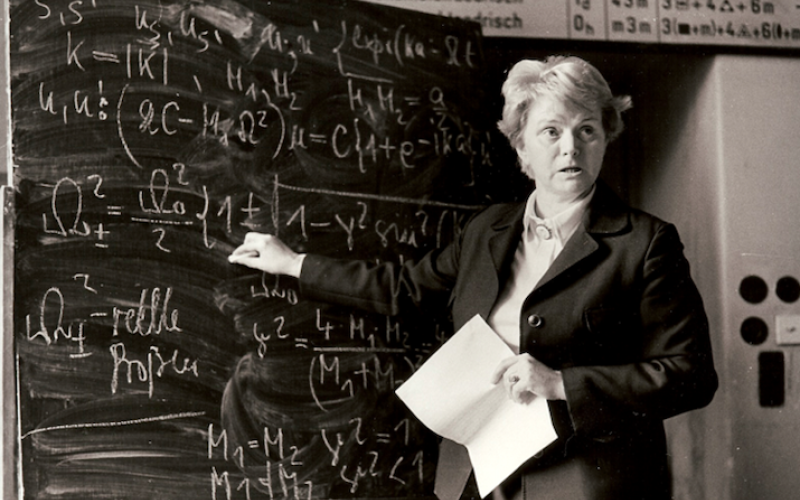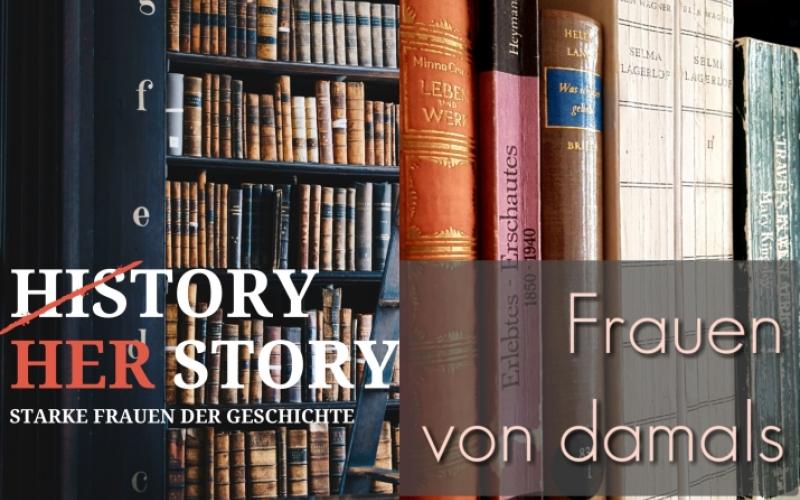Heike Wieters ist seit Oktober 2019 Juniorprofessorin für Historische Europaforschung am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie forscht zur vergleichenden Wohlfahrtsgeschichte, der Entwicklungs- und Ernährungsgeschichte sowie der Geschichte der Europäischen Integration, insbesondere der europäischen Wirtschafts- und Marktintegrationsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Mit zeitgeschichte|online hat Heike Wieters über die Chancen und Möglichkeiten einer Juniorprofessur gesprochen.
zeitgeschichte|online: Wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie jetzt sind? Was haben Sie „richtig gemacht“ in Ihrer Berufsbiographie?
Heike Wieters: Autobiographisches Nachdenken führt schnell zu Zerrbildern, und so bin ich nicht sicher, ob sich diese Frage wirklich zufriedenstellend beantworten lässt. Ganz grundsätzlich fallen mir dazu aber drei Dinge ein:
Ich habe früh in meinem Geschichts- und Philosophiestudium (in das ich, um ehrlich zu sein, eher reingerutscht, als mit voller Absicht gegangen bin), bemerkt, dass ich nur dann gut und effektiv arbeite, wenn ich das Gefühl habe, wirklich relevante und interessante Dinge zu tun. Ich benötige für mich selbst eine gute ‚Story‘ und eine überzeugende Rechtfertigung, um Projekte erfolgreich umzusetzen. Das heißt, ich habe bei „beruflichen“ Entscheidungen immer überlegt, ob ich in einem neuen Umfeld die Chance bekomme, das zu tun was für mich und andere wichtig ist. Wenn das nicht gegeben war, habe ich mich gar nicht erst beworben.
Gleichzeitig war ich (so glaube ich) immer gut darin, Chancen als solche zu erkennen und sie zu nutzen – und das heißt auch, Mühe und Zeit zu investieren und manchmal auch Risiken einzugehen. Ich habe seit meiner Jugend Wettkampfsport gemacht und früh gelernt, dass Scheitern immer möglich ist. Ich weiß aber auch, dass ich auch nach einer Niederlage gut schlafe, wenn ich zumindest alles versucht und mein Bestes gegeben habe.
Und drittens habe ich schnell verstanden, dass man nichts in seinem Leben allein schafft. Die autobiographische Verlockung, sich rückblickend als tolle Macherin zu gerieren ist enorm (eine Tendenz, die im Übrigen gut untersucht ist). Aber mir ist vollauf bewusst, dass mein soziales Umfeld zentral war und es immer noch ist bei allen Entscheidungen. Ich habe daher immer aktiv nach Personen gesucht, die bereit waren mich zu beraten und mich auf Chancen (und Risiken) aufmerksam zu machen. Dazu zählen sowohl Eltern, Freunde und direkte KollegInnen, von denen ich extrem viel gelernt habe, als auch Chefs und Chefinnen, meine Doktorväter oder andere akademische Lehrerinnen und Lehrer. Für deren Zeit und Feedback bin ich bis heute dankbar und versuche es zu erwidern und weiterzugeben.
zeitgeschichte|online: Sie sind die erste Juniorprofessorin, die wir interviewen. Was bedeutet diese Stelle für Sie und können Sie geschlechterspezifische Besonderheiten/Hürden auf der Ebene der Juniorprofessur beobachten?
Wieters: In gewisser Weise gäbe es meine aktuelle Stelle ohne gezielte Frauenförderprogramme an der Humboldt-Universität gar nicht. Das Profil der Stelle hat selbstredend wissenschaftsimmanente Fundamente und ich bin der festen Überzeugung, dass man die Juniorprofessur für Historische Europaforschung am Institut für Geschichtswissenschaften erfinden müsste, wenn es sie nicht gäbe. Aber im universitären Alltag liegen neue Professuren ja nicht auf der Straße, sondern müssen entweder hart erkämpft werden oder nach der Emeritierung eines Lehrstuhlinhabers/Inhaberin thematisch umgewidmet werden. Die Tatsache, dass das Institut für Geschichtswissenschaften (IFG) sich 2018 für eine zusätzliche Juniorprofessur beworben hat und diese nun für sechs Jahre aus Frauenfördermitteln finanziert wird, gibt heute sowohl dem IFG mehr Spielraum (mehr Forschung, mehr Lehre, weitere Ideen und Kooperationsmöglichkeiten) – dies auch völlig unabhängig von meiner Person – als eben auch mir die Möglichkeit, etwas aus diesen sechs Jahren und den eben genannten Möglichkeiten zu machen. Ich kann in Forschung und Lehre neue Akzente setzen, bekomme die Option mit den Kolleginnen und Kollegen am IFG interessante Projekte zu machen, eigene und gemeinsame Ideen in die Tat umzusetzen und kann auch international den Austausch voranbringen. Ich habe dabei nie die Hürden, sondern von Beginn an immer die Chancen gesehen.
zeitgeschichte|online: Sie beschäftigen sich mit der Geschichte von NGOs, Wohlfahrt und Entwicklung. Welche geschlechterspezifischen Trends sind hier zu beobachten? Man denke beispielsweise an die spezifische Förderung von jungen Mädchen im Globalen Süden, die seit den 90ern in den Fokus vieler internationaler Organisationen geraten ist.
Wieters: Geschlecht spielt als Kategorie eine zentrale Rolle für die Historiographie an sich. Sowohl wohlfahrtstaatliche als auch entwicklungspolitische Programme operieren mit zahlreichen und sich oft auch widersprechenden genderpolitischen Leitbildern und Zielvorstellungen. Gesellschaftlicher Wandel kann gerade in solchen Institutionen extreme Fliehkräfte und Spannungen erzeugen. Dafür ein Beispiel, das an Ihre Frage anschließt: Sie haben mit der Beobachtung Recht, dass Frauen und Mädchen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmend in den Fokus von entwicklungspolitischen Programmen geraten sind, im Übrigen schon weit früher als in den 1990er Jahren. Dies allerdings bei weitem nicht immer als selbstbestimmte Akteure, sondern oft als „stillende Mütter“, oder Zuständige für alle Formen von Care-Arbeit, denen ganz selbstverständlich bestimmte Qualitäten und Lebensziele zugeschrieben wurden und werden. Entsprechend eindimensional wurden Frauen daher oft adressiert. Ähnliches gilt sicherlich auch für das vorhandene Netz an wohlfahrtstaatlichen Institutionen in der Bundesrepublik, in dessen Funktionslogik Altersarmut von (Ehe-)Frauen lange quasi eingeschrieben war. Ich würde weder den MitarbeiterInnen entwicklungspolitischer Organisationen noch denen in wohlfahrtstaatlichen Programmen böse Absicht unterstellen wollen, aber wir beobachten überall, dass sich notwendige Perspektivwechsel, wie die Einbeziehung von Frauen und Mädchen in Prozesse gesellschaftlichen Wandels (um nicht Fortschritt zu sagen), mit sehr langlebigen geschlechterpolitischen Leitbildern vermischen. Dies sorgt immer wieder für große Spannungen und (Ungleichheits-)Konflikte, die sowohl für die Historikerin in mir hochinteressant und brisant sind, als natürlich auch für mich als Zeitgenossin.
zeitgeschichte|online: Gab es einen Moment, in dem/Situation in Ihrer Wissenschaftlichen Laufbahn, in der Sie die „Gläserne Decke“ wahrgenommen haben – warum/warum nicht?
Wieters: Ich kenne die Studien zu diesem Thema und sehe die Zahlen, etwa was die Vorstandsbeteiligung von Frauen in DAX Konzernen angeht. Und auch was die Berufungen auf Lehrstühle (auch in der Geschichtswissenschaft) angeht, war es lange offensichtlich, dass irgendwo eine Liga existiert, wo ‚man‘ gerne unter sich blieb; wenngleich ich mehr als sicher bin, dass Geschlecht eben nicht das einzige Distinktionsmerkmal war und ist. Es gibt überall Leute, die eigene Privilegien nicht teilen wollen. Und die finden, dass sie (und sie allein, auch jenseits nachvollziehbarer Kriterien) bestimmen dürfen wer „gut genug“ ist und wer eben nicht.
Es liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass man diese „gläserne“ Decke oft selbst nicht wahrnimmt – oder wenn, dann erst in der Rückschau. Das „Glas“ ist, glaube ich, oft eher statistisch zu fassen und wird für die Einzelne selten ganz konkret greifbar.
Das heißt, ich selbst habe mir bisher noch nicht den Kopf gestoßen und dort wo es zu Konflikten kam, habe ich sie offen geführt und dabei zumeist sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings ist für mich als vergleichsweise junge Wissenschaftlerin vollkommen offensichtlich, dass ich von den Erfahrungen und zu einem gewissen Grad auch den vorangegangenen Kämpfen meiner Kolleginnen enorm profitiere.
zeitgeschichte|online: Wovon haben Sie innerhalb Ihrer Laufbahn profitiert? Hatten Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn Vorbilder* oder Mentor:innen?
Wieters: Ja, ich hatte das vorhin schon angedeutet: das Bild der einsamen Macherin ist ein Mythos und ein schädlicher dazu. Ich habe mir immer Leute gesucht, deren Art Dinge zu tun ich klug und beeindruckend fand und habe versucht zu verstehen, was ich daraus für mein eigenes Leben machen kann. Ich hatte eine Reihe an sehr beeindruckenden Chefinnen und Chefs und bitte diese teilweise noch heute bei wichtigen Dingen um Rat. Ich habe außerdem direkt nach meiner Promotion am ProFil-Mentoring Programm der Berliner Universitäten teilgenommen (und war danach im Vorstand des zugehörigen Vereins). Vom ProFiL-Programm habe ich enorm profitiert, sowohl vom Mentoring und den Workshops, als eben auch von den anderen Wissenschaftlerinnen im Programm, mit denen ich teilweise noch heute in Kontakt bin.
Insgesamt halte ich den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen im weitesten Sinne für eine absolut zentrale Ressource. Nicht im utilitaristischen Sinne, sondern weil sie – selbst wenn sie etwas ganz anderes wollen als ich – oft vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele unterschiedliche Optionen es gibt, wissenschaftliche (und auch persönliche) Herausforderungen anzugehen. Und ich habe die besten Lösungen eigentlich immer in der Auseinandersetzung mit anderen gefunden. Entscheiden muss man am Ende selbst, aber der Prozess dorthin war für mich immer ein dialogischer.
zeitgeschichte|online: Inwiefern hat die Corona-Pandemie ihre Arbeit als Historikerin beeinflusst/verändert?
Wieters: Die geschlossenen Archive in den beiden letzten Semestern waren nicht gerade ideal, um an meinem Buch voranzukommen. Das hat viele Forschungspläne empfindlich gestört. Und auch, dass viele Dinge, die ich zum Ausgleich mache (etwa Mannschaftssport) nicht mehr gingen war unerfreulich. Andererseits ist es auch Unfug zu jammern, denn andere Leute hat es weitaus härter getroffen, nicht nur was ihren Alltag angeht, sondern auch finanziell, familiär oder gar gesundheitlich. Gerade für KollegInnen mit Kindern war die Pandemie oft eine familienpolitische Rolle rückwärts. Ich hingegen konnte die „freie“ Zeit für andere Dinge nutzen und habe To Dos abgehakt, die sonst immer hinten runtergefallen sind. Mich nervt die „Krise als Chance“ Rhetorik immer sehr (und meine Frustrationstoleranz hat insgesamt leider klare Grenzen), aber generell habe ich es meistens geschafft, eher Lösungs- als Problemorientiert zu sein. Ich fand Online Lehre zum Beispiel halb so wild und habe viel mit neuen Formaten und Ideen herumexperimentiert, die mir durchaus gefallen haben. Auch wenn mir der tägliche Kontakt und der direkte Austausch mit den Kolleginnen und Studierenden extrem fehlt. Trotzdem blicke ich eigentlich recht positiv aufs Sommersemester und bin insgesamt eher froh, dass wir am IFG gemeinsam mit den Studierenden trotz der Pandemie doch so viel erreicht haben.
zeitgeschichte|online: Wir haben alle Interviewpartner*innen am Ende unserer Gespräche gefragt: Welche Empfehlungen würden Sie dem (weiblichen) wissenschaftlichen Nachwuchs* mit auf den Weg geben, damit wir in Zukunft mehr Chancengleichheit in der Wissenschaft erreichen?
Wieters: „Bildet Banden“. Das habe ich allen Erstsemestern im letzten Jahr gesagt, als ich sie begrüßen durfte. Es klingt vielleicht ein bisschen drollig und old-school, aber ich meine das durchaus ernst: Ich bin fest davon überzeugt, dass (fast) alles im Leben besser zusammen geht, lernen, arbeiten, forschen und auch „vorankommen“ (und hier sehe ich eigentlich auch die größten Nachteile der aktuellen Distanz-Uni Situation, sowohl für WissenschaftlerInnen als auch für die Studierenden).
Natürlich gibt es Dinge, für die wir am Ende allein verantwortlich sind. Und nicht alles muss man bis zum bitteren Ende ausdiskutieren, manchmal ist ‚selber machen‘ eine gute Lösung. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es Sinn macht, sich zu organisieren, Lernprozesse gemeinsam voranzubringen, sich untereinander auszutauschen und um Rat und Hilfe zu bitten, wenn nötig. Ich bin davon überzeugt, dass wir als soziale Wesen nur gemeinsam die Dinge ändern können, die wir ändern müssen. Das betrifft nicht nur, aber eben ganz sicher AUCH mehr Chancengleichheit in der Wissenschaft.
Zitation
Heike Wieters, Wissenschaft ist Dialog. Interview mit Heike Wieters, Juniorprofessorin für Historische Europaforschung , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/wissenschaft-ist-dialog