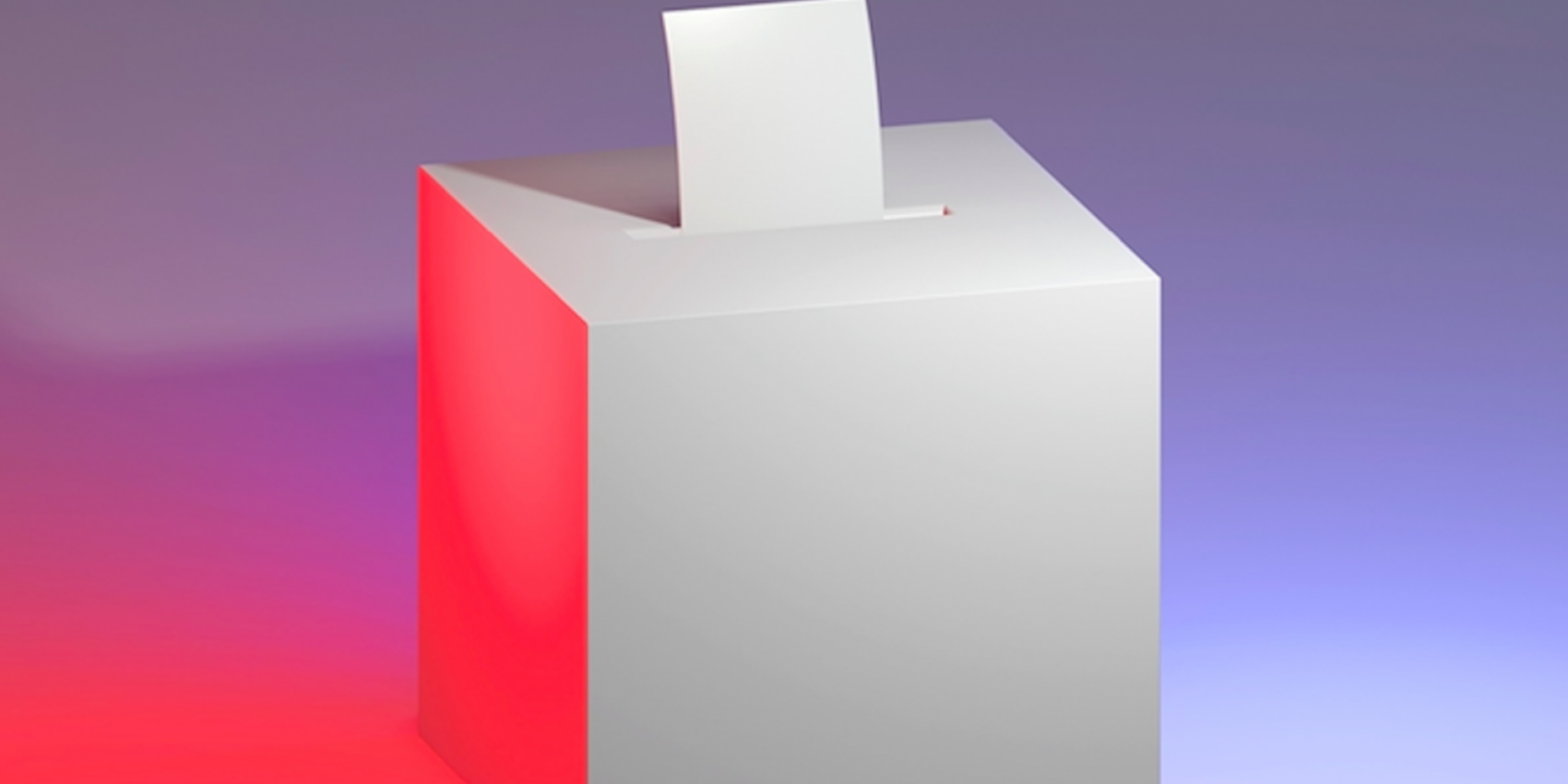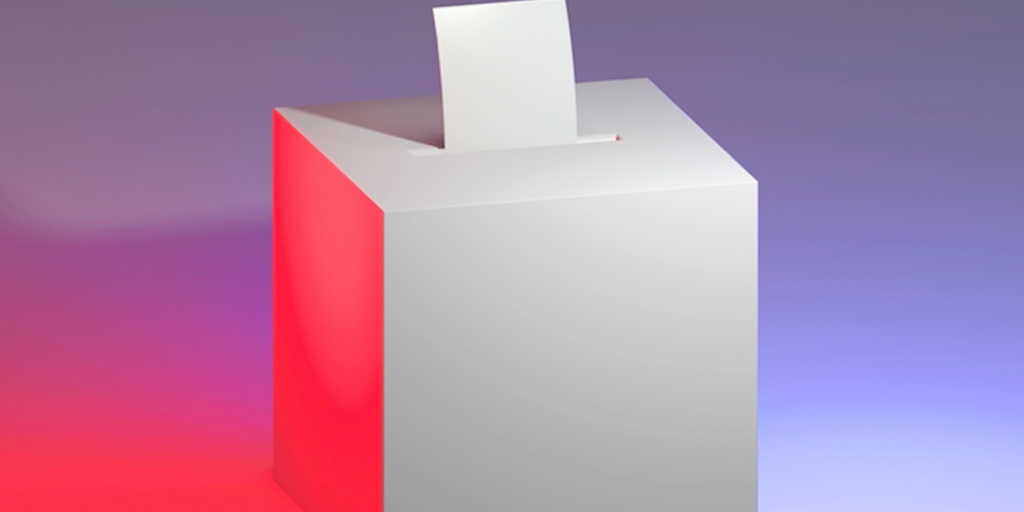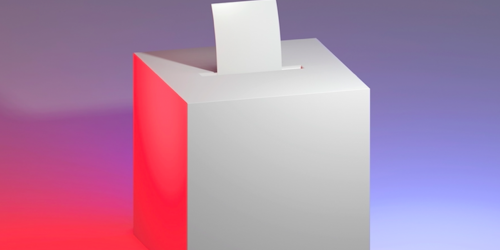Für zeitgeschichte|online haben sich Sonja Levsen, Professorin für Neueste Geschichte an der Universität Trier, Claudia C. Gatzka, Historikerin und akademische Rätin a.Z. an der Universität Freiburg, Benedikt Wintgens, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien e.V. (KGParl) und Janosch Steuwer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Halle-Wittenberg, über den Stand der Demokratiegeschichte innerhalb der Zeitgeschichtsforschung ausgetauscht.
Sie berichten darüber, was aus ihrer jeweiligen Perspektive die Geschichte der frühen Bundesrepublik so interessant macht, welche Herausforderungen das Feld birgt – Stichwort Wiedervereinigung und NS-Zeit – sowie über bisher (noch) bestehende blinde Flecken in der Zeitgeschichtsforschung.
Das hier veröffentlichte Gespräch knüpft an eine Veranstaltung des Kolloquiums von Sonja Levsen aus dem letzten Jahr an, bei dem die Interviewerin anwesend war, und vertieft verschiedene Punkte.
Wie definieren Sie Demokratie bzw. Demokratiegeschichte als Untersuchungsgegenstand und warum beschäftigen Sie sich gerade mit der frühen Bundesrepublik?
Claudia C. Gatzka: In der Tat ist die frühe Bundesrepublik ein spannendes Feld für die neue Demokratiegeschichtsforschung, weil sich hier ein Institutionengefüge, das auf dem Prinzip der Volkssouveränität beruhte, in einem postfaschistischen Setting neu etablieren musste. Worin genau aber die Unterschiede zwischen der nationalsozialistischen Diktatur und der Demokratie lagen und liegen sollten, darüber stritten sich nicht nur Parteien und Öffentlichkeit, sondern diese Frage war auch Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Bürger:innen und ihren politischen Vertreter:innen.
Demokratiegeschichte wird häufig gefasst als eine Staats- oder Gesellschaftsgeschichte in der Demokratie. Die Geschichte der Bundesrepublik oder die Geschichte des Frauenbildes der FDP, zum Beispiel, sind als solche aber noch keine Demokratiegeschichten. Demokratiegeschichte definiert sich durch ein Problem, das man erforscht. Und dieses Problem ist das Demokratische als Herausforderung und Diskurszusammenhang. Was das Demokratische ausmacht, variiert je nach Perspektive; hier hat die Forschung noch keinen geteilten analytischen Begriff gefunden. Ich würde Demokratiegeschichte als die Geschichte des Problems fassen, das Prinzip der Volkssouveränität in modernen Flächenstaaten wirksam zu machen. Die Geschichte „der“ Bundesrepublik ist dann hier nicht mehr synonym gemeint, wohl aber lassen sich zahlreiche Aspekte der Bundesrepublik als ein Versuch, die Herrschaft des Volkes wirksam zu machen, historisch untersuchen.
Janosch Steuwer: Mich interessiert vor allem die Interaktion zwischen politischen Institutionen und der Bevölkerung, was sowohl die Legitimierung von Politik mit dem Verweis auf das „Volk“ als auch die Beteiligung der Bevölkerung an politischen Prozessen umschließt. Die Idee der Volksherrschaft, die die Legitimierung von Politik gegenüber dem „Volk“ und dessen Beteiligung an politischen Abläufen notwendig macht, begründete im 20. Jahrhundert ganz unterschiedliche politische Ordnungen, die sich alle auf das Volk beriefen. Daran sieht man vielleicht besonders deutlich, dass Demokratiegeschichte in diesem Sinne nicht einfach die Geschichte von Demokratien meinen kann – und dass klassische Aufstiegserzählungen über deren Verbreitung im Verlauf der Zeit ihren Gegenstand verfehlen. Als verflochtene Geschichte eines Problems kann Demokratiegeschichte sowohl historisch komplexere Zusammenhänge freilegen als auch simple Gegenüberstellungen von Demokratien und Diktaturen zurückweisen, die aktuelle politische Debatten noch immer prägen.
Benedikt Wintgens: An der frühen Bundesrepublik fasziniert mich das vielschichtige Verhältnis von Vertrautem und Fremdem. Einerseits kennen wir viele Strukturen aus unserer Gegenwart. So gilt seit 1949 das Grundgesetz, der Bundestag setzt sich noch immer vor allem aus den Parteien zusammen, die nach dem Nationalsozialismus neu- oder wiedergegründet wurden, und es erscheinen weiterhin der „Spiegel“, die „Süddeutsche“ oder die „FAZ“. Auf der anderen Seite wirken die Debatten, die vor 50, 60, 70 Jahren in diesem scheinbar vertrauten Parlament und in der Öffentlichkeit geführt wurden, weit weg. Das gilt beispielsweise für die Rolle der Religion und für den Einfluss der christlichen Kirchen. Demokratiegeschichtlich ist die Frühphase der Bundesrepublik deshalb besonders interessant, weil damals versucht wurde, nach dem Nationalsozialismus und anders als in der kommunistisch organisierten DDR ein demokratisches System zu etablieren und – anders als das in Weimar gelang – weiterzuentwickeln.
Sonja Levsen: Wenn man den Blick noch dazu über die Bundesrepublik hinaus öffnet, stößt man rasch darauf, wie intensiv in Westdeutschland nach 1945 über Demokratie nachgedacht wurde. In ganz anderer Intensität als andere Nachkriegsgesellschaften war die Bundesrepublik eine selbstbeobachtende Demokratie. Diese Beobachtung begann zweifellos vor 1949 und von außen: Die alliierten Besatzungsmächte waren besorgt, ob sich die parlamentarische Demokratie in Deutschland stabilisieren und wie sich die Deutschen zu ihr verhalten würden. Aber auch in der westdeutschen Gesellschaft selbst wurde Demokratie und die Frage danach, was „demokratisch“ und „undemokratisch“, was demokratieförderlich und was eine Gefahr für die Demokratie sei, intensiv verhandelt. Was als „demokratisch“ galt, wandelte sich dabei signifikant: In den 1970er Jahren hatte der Begriff deutlich andere Konnotationen als nach Kriegsende. Mein derzeitiger Zugang zur Demokratiegeschichte ist, diesen Imaginationen des Demokratischen nachzugehen, nach ihrer Wirkmacht und ihren Konsequenzen zu fragen. Also eine konsequente Historisierung von Begriffen, aber zugleich keine Beschränkung auf eine Diskursgeschichte, sondern verbunden mit einer Analyse von konkretem Wandel in der Praxis, mit der Frage: Welche Vorstellungen von Demokratie haben welche Reformen, welche Praktiken hervorgebracht? Das ist aber natürlich nur eine mögliche und eher spezifische Spielart der Demokratiegeschichte; sie profitiert von vielen verschiedenen Zugängen.
Mit welchen „neuen“ Quellentypen könnten neue Erkenntnisse gewonnen werden? Wie unterscheiden sich Ihre Herangehensweisen von früherer Forschung zur Demokratiegeschichte der Bundesrepublik?
SL: Viele Geschichten der Bundesrepublik sind von Perspektiven „von oben“, von Politiker:innen und Intellektuellen, geprägt. So entstand etwa das Narrativ der ‚unpolitischen‘ Westdeutschen nach 1945. Es spiegelt den Politikbegriff, die Interessen und zugleich die Diagnose einer spezifischen Beobachtergruppe. In den letzten Jahren haben zahlreiche Studien zur Differenzierung der Geschichte der Bundesrepublik beigetragen, aber es gibt noch viel zu tun – und dabei von Diagnosen „der“ Westdeutschen Abstand zu nehmen und nach der Pluralität von Diskursen, Praktiken und Einstellungen zu fragen. Das bedarf einer Pluralität der untersuchten Quellen. Jenseits der Frage neuer Quellen verspricht auch eine konsequentere Einbettung der Debatten über die Bundesrepublik in eine westeuropäisch-transatlantische Geschichte der Demokratie nach 1945 einen Perspektivwechsel.
CG: In der Tat ist die Geschichte der westdeutschen Demokratie und ihrer Selbstbeschreibungen in aller Regel eine Geschichte ihrer Eliten und machtvollen Sprecher. Blicke „von unten“ sind in den Großerzählungen nicht verarbeitet, auch weil viele Historiker:innen glauben, sie könnten die Meinungen und Haltungen der Bevölkerung durch zeitgenössische Umfragedaten abbilden. Demoskopische Umfragen sind aber sozialwissenschaftlich und damit künstlich produzierte Momentaufnahmen, genauer gesagt Antworten einer repräsentativen Anzahl von Personen auf geschlossene Fragen, die Sozialwissenschaftler:innen formuliert haben. Um herauszufinden, wie Bürgerinnen und Bürger die demokratischen Systeme, in denen sie leben, beobachten und an ihnen partizipieren, müssen andere, qualitative Beobachtungen sowie vor allem Ego-Dokumente ausgewertet werden. Ich persönlich habe mit Reportagen in der (Lokal-)presse und mit Briefen, auch Leserbriefen, gearbeitet und dabei viele Einsichten gewonnen.[1]
JS: Ich stimme völlig zu. Demoskopische Umfragen scheinen mir allerdings auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer neuer Quellen bedarf, um andere Geschichten zu schreiben. Es gibt inzwischen ja eine Reihe an Studien, die Umfragen nicht als Quellen sondern als historischen Gegenstand in den Blick genommen und gezeigt haben, wie tiefgreifend sie die Kommunikation zwischen politischen Institutionen und Bevölkerung verändert haben. In dieser Weise können dann auch tradierte, etwa ideengeschichtliche Perspektiven neue Einsichten produzieren. Ich konnte am Beispiel von Elisabeth Noelle-Neumann und ihrer Theorie der „Schweigespirale“ zeigen, dass Demoskopie nicht einfach ein neutrales Messinstrument ist, sondern ihr Siegeszug in der Bundesrepublik eng mit der Reformulierung konservativer und rechter Politik in den 1970er Jahren verflochten war.[2] In diesem Sinne braucht es für neue Erkenntnisse häufig gar nicht zwingend unausgewertete Quellen. Es kommt vor allem auf die Rekombination von Quellen und methodischen Perspektiven an.
BW: Die Erforschung der westdeutschen Demokratiegeschichte begann um 1980, indem die Aufbauphase der demokratischen Institutionen nach 1945 beschrieben wurde. Aus dieser Fragestellung resultierte fast wie von selbst ein politikgeschichtlicher Ansatz inklusive der Politikerbiographien. Auch die Gleichsetzung von Demokratiegeschichte und (Erfolgs-)Geschichte der Bundesrepublik schien in diesem Kontext einleuchtend. Mein Ansatz war es, den Neubeginn der parlamentarischen Demokratie im Bonner Bundestag „von außen“ zu reflektieren. Daher habe ich die Debatten, Konflikte und Ausdrucksformen rekonstruiert, mit denen Schriftsteller:innen, Journalist:innen und andere Intellektuelle die neue Demokratie, ihre Entscheidungen und ihre Bedrohung verarbeitet haben. Dabei handelt es sich um zuvor wenig beachtete Quellen. Es blieb aber, gerade weil es um die frühe Bundesrepublik geht, eine Perspektive von artikulationsfähigen Deutungseliten, vor allem Männern. Wie angeklungen stellt sich im Rahmen der Demokratiegeschichte die Frage nach weiteren Formen der Partizipation, der Politik „an der Basis“, in Parteien oder gesellschaftlichen Gruppen. Eine große Herausforderung ist außerdem die Integration nichtschriftlicher Quellen und audiovisueller Medien in die Forschungspraxis.
In Ihrem Gespräch haben Sie angedeutet, dass viele Quellenbegriffe von der bisherigen Forschung zur frühen Bundesrepublik als Analysebegriffe übernommen wurden. Wie könnte das in Zukunft verhindert werden?
BW: Dass zeitgenössische Begriffe aus den Quellen in die Geschichtswissenschaft einfließen, halte ich fast für unvermeidlich – man denke etwa daran, wie allgegenwärtig heute Worte wie „Globalisierung”, „Populismus” oder „Digitalisierung” sind. Vermutlich werden diese Begriffe auch verwendet, wenn es eines Tages um die Historisierung unserer Gegenwart geht. Quellenbegriffe haben heuristisches Potential, allerdings auch problematische Anteile, weil sie Deutungen oder Werturteile transportieren. Für die Wissenschaft ist es daher wesentlich, zeitgenössische Begriffe nicht unreflektiert zu übernehmen. Ein Beispiel: Wieviel städtebaulich Neues geschah während des „Wiederaufbaus”, auch wenn Veränderungen in dem Wort Wiederaufbau eigentlich nicht enthalten scheinen? Solche Fragen machen die Reflexion von Begriffen für die Zeitgeschichte so wertvoll. Und manchmal reichen schon Distanzmarker wie An- und Abführungszeichen oder ein Halbsatz, um einen Abstand zu Begriffen herzustellen, beim „Kalten Krieg” etwa oder der „Dritten Welt”.
CG: Ganz richtig. Ich denke aber schon, dass sich trotz der Verwendung derselben Begriffe in der Analyse- wie in der Quellensprache eine Konfusion vermeiden lässt, wenn man in jeder Studie über dieses Verhältnis offen reflektiert. So wie wir es auch im Proseminar verlangen. Seinen analytischen Begriff von Demokratie, Populismus, Globalisierung oder was auch immer in der Einleitung zu klären, wäre nicht nur vorbildliches wissenschaftliches Handwerk, sondern würde auch Erkenntnisprozesse in Gang setzen. Denn wir lernen über den historischen Wandel eines Phänomens ungeheuer viel, wenn wir mit unserem analytischen Begriff auf den Quellenbegriff schauen und die Unterschiede zu beschreiben versuchen. Das hat in der älteren Geschichtsschreibung zur Bundesrepublik beinahe niemand getan, und auch deshalb ist es so wichtig, diese Geschichte nach der methodischen Reifung des Fachs neu aufzurollen.
SL: Eine lang kaum problematisierte Übernahme gilt etwa für das bereits genannte Attribut „unpolitisch“, aber auch für Verwendungen von „demokratisch“ und „Demokratisierung“. Demokratisierung war ein zeitgenössisches Projekt – zunächst der alliierten Besatzungsmächte, dann der Bundesrepublik selbst – mit ganz bestimmten Konnotationen, was eine „Demokratisierung“ beinhalte. Mit der Übernahme dieses Begriffs in der Historiographie wurden viele Konnotationen transportiert, die es sich zu dekonstruieren lohnt. Martin Conway hat jüngst überzeugend gezeigt, wie sich zeitgenössische Demokratievorstellungen konsequent historisieren lassen.[3] Das ist nicht zuletzt eine notwendige Grundlage für einen transnationalen historiographischen Dialog.
In der Zeitgeschichte ist die analytische Distanz zu zeitgenössischen Wahrnehmungen eine besondere Herausforderung. Welche Lösungen und Strategien gibt es dafür?
BW: Distanz zu wahren bzw. herzustellen ist eine Herausforderung nicht nur für die Zeitgeschichte. Sie stellt sich immer dann, wenn man zu einem Thema oder Gegenstand eine persönliche Verbindung hat, im hier diskutierten Fall durch das Miterleben. Zugleich resultieren aus diesen Verbindungen ja meist auch Interesse und Detailkenntnis. Daher sehe ich das weniger als Problem denn als Chance, wenn man das Verhältnis von Nähe und Distanz zum Forschungsgegenstand selbstkritisch reflektiert. Gegen das Risiko, wegen mangelnder Distanz Charakteristisches zu übersehen, helfen Perspektivwechsel mit Verfremdungseffekten. Dazu zählt der Vergleich, dazu gehören aber auch Spiegelungen durch andere Medien, Ausdrucksformen oder wissenschaftliche Disziplinen. So hat beispielsweise das Deutsche Historische Museum 2021 mit zwei Ausstellungen über die „documenta” und Künstler aus der NS-Zeit gezeigt, dass Kunst und Kultur auch politisch-kulturelle Speicher sind, Gradmesser der Demokratiegeschichte.
JS: Ich glaube schon, dass die Zeitgeschichte hier vor einer besonderen Herausforderung steht. Nicht deshalb, weil ihr ihre Forschungsgegenstände besonders vertraut sind, sondern vor allem weil unsere Fragen und Methoden auch das Ergebnis der Entwicklungen sind, die wir betrachten. Darüber ist in den vergangenen zehn Jahren unter dem Schlagwort einer Zeitgeschichte im Zeitalter der Sozialwissenschaften ja auch intensiv diskutiert worden und die wissensgeschichtliche Antwort, die man für dieses Problem gefunden hat, scheint mir eigentlich unhintergehbar: auch die Methodik, Begrifflichkeiten und Analysesprache zum Teil der historischen Reflektion zu machen.
SL: Den von Benedikt bereits erwähnten Vergleich empfinde ich als heuristisch sehr produktiv, insbesondere dessen Verfremdungseffekt. Er schafft Distanz. Aus dem Vergleich mit Frankreich etwa wurde für mich rasch deutlich, dass vieles, was in der Bundesrepublik als „demokratische“ oder „undemokratische“ Erziehung verstanden wurde, in Frankreich nicht als solche diskutiert wurde. Das warf für mich neue Fragen auf, die mein Buch geprägt haben. Umgekehrt wurde mir deutlich, wie stark die Präsenz einer kommunistischen Partei französische Debatten prägte – und dass die Abwesenheit einer signifikanten kommunistischen Partei in der Bundesrepublik manche Spezifika der westdeutschen Entwicklung erklärt. Dennoch bleibt es eine Herausforderung, zeitgenössische Wahrnehmungen nicht zu reproduzieren. Obwohl das für mich immer ein zentrales Anliegen war, sehe ich in meinem Buch einige Jahre nach der Publikation auch Aspekte, bei denen eigene Distanz noch größer hätte sein können.
Welche blinden Flecken machen Sie aus, wenn Sie die Forschung zur frühen Bundesrepublik betrachten?
CG: Partizipationsgeschichte in einem breiten Verständnis scheint mir sehr unterbelichtet, weil die historische Forschung eben der zeitgenössisch mit ganz konkreten politischen Absichten verbreiteten Erzählung aufsaß, die Deutschen seien „unpolitisch“. Die Geschichte politischer Milieus und ihrer Öffentlichkeiten, vor allem der politischen Rechten, wird ebenso wie die Geschichte politischer Konflikte und die von Janosch angesprochene Kommunikation zwischen Institutionen und Bevölkerung gerade erst entdeckt. Ich selbst arbeite an einer Geschichte politischer Repräsentation in der parlamentarischen Demokratie, die nach den Resonanzräumen politischer Institutionen wie dem Bundestag fragt.[4] Hier zeigt sich, dass das Verständnis und das Bewusstsein für ‚gute‘ Vertretung des Volkes durch Politiker:innen im Laufe der Bundesrepublik relativ starken Wandlungen unterworfen war. Es gibt gewissermaßen Konjunkturen der Sensibilität für das Problem des Demokratischen, und die frühe Bundesrepublik ist ein Beispiel für eine relativ niedrigschwellige Repräsentationserwartung an die Politik.
Aus sozialgeschichtlicher Sicht scheinen mir der Wandel materieller Lebensumwelten und die Eingriffe in physischen Raum, die im kriegszerstörten Westdeutschland seit 1945 massiv waren, ebenfalls Blindstellen zu sein. Gerade aus umweltgeschichtlicher Perspektive gäbe es hier noch viel zu tun. Ich habe in meinem Buch Demokratiegeschichte aus der Perspektive des Spatial turn betrieben und gefragt, wie politische Kommunikation zwischen Wähler:innen und Parteien von materiellen Räumen und urbanen Konstellationen abhing. Da zeigte sich, im Vergleich mit Italien, wie stark die Zerstörung der Innenstädte das Aussehen und die Performanz von Politik im postfaschistischen Alltag Westdeutschland beeinflusste und, ja, begrenzte.
Welche Rolle spielt die Kategorie „Geschlecht“ (schon) in der Forschungen zur Demokratiegeschichte?
SL: Geschlecht wurde erstaunlich spät zum Thema nicht nur in der Demokratiegeschichte, sondern in der Zeitgeschichte generell, zumal in der deutschen. Gegenüber der Historiografie zum 19. Jahrhundert ist hier eine Verzögerung festzustellen. Selbst die Frauenbewegungen der 1970er Jahren sind bislang nicht in befriedigendem Ausmaß untersucht worden, deutlich weniger jedenfalls als jene des 19. Jahrhunderts. Als Teil der Demokratiegeschichte wurden sie bisher kaum wahrgenommen. In jüngster Zeit ist die Aufmerksamkeit für das Thema deutlich gewachsen, wichtige Studien sind erschienen und andere sind in Vorbereitung; vieles ist aber noch offen. Das ist übrigens auch so spannend an der Zeitgeschichte – es gibt eben noch große „weiße Flecken“ auf der historiographischen Landkarte und viel zu entdecken…
BW: Schaut man heute auf Politik und Medien, Wirtschaft oder Kulturbetrieb der „alten” Bundesrepublik, überrascht, wie stark und wie selbstverständlich die westdeutsche Gesellschaft männlich dominiert war. Das gilt nicht nur für die 1950er Jahre, sondern noch für die 70er, 80er und 90er Jahre „nach 1968”. Diese „Man’s world” – um einen Popsong zu zitieren, in dem fast die gesamte moderne Zivilisation auf die „Tatkraft“ von Männern zurückgeführt wird – gab es in Westdeutschland, aber auch in den USA oder Frankreich, sie hatte also transnationale Aspekte. Dennoch ist es für die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg erklärungsbedürftig, gerade im Vergleich zur Weimarer Republik, dass der Fortschritt in der Frauenemanzipation so viel langsamer war als Modernisierung in anderen Bereichen. Für die Demokratiegeschichte der Bonner Republik betrifft das etwa die paradoxe Situation, dass es mehr Wählerinnen gab als Wähler, aber kaum Politikerinnen.
Was bedeutet die Wiedervereinigung für das Schreiben von Demokratiegeschichte der Bundesrepublik?
BW: Für die Bundesrepublik vor 1989/90 waren der „Kalte Krieg” und die daraus resultierende Teilung von allergrößter Bedeutung – politisch, sozial, lebensweltlich. Das galt für die Debatten in Parlament und Öffentlichkeit ebenso wie für den Alltag der Menschen. Die „alte” Bundesrepublik vor 1989/91 unterscheidet sich von der, wenn man sie so nennen will, Berliner Republik der 2010er-Jahre ganz grundlegend in allem, was mit dem „Kalten Krieg” zusammenhängt. Das betrifft nicht allein die Sicherheitspolitik, sondern auch die Schärfe der innenpolitischen Auseinandersetzungen, auch die Kriegs- und Atomangst. Eine Frage vor dem aktuellen Hintergrund des Ukraine-Krieges ist, ob sich das abermals ändert, Stichwort „Zeitenwende“, und wieviel Bi- oder Multipolarität die Zukunft kennzeichnen werden. Um für die alte Bundesrepublik das Argument von der strukturbildenden Bedeutung des Ost-West-Konflikts räumlich zu verorten: Ohne den „Kalten Krieg” wäre der Politikbetrieb nie nach Bonn gekommen, ohne die Wiedervereinigung wäre er vermutlich heute noch dort. Daher ist es nur folgerichtig, dass die Zäsur von 1989/90 für die Demokratiegeschichte der Bundesrepublik genauso zentral ist wie für den Gegenstand ihrer Untersuchung.
Wichtig ist zudem der in der Geschichtswissenschaft konstitutive zeitliche Abstand. Rund dreißig Jahre nach Mauerfall und Wiedervereinigung wird das damalige Geschehen zeithistorisch analysiert, werden Kontinuitäten oder Unterschiede zwischen der Bonner und der Berliner Republik neu bilanziert – inzwischen auch von Historiker:innen, die biographisch keine eigenen Erinnerung daran haben. Ihnen stellen sich eine Reihe offener Fragen. Denn während die historische Zäsur 1989/90 für die Ostdeutschen offensichtlich ist und immer wieder intensiv diskutiert wird, man denke an die These einer „Übernahme” (Ilko-Sascha Kowalczuk), ist das mit Blick auf die Westdeutschen weniger viel eindeutig. Dreißig Jahre später hat zum einen das wiedervereinigte Deutschland eine eigene Geschichte, zum anderen schärft sich der Blick auf das spezifisch Eigene der Bonner Republik, die mehr und mehr aus der Zeitgeschichte als „Geschichte der Mitlebenden” verschwindet.
JS: Mich beschäftigt in diesem Zusammenhang vor allem die Frage, wie man zu gesamtdeutschen Narrativen kommt, die nicht einfach die zeitgenössische Unterscheidung zwischen dem Westen mit einer „gefestigten Demokratie“ und dem Osten, der die Demokratie nun erst lernen muss, wiederholten. Der Verweis auf das „DDR-Erbe“ und die „Wende-Verlierer“ war für die Bundesrepublik ja auch ein großes Geschenk: Die Vereinigung schuf nicht nur neue Probleme. Sie erlaubte auch ältere Herausforderungen, denen man sich auch ohne „die Wende“ in den 1990er Jahren hätte stellen müssen, nun in den „neuen Bundesländern“ zu verorten oder zumindest diskursiv auf sie zu beschränken. Das gilt gerade für „Rechtsextremismus“ und „rechte Gewalt“, die in den 1990er Jahren in den Mittelpunkt demokratischer Selbstbeobachtung rückten, und dabei vor allem als ein ostdeutsches Problem beschrieben wurden – auch wenn beides natürlich ebenso in der alten Bundesrepublik existierte. Auch in den frühen 1990er Jahren hatte die tatsächliche regionale Verteilung etwa von „fremdenfeindlichen Straftaten“ gleichfalls nur wenig mit der diskursiven Verengung dieses Problems auf „den Osten“ zu tun. Die beiden Ebenen auseinanderzuhalten, ist aber gar nicht so leicht, weil die diskursiven Perspektiven eben nicht nur die öffentliche Debatte bestimmten, sondern zum Beispiel auch Erhebungen von Sozialwissenschaftler:innen und Statistiker:innen. Sich das klarzumachen und demgegenüber Entwicklungstrends im Westen im Blick zu behalten, die möglicherweise auch relativ ungestört von den verschiedenen Transformationsprozessen blieben, scheint mir eine wirkliche Herausforderung.
CG: Jenseits dieser wichtigen historiographiegeschichtlichen Bedeutung der Wiedervereinigung ist 1989/90 für die Demokratiegeschichte insofern ein Einschnitt, als sich die Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung der Bundesrepublik als demokratischer Gesellschaft durch die Anwesenheit der Ostdeutschen verändert hat. Konkret wandelte sich relativ abrupt der Diskurs über das „Volk“, wie ich jüngst in einem Aufsatz gezeigt habe.[5] Die Wiedervereinigung hatte damit auch Auswirkungen auf Westdeutschland, auf die Art, wie Westdeutsche die bundesdeutsche Demokratie begreifen. Philipp Thers Konzept der Ko-Transformationen, also des Wandels auch des Westens durch die Geschehnisse im Osten, ist hier sehr hilfreich.[6] Zugleich betone ich, dass 1989/90 als Zäsur eingebettet werden muss in längere Linien – dass wir vor allem den diskursiven Kontext der 'alten‘ Bundesrepublik mitbedenken müssen, wenn wir uns der Demokratiegeschichte des vereinigten Deutschlands zuwenden. Denn die bundesrepublikanischen 1980er Jahre prägten wesentlich mit, wie sich Gesamtdeutschland seit 1990 als Demokratie selbst beschrieb und welche Rolle dabei „dem Osten“ zugeschrieben wurde.
Welche Rolle spielt die NS-Zeit, wenn man sich mit Demokratiegeschichte und insbesondere mit der Geschichte der frühen Bundesrepublik beschäftigt?
SL: Demokratie wurde in der Bundesrepublik stets in Abgrenzung zur NS-Vergangenheit bzw. zu bestimmten Bildern von dieser Vergangenheit definiert. Der Nationalsozialismus war zwar nicht das einzige „Andere“ der Demokratie, auch der Kommunismus war eine wichtige Folie, vor der die Konturen der Demokratie gezeichnet wurden. Aber die Vergangenheit war unglaublich präsent, wenn auch häufig eher implizit. Deutungen der Vergangenheit und Idealvorstellungen des Demokratischen verschränkten sich und wurden in Bezug zueinander ausgehandelt. Als Beispiel: In der Nachkriegszeit wuchs in der Bundesrepublik die Kritik an einer vermeintlich spezifisch deutschen Tradition der ‚Untertanengesinnung‘ als Problem für die Demokratie; diese Kritik wurde von Alliierten ebenso vorgebracht wie von deutschen Bildungspolitiker:innen. Eine neue Erziehung zur Kritik und Partizipation sollte dieser Tradition entgegenwirken. In diesem Deutungsmuster verband sich eine Interpretation der Vergangenheit, in der die Masse der Deutschen letztlich als passiv gehorchende Untertanen einer schmalen nationalsozialistischen Führungsgruppe figurierte; aktive Partizipation und die vielfältigen Schattierungen von Mitwirkungen am und Teilzustimmungen zum NS-Regime wurden ausgeblendet. Eine Erziehung zur Partizipation schien demnach einen Weg in eine demokratische Zukunft zu weisen. Das hatte durchaus positive Konsequenzen für die Entwicklung des westdeutschen Bildungswesens, spiegelte aber neben einer problematischen Deutung der Vergangenheit auch ein ganz spezifisches Demokratieverständnis.
BW: Von den fünf Deutungsmustern, mit denen man laut Axel Schildt die Geschichte der Bundesrepublik verstehen könne, war eins die Interpretation als Nach- bzw. Belastungsgeschichte des „Dritten Reiches”. Am Anfang der Bonner Republik standen nicht nur metaphorisch die Trümmer der Kriegsruinen, und noch in den 1980er Jahren gingen Vertreter:innen der Erlebnisgeneration des Zweiten Weltkriegs, die zu Teilen eben auch die Tätergeneration der NS-Verbrechen war, in Rente.
Demokratiehistorisch hatte dabei die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus mindestens zwei Facetten: Normativ war die Bundesrepublik ein Gegenentwurf zur NS-Ideologie, etwa in Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.” Die Absicht, es besser zu machen, zeigte sich immer wieder und in ganz unterschiedlichen Bereichen. Der zweite Aspekt im Umgang mit der NS-Vergangenheit, der mit dem ersten der politischen Diskontinuität korrespondierte, nicht selten auch kollidierte, war die „Volkskontinuität”, wie Lutz Niethammer es genannt hat: die Tatsache, dass „Drittes Reich” und (frühe) Bundesrepublik kollektiv- und individualbiographisch eng miteinander verflochten waren. Die historische Forschung hat in den letzten zehn, zwanzig Jahren stark herausgearbeitet, dass zur Geschichte der Bundesrepublik nicht zuletzt die Integration zahlreicher NS-Täter, Kriegsverbrecher, „Mitläufer” und Opportunisten gehörte. Aus heutiger Sicht wirkt die Rücksichtnahme oft empörend. Was das aber für die Demokratiegeschichte der Bundesrepublik genau bedeutet hat, und zwar vor dem Hintergrund der gleichzeitig verlaufenden Demokratisierung, ist weiter relevant – möglicherweise auch, um konflikthafte Prozesse von Radikalisierung und Deradikalisierung, Demokratisierung und Entdemokratisierung besser zu erkennen.
JS: Ich glaube auch, dass der Nationalsozialismus als Referenz für die Entwicklung der Bundesrepublik von herausragender Bedeutung war. Was Sonja für das Feld der Erziehung skizziert hat, lässt sich ähnlich in zahlreichen gesellschaftlichen Feldern und Institutionen beobachten. Was mir in diesem Zusammenhang bislang fehlt, ist eine Reflexion der Zeitgeschichte über ihre eigene Rolle in diesem Prozess und die blinden Flecken, die sich daraus ergeben: Auch Historiker:innen waren ja seit den 1960er Jahren daran beteiligt, Kontinuitäten zwischen Bundesrepublik und Nationalsozialismus, insbesondere bei Funktionseliten, aufzudecken und Forderungen nach politischen Reformen zu erheben oder zu stützen. Daraus hat sich eine Erzählung entwickelt, die die Demokratisierung der Deutschen als Konflikt zwischen NS-Kontinuität und liberalisierender Vergangenheitsaufklärung recht schematisch darstellt. Erst in jüngster Zeit sind komplexere Argumente stark gemacht worden, die den Konflikt nicht als einen von „Erinnern“ und „Vergessen“, sondern als Differenz verschiedener Praktiken der „Vergangenheitsbewältigung“ deuten. Hanne Leßau macht am Ende ihres Buches zur Entnazifizierung den Punkt, dass es neben einer kritischen Vergangenheitsaufarbeitung, wie sie Adorno und andere Ende der 1950er Jahre stark machten, auch eine wenn man so will unkritische, aber gleichwohl ernsthafte Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gab.[7] Auch mit ihr wurde Distanz zum Nationalsozialismus behauptet und Demokratisierung vorangetrieben, was zu unreinen Übergangsprozessen führte, in denen die Demokratie nicht gegen, sondern auf Basis der Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus gemacht wurde. Ihnen genauer nachzugehen, birgt aus meiner Sicht noch einiges Potential für neue Thesen und Erkenntnisse sowohl für die NS-Geschichte, als auch für die Geschichte der Bundesrepublik.
[1] Claudia C. Gatzka: Die Demokratie der Wähler. Stadtgesellschaft und politische Kommunikation in Italien und der Bundesrepublik, 1944-1979, Düsseldorf 2019.
[2] Janosch Steuwer: Öffentliche Meinung. Elisabeth Noelle-Neumann: Die Schweigespirale (1974), in: Monika Wulz/Max Stadler/Nils Güttler/Fabian Grütter (Hg.): Deregulation und Restauration. Eine politische Wissensgeschichte, Berlin 2021, S. 104-125.
[3] Martin Conway: Western Europe's Democratic Age. 1945-1968, Princeton, Oxford 2020.
[4] Das von Claudia C. Gatzka geleitete Forschungsprojekt "Verborgene Stimmen der Demokratie. Politische Repräsentationen des 'Volkes' in der Bundesrepublik, 1945–2000" läuft noch bis 2024 und wird gefördert von der Gerda Henkel Stiftung im Rahmen des Förderschwerpunkts "Demokratie".
[5] Claudia C. Gatzka: Demos deluxe? „Das Volk” der Bundesrepublik vor und nach 1989/90, in: Marcus Böick/Constantin Goschler/Ralph Jessen (Hg.), Jahrbuch Deutsche Einheit 2022, Berlin 2022, S. 53–76.
[6] Philipp Ther: Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa, Frankfurt 2014.
[7] Hanne Leßau: Entnazifizierungsgeschichten. Die Auseinandersetzung mit der eigenen NS-Vergangenheit in der frühen Nachkriegszeit, Göttingen 2020.
Zitation
Alina Müller, Demokratiegeschichte und Zeitgeschichtsforschung. Eine Bestandsaufnahme mit Claudia Gatzka, Sonja Levsen, Benedikt Wintgens und Janosch Steuwer, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/demokratiegeschichte-und-zeitgeschichtsforschung