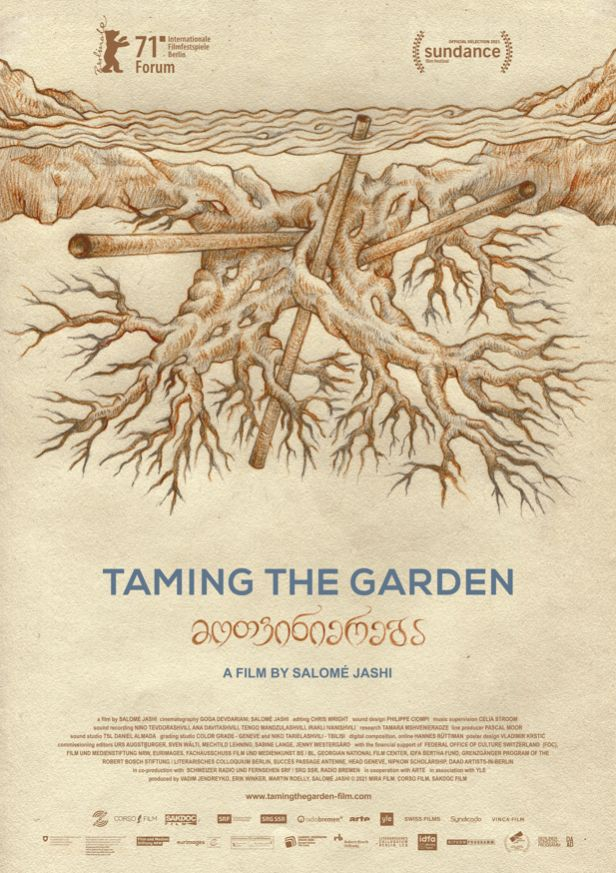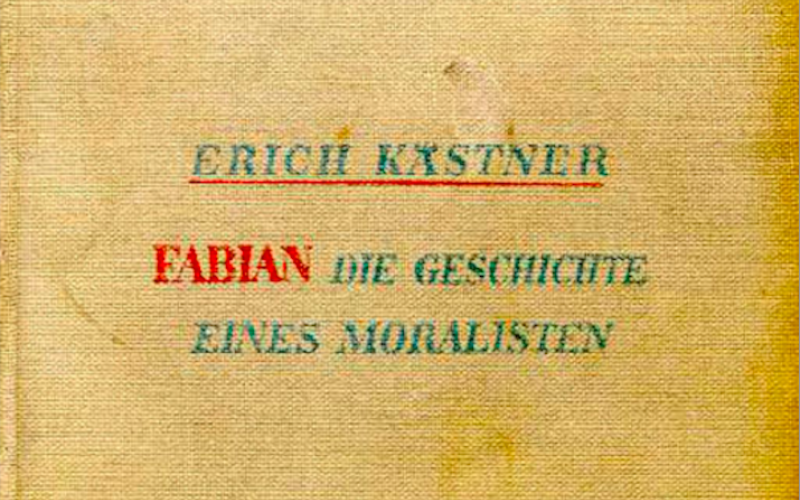Nach fast 90 Minuten fällt der Blick des Publikums endlich auf den beinahe mythischen Ort, der sich den Protagonist:innen dieses Films – Arbeitenden, Baumbesitzer:innen und deren Familien und Nachbar:innen – entzieht: eine Voliere, ein Bambusgarten und dann eine hügelige Landschaft, in der sich für einen möglichst natürlichen Eindruck wohlkomponiert aber Dutzende von Bäumen gruppieren. Dieser Park gehört dem Milliardär und ehemaligen Premierminister Bidsina Iwanischwili, der aus dem ganzen Land alte und imposante Bäume zusammentragen lässt. Während sich zuerst ein fast schon natürlicher Eindruck einstellt, der mich fast vergessen ließ, dass ich gut 80 Minuten zugesehen habe, wie diese Individuen ihrer angestammten Erde entrissen und verpflanzt wurden, fällt dann doch der Blick auf die Stahlseile, welche die Bäume fixieren und zwischen denen Arbeitende den Rasen mähen. Und dann beginnt auch noch die Sprinkleranlage ihren Dienst.
Mensch vs. Natur, Arm vs. Reich
Die georgische Dokumentarfilmerin Salomé Jashi folgt in Taming the Garden der Spur der Bäume und wirft dabei Fragen über das Verhältnis von Mensch und Umwelt, aber auch von Arm und Reich auf. Das Ungleichgewicht der Macht ist allenthalben zu spüren.
Zum einen ist da der Sammler mit seiner sozioökonomischen und politischen Macht. Er schickt seine Agent:innen durch das Land, um alte Bäume aus ihren angestammten Plätzen herauszulösen und in seiner Parkanlage zusammenzuführen. Die Besitzer:innen können nicht wirklich ablehnen, sie brauchen das Geld, ihre Ortschaft die versprochene neue Straße. Selbst ein Mann, dessen Bäume gefällt werden sollen, um den Transportweg freizumachen, und der gegenüber seiner Familie droht, die Arbeitenden Iwanischwilis gewaltsam aufhalten zu wollen, schaut den Arbeiten dann doch nur zu. Während einige die Vorteile des Geldes und der versprochenen Infrastruktur sehen, verknüpfen andere die Bäume, unter denen Generationen aufgewachsen sind und gespielt haben bzw. die einen praktischen Nutzen hatten, mit ihrer persönlichen und gemeinschaftlichen Identität. Teils wird nur das Smartphone gezückt, um das Schauspiel des Schwerlasttransports festzuhalten, teils fließen Tränen. Iwanischwili ist der Welt, aus der die Bäume stammen, weit entrückt. Man kann den Anwohner:innen dabei zuhören, wie sie über seine Motive rätseln, ins Mythische abdriften – so wird gemunkelt, er wolle mit den Bäumen sein Leben verlängern – und fürchten, um den versprochenen Lohn gebracht zu werden.
Zum anderen ist da die technische Bewältigung und Verfügbarmachung der Natur, wenn ein Baumriese mit 15 Meter Wurzelumfang aus der Erde gelöst und an seinen neuen Bestimmungsort transportiert wird. Jashi widmet diesen technischen Vorgängen in ihrem Film viel Zeit. Die Bilder und Töne dieser Arbeit entwickeln dabei ihre ganz eigene Faszination, ja fast schon Poesie. Die Einstellungen des Baums, der per Lastkahn auf dem schwarzen Meer transportiert wird, mit denen der Film eröffnet und zum Finale hinübergleitet wird, wirken surreal und überwältigend. Würde das Standbild an einer Museumswand hängen, ich würde sofort glauben, dass sich dies nur ein:e Künstler:in ausgedacht haben könnte. Insgesamt lässt sich für die Kameraarbeit Jashis und Goga Devdarianis festhalten, dass sie den Baum, dem zu Leibe gerückt wird, nur selten in der Totale zeigt. Obwohl er technisch von den Arbeitenden beherrscht wird, fängt die Kamera meist nur Ausschnitte von ihm ein, was seine Erhabenheit unterstützt.
Die Offenheit der Narration als Einladung ans Publikum
Jashi verzichtet auf einen Kommentar und lässt auch die Protagonist:innen nur wie beiläufig in ihrem Film zu Wort kommen, in kleinen intimen Einblicken, in denen sie untereinander im Gespräch sind. Sie verlässt sich darauf, dass die Bilder für sich sprechen, und lädt damit das Publikum zum produktiven Mitdenken ein. Dabei entzieht sich der Film geschickt einer einfachen Schwarz-Weiß-Logik.
Nach all den von Baggern aufgerissenen Narben in der Landschaft, nach all den abgesägten oder gestutzten Bäumen, lassen die Bilder der Parkanlage, unterlegt mit dem französischen Renaissance-Chanson Le chant des oyseaux, die Schönheit dieses moralisch fragwürdigen Ortes zu. Ästhetik und Moral haben ein schwieriges Verhältnis. Mit diesen Bildern und denen der technischen Umsetzung des Vorhabens sowie dessen sozialen Implikationen lässt Jashi ihr Publikum alleine, das sich so vor dem Hintergrund des in unserer Zeit immer stärker wachsenden Bewusstseins für ökologische Fragen selbst positionieren muss.
Dabei erscheint mir erstaunlich, wie sehr sich das Thema des Films meinem Erfahrungshorizont zu entziehen scheint. Der Transport des Baumes in Taming the Garden war sicher nicht der erste Schwerlasttransport, den ich gesehen habe. So musste ich etwa an die Versetzung einer Kirche, die einem Braunkohletagebau weichen musste, denken, jedoch fiel es mir äußerst schwer, diesen Bezug in meinen Gedanken festzumachen.[1] Während die Kirche als identitätsstiftendes Baudenkmal einer Gemeinschaft gesichert werden sollte, was ich nachvollziehen kann, werden hier Bäume unter erheblichem finanziellen und technischen Aufwand aus ihrem natürlichen und gemeinschaftlichen Kontext gerissen, um sie einer Einzelperson zuzuführen. Dieser Vorgang entzieht sich wahrscheinlich nicht bloß meiner Vorstellungswelt. Somit mag der Film durchaus erhebliches kritisches Potenzial gegenüber einer Elite haben, die sich in diesem Fall wie Aristokrat:innen vor einigen hundert Jahren einen riesigen Park mit majestätischen Bäumen füllt, oder in anderen Fällen an Stelle des Staates oder von Staatenverbünden nun die Raumfahrt privatisiert. Dieses kritische Potenzial muss jedoch jede:r Zuschauer:in in sich selbst finden.
Die Distanz zwischen der normalen Lebenswelt des Publikums und der Welt dieser Superreichen, die solch ein Projekt verwirklichen können, mag auch begründen, warum die Kritiker:innen nach der Weltpremiere von Taming the Garden auf dem Sundance Film Festival Ende Januar 2021 oftmals auf fiktionale Bezüge zurückgriffen. Jordan Raup erinnerte der sich des nachts seinen Weg bahnende Baum an den Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park, ein Vergleich, der mir im Vorherein abwegig, beim Schauen des Films aber erstaunlich adäquat erschien.[2] In ihrer Kritik für Variety führte Jessica Kiang gleich mehrere Referenzen an: die Ents genannten Baumhirten aus J. R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe, das gestrandete Dampfboot aus Fitzcarraldo und die einen Fluss hinuntertreibende Kirche aus Glas aus Peter Careys 1988 erschienenen Roman Oscar and Lucinda.[3] Die Erinnerung an Tolkiens Ents wurde in mir mit dem Schluss nochmals verstärkt: Während in der Schlacht um Isengard die Orks des bösen Zauberers Saruman die Baumhirten mit Seilen zu Boden reißen, um sie zu zerhacken, hält der Milliardär die Bäume in seinem Park mit Stahlseilen gefangen. Das zahlreiche und einfache Auftauchen solcher Referenzen erscheint mir nicht weiter verwunderlich. Das Vorhaben Iwanischwilis ist zwar real, für das Publikum jedoch genauso fern wie Science-Fiction- und Fantasy-Welten.
Der perfekte Film für die Open Air Berlinale
Nachdem zum eigentlichen Berlinale-Termin im Februar dieses Jahres pandemiebedingt nur Vorführungen für das Fachpublikum stattfanden, wurde Taming the Garden nun am Haus der Kulturen der Welt am Rande des Berliner Tiergartens im Open Air Kino aufgeführt. Jashi bezeichnete sie als erste Aufführung vor Publikum sogar als „eigentliche Premiere“. Die Umstände waren diesem Film in meinen Augen ganz besonders zuträglich: Dass beim Herauszoomen des Blickes aus der Leinwand Bäume vor Ort vor mein Auge traten, dass ich den Wind des lauen Berliner Sommerabends auf meiner Haut spürte, während sich die Blätter des Baumes auf der Leinwand ebenfalls im Wind bewegten, erzeugte eine Unmittelbarkeit, die der dunkle Kinosaal am Potsdamer Platz oder Alexanderplatz nicht geboten hätte. So steigerte sich die Wirkung dieser kleinen Perle von Dokumentarfilm noch einmal, die mich mit einem Mix an Gefühlen zurücklässt, weil Taming the Garden zugleich pervers und schön ist, Erhabenheit und Abgründe aufzeigt. Gerade die zurückhaltende Erzählhaltung Jashis lässt ihn dabei zum Denkanstoß werden.
Taming the Garden, Regie: Salomé Jashi
Schweiz, Deutschland, Georgien 2021, Laufzeit: 90 Min.
Produktion: Mira Film, CORSO Film und Sadoc Film, Hompage.
[1] Vgl. etwa Decius, Überführung der Emmauskirche von Heuersdorf nach Borna, Oktober 2007, [zuletzt abgerufen 20. Juni 2021].
[2] Vgl. Jordan Raup, Sundance Review: Taming the Garden is an Evergreen Look at Gratuitous Wealth, in: The Film Stage, 31. Januar 2021, [zuletzt abgerufen 20. Juni 2021].
[3] Vgl. Jessica Kiang, ‘Taming the Garden’ Review: A Bewitching Doc Turns a Billionaire’s Whim Into a Mythic Tale of Human and Nature, in: Variety, 28. Februar 2021, [zuletzt abgerufen 20. Juni 2021].
Zitation
Julius Redzinski, Das Märchen vom Bäume sammelnden Milliardär. Zum Dokumentarfilm „Taming the Garden“ von Salomé Jashi, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/das-maerchen-vom-baeume-sammelnden-milliardaer