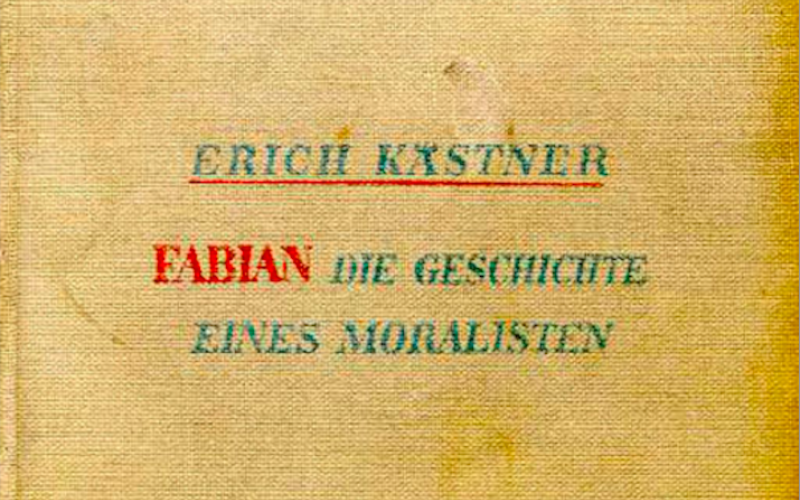Im Januar 1988 feiert Birgit Scherzers „Keith“ einen überragenden Erfolg an der Komischen Oper in Berlin. Für die junge Choreografin ist das Tanzstück der Durchbruch. Sieben Tänzer:innen treten in „Keith“ auf. Die meisten stammen aus „einfachen“ Verhältnissen und sind vom Staat zu Leistungsträgern ausgebildet worden. Als künstlerische Elite, deren Licht weit strahlt und die ein Aushängeschild für die DDR ist, dürfen sie in den Westen reisen. Ihre Familien in der DDR sind das Faustpfand. Die kreative Atmosphäre an der Komischen Oper bildet zunächst einen Schutzschirm vor ideologischer Bevormundung, doch Ende der 1980er-Jahre wird der Druck größer. In den Monaten vor dem Mauerfall – einem Ereignis, das niemand vorausgesehen hat – stehen viele Ensemblemitglieder vor der Lebensentscheidung, zu bleiben oder zu gehen.
Filmemacher Salar Ghazi suchte die Beteiligten auf, um die Ereignisse Revue passieren zu lassen und zu reflektieren. Erinnerungen und privates VHS-Material erzeugen ein komplexes Bild, welches das Lebensgefühl der Wendejahre lebendig werden lässt. Über berührende Interviews mit den Zeitzeug:innen zeigt der Film ein erfahrungsgeschichtliches Kaleidoskop der Tanzwelt an der Komischen Oper Ende der 80er Jahre.
zeitgeschichte|online: Was hat Sie motiviert diesen Film zu drehen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die außergewöhnliche Geschichte(n) dieser Gruppe von Tänzer:innen aus der DDR filmisch festzuhalten?
Salar Ghazi: Die Motivation war, dass ich die Geschehnisse am Rande mitbekommen habe, da ich damals die meisten Protagonisten kennengelernt habe. Das geschah durch einen reinen Zufall: Ein Schulfreund von mir war auf Klassenfahrt in West-Berlin, mit einem Tag Ausflug in den „Osten“. Er versuchte damals Verwandte in Ostberlin ausfindig zu machen, in dem Glauben, dass jeder in Ostberlin ein Telefone habe. Auf der Suche nach einem Telefonbuch oder einem Postamt hat er durch puren Zufall Birgit Scherzer kennengelernt. Zur selben Zeit bin ich nach Westberlin gezogen. Deshalb haben mein Schulfreund und ich Birgit öfter in Ostberlin besucht. Beim ersten Besuch erfuhr ich, dass Birgit Choreographin und Tänzerin ist. Für mich gab es kein Halten mehr als sie uns sagte, dass sie für ihre dritte Choreografie das Köln-Concert von Keith Jarrett verwenden würde, denn „Köln" war – und ist – eine meiner Lieblingsplatten. Nach der Premiere habe ich Birgits Flucht und das Auseinanderdriften der Gruppe mitbekommen. Das ist der Hintergrund.
zeitgeschichte|online: Und was war der Auslöser den Film zu machen?
Salar Ghazi: Es gab einen Anstoß für mich, sich letztendlich an diesen Film heran zu setzen. Der Auslöser war Guido Knopp. So seltsam das auch klingen mag.
Es war Sommer 2007. Ich wurde von zwei Autoren angesprochen, ob ich nicht bereit wäre für sie eine Dokumentation zu schneiden, die sie Guido Knopp anbieten wollten. Darauf meinte ich so: „Oh nein, Guido Knopp, auf gar keinen Fall“. Aber die beiden Autoren meinten: „Nein, wir wollen es diesmal anders machen. Wir wollen nah beim Dokumentarfilm sein. Wenig Kommentar, ausführliche Interviews mit den Zeitzeugen.“
Dann traf sich das Team zu einer Vorbesprechung, ich war im Grunde bereits für den Schnitt auserwählt. Jedenfalls schickte Guido Knopp einen seiner Mitarbeiter. Die beiden Autoren hatten auf eigene Faust in Tel Aviv gedreht. Vor laufender Kamera erzählt der Zeitzeuge und Überlebende Josef Rosenbaum unter Tränen, wie seine kleine Schwester in seinen Armen verhungerte. Die Reaktion des Knopp Mitarbeiters war: „Der heult doch. Warum gehen sie mit der Kamera nicht näher ran?“ Originalton. Niemand schien geschockt. Alles wurde nur darauf abgeklopft: Was ist die Show? Wo kann man möglichst viel Heulen und Herzeleid reinbringen? Und nachgestellte Szenen waren bereits beschlossene Sache. Ob man dafür nicht in Polen drehen sollte, weil die es dort wegen der Arbeitszeit der Kinderdarsteller (für die nachgestellten Szenen) nicht so genau nähmen?
Den Autoren wurde später der Stoff richtig weggenommen. Und der Müll – anders kann man es nicht bezeichnen – lief dann später als „Die Odyssee der Kinder“ zum 70. Jahrestag der Reichskristallnacht 2008.
Nach dieser Vorbesprechung war ich am selben Abend in einer Tanzaufführung vom „Tanz im August“. Ein tolles Stück von Akram Khan. Sein Mit-Tänzer war Sidi Larbi Cherkaoui mittlerweile ebenfalls ein sehr bekannter Choreograph. Die beiden performten an diesem Abend ein umwerfendes Zwei-Personen-Stück, das sich „Zero Degrees“ nannte. Ich kam frisch aus der Besprechung heraus und saß nun in diesem Tanzstück, mit feuchten Augen, denn die einfachsten Mittel rührten mich zu Tränen. Ich habe mich geschämt, an diesem Guido Knopp Müll mitarbeiten zu wollen. Ich würde mich über so etwas nie entwickeln können. Am nächsten Tag habe ich das Guido Knopp Filmprojekt abgesagt und in der Folgezeit angefangen, Birgit und die Tänzer für „In Bewegung bleiben“ zu kontaktieren.
Ein großer Pate meines Films ist deshalb Eberhard Fechner, der den Stil der „Talking Heads“ entwickelt hat: Von „Nachrede auf Klara Heydebreck“ (1969) über „Die Comedian Harmonists“ (1976) und „Den Prozess“ (1984) über den Majdanek-Prozess, alle in diesem Stil.
Der Mauerfall wird oft auf effekthaschende Art und Weise behandelt und dargestellt. Deshalb war Fechners Stil für mich der bessere Ansatzpunkt. Ich wollte die Geschichten der Tänzer stellvertretend für den gesellschaftlichen Umbruch in der DDR erzählen. So wie „Die Comedian Harmonists“ von erzwungener Migration erzählen. Mir war von Anfang an vollkommen bewusst, dass das nicht verkauft werden würde, weil es an Sex, Crime und Tod mangelte. Und dass der Film deshalb auf eigene Kosten gemacht werden müsste, da die wenigsten Fernseh-Redaktion in den Geschichten der Tänzer den Tautropfen, in dem sich die Welt der DDR spiegelt, nicht erkennen würden. Ich bin mit einem besseren Fernsehen aufgewachsen: Eine tolle Fernsehdokumentation „Auftrag ausgeführt!“ (1982) von Roelof Kiers. Das Filmprotokoll zum 37. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima räumte mit dem Mythos auf, dass die Piloten des ersten Atombombenabwurfs unter Schuldgefühlen litten. Das war 1982.
Ich wollte den unaufgeregten Stil dieser Zeit, der trotzdem unterhaltsam ist, wieder zurückholen. Weil diese Stoffe immer mehr in einer fürchterlichen Formatierung – das ist das einzige Wort, was mir als Beschreibung dafür einfällt – und in einer Form der Überprofessionalisierung verwurstet wird.
zeitgeschichte|online: Alle Medien haben ja aber auch immer einen ästhetischen Anspruch, der nie vollkommen abgelegt werden kann. Form und Inhalt stehen nie bezugslos zueinander. Es ist eigentlich auch die Aufgabe von uns Historiker:innen sich mit diesem Verhältnis in Quellen auseinanderzusetzen. Wie sind Sie in ihrer Arbeit am Film damit umgegangen?
Salar Ghazi: Wegen der Methode der „Oral History“, im Grunde gar nicht.
Immerhin bin ich dadurch abgesichert, dass ich verschiedene Menschen, die zum Teil manchmal seit langer Zeit keinen Kontakt mehr zueinander hatten, zu den gleichen Ereignissen und Dingen befragt habe. Durch die meist übereinstimmtenden Aussagen war abgesichert, dass die Erzählung des persönlich Erlebten nah am Ablauf der Dinge war.
Als der Rohschnitt fertig war, habe ich ihn in meinem Bekanntenkreis herumgezeigt. Die Mehrheit arbeitet nicht bei Film und Fernsehen. Sie hatten eine ähnliche Reaktion: „Die Zeitzeugen kommen sehr natürlich ‚rüber‘ und das Erzählte wirkt authentisch.“ Ich habe mich gefragt, woran das liegt. Diese Natürlichkeit kommt wahrscheinlich daher, dass die Kameraeinstellung statisch ist und innerhalb eines Interview nicht geschnitten wurde. Was nicht stimmt. In seltenen Fällen musste ich einen Namen wegen der Persönlichkeitsrechte oder einen störenden Versprecher rausschneiden. Das entstandende Schnittbild wurde mit Hilfe eines Schnittprogrammes „gemorpht“. Das klappt aber nur als unsichtbarer Schnitt nur, wenn wenige Sekunden herausgenommen werden, denn die Körperhaltung ändert sich sehr rasch. Die Manipulation bleibt eingeschränkt.
Aber der übliche Weg, vor allem bei Fernsehreportagen, sind zwei Kameras, Schnitt in die Großaufnahme zur Verknappung, Verdichtung, Zuspitzung. Das bekommt der Zuschauer aber unbewusst mit. Deshalb wirkt mein Film authentisch, weil ein offensichtlich manipulierendes Mittel fehlt. Aber so „ehrlich“ ist das natürlich nicht, weil nun einmal eine Auswahl an O-Tönen erfolgte, das ist aber eine Binsenweisheit des Dokumentarfilms. Übrigens hat der Film in 139 Minuten 470 Einstellungen, dass macht rein rechnerisch eine durchschnittliche Einstellungslänge von 17 Sekunden - fürs Fernsehen öde.
Ich habe außerdem versucht die Verwendung von Archivmaterial zu vermeiden, bis auf die privaten VHS-Aufnahmen von Roland Gawlik. Die Kamera war damals aus dem Westen eingeschmuggelt. Ich hatte auch schlichtweg kein Geld für Archivmaterial, weil ich „In Bewegung bleiben“ aus eigener Tasche finanziert habe. Eine Minute Mauerfall starten ab 900€. Ich habe versucht andere Mittel zu finden.
Von all diesen manipulativen Eingriffen, die wir heutzutage in der Filmbranche kennen, ist das Re-enactment das schlimmste von allen. Der Flensburger Historiker Gerhard Paul merkte an, dass die Nationalsozialisten immer nachts in ihren Oldtimern zur Wannseekonferenz fahren. Als hätte die Konferenz heimlich im Verborgenen stattgefunden. Nein, natürlich nicht! Sieht aber schicker aus! Und suggeriert, dass die Bösen immer die anderen sind.
zeitgeschichte|online: Sie sind in Hamburg geboren und in Bonn aufgewachsen, also Westdeutscher und machen einen Erinnerungsfilm an die DDR – warum?
Salar Ghazi: Anfangs gab es bei mir eine große Faszination für die DDR. Ich hatte sogar kurz darüber nachgedacht, ob ich vielleicht sogar hinziehen soll, weil ich in der Zeit von 1988 bis zum Mauerfall dort eine ungekünstelte Warmherzigkeit erlebt habe. Alle, die in dem Film zu sehen sind, waren untereinander befreundet. Ich mochte diese Bescheidenheit, die im Westen ein bisschen verloren gegangen ist, sehr gerne. Irgendwann saß bei Klaus Dünnbier in der Küche, einem der Protagonisten, ein Typ, der aussah wie eine brüchige Figur: breitbeinig, mit Baskenmütze und verranzter Lederjacke. Die beiden dealten eine Autobatterie gegen eine Schinkenkeule. Nachdem der Typ gegangen war, habe ich Klaus gefragt, wer das denn gewesen sei. Ich dachte, er wäre vielleicht ein Bühnenarbeiter, denn er war ohne jedes aufgesetzte Gebaren, anders als viele Künstler im Westen. Klaus antwortete, der sei die „Nummer eins“: Roland Gawlik, Nationalpreisträger und erster Solo-Tänzer. Dessen Direktheit und Bescheidenheit merkt man Roland auch heute im Film noch an.
Ich hing in der Zeit in Westberlin in Kreuzberg fest, in dieser eingebildeten Punkszene. Ich hatte vor am Theater zu arbeiten, habe zu der Zeit an der Schaubühne ein Praktikum gemacht und empfand den Betrieb dort als abweisend und eingebildet. Das Empfinden hatte ich in Ostberlin an der Komischen Oper überhaupt nicht. Aber ich bin auch bernstein-heimelig leuchtende Inseln – die Wohnungen der Beteiligten, die Kantine der Deutschen Oper und die Kantine der Staatsoper – im tristen, grauen und piefigen Ostberlin abgelaufen. Deswegen war die Halbwertszeit meines Übersiedlungsgedankens nur von kurzer Dauer.
Noch als Zusatzinformation, weil mein Name die Vermutung mit anklingen lässt, dass ich ein „ethnologisches“ Interesse an den Deutschen haben könnte und es der Blick eines sogenannten „Ausländers“ ist. Mein Vater war iranischer Kurde und meine Mutter Deutsche. Meine Eltern haben sich jedoch früh getrennt und meine prägenden Kindheitserinnerungen habe ich bei meinem Großvater Alfred Gerstenkorn – so hieß er wirklich – in Hamburg-Moorfleet in seiner Autowerkstatt. Dort und am angrenzenden Bahndamm streunte ich herum. Ich spreche inzwischen leider kein Südkurdisch oder Farsi mehr. Das habe ich im Laufe der Zeit schlichtweg verlernt. Ich hatte Anfang der 2000er unter Deutschen ohne sogenannten Migrationshintergrund recherchiert. Sie hatten sich der PKK im türkischen Kurdengebiet angeschlossen haben, ähnlich der internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg. Mein Gesprächspartner begann auf Kurmandschi, ich musste ihn bitten, auf Deutsch zu wechseln. Kam nicht so gut, denn Kurmandschi war zu der Zeit offiziell verboten und auch wenn es offiziell wieder erlaubt ist, Repressionen sind einem sicher. Und natürlich ist es ein Statement, Kurmandschi zu beherrschen.
zeitgeschichte|online: Sie haben gerade erzählt, dass sie selbst als Zeitzeuge die Ereignisse um die Produktion „Keith“ und die Flucht(en) einiger Protagonisten live mitbekommen haben.
Salar Ghazi: Nicht wirklich live. Man darf nicht vergessen, dass ich nicht ständig da sein konnte. Das waren, glaube ich, fünfzehn Mark für ein Visum und fünfundzwanzig Mark Zwangsumtausch pro Tag. Eintritt in den Staatszirkus nannte man das. Das Geld hatte ich nicht. Außerdem schrien alle ihre Fluchtpläne nicht in die Welt hinaus.
Nachdem Birgit gegangen war, habe ich sie im Februar 1990 getroffen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es ganz genau war. Ich habe noch in Erinnerung, dass wir beide am Martin-Gropius-Bau standen. Es lag Schnee und wir guckten zum ersten Mal gemeinsam von Westberlin nach Ostberlin. Ein paar Tage später habe ich in Ostberlin Klaus getroffen. Wir saßen im Haus Ungarn in der ehemaligen Karl-Marx-Allee, heute Frankfurter Allee. Klaus wohnte damals in der Boxhagener Straße. Die privaten Gespräche, so wie es David Scherzer im Film schildert, fanden draußen, entweder im Trabi oder im Restaurant Haus Budapest statt, weil die Wohnung von Klaus verwanzt war. Aber auch im Restaurant saßen dann die Jungs mit ihren schlecht sitzenden Anzügen ein bisschen weiter weg. Ich habe nur noch diese Situation selbst im Kopf, aber die Gespräche nicht mehr, es ist 32 Jahre her.
Ich war noch immer sehr davon beseelt in der Großstadt ein neues Leben anzufangen. Ich hatte nicht das Empfinden dafür, wie es eigentlich ist, ein Leben aufgeben zu müssen. Hunger kannst du nur nachempfinden, wenn du wirklich gehungert hast. Und in dieser Situation ist es genauso gewesen. Aus meinem damaligen Unverständnis entstand später die Motivation, die Geschichten der Tänzer erzählen zu wollen.
Kai Uwe Kohlschmidt, Sänger der Band Sandow, hat das in einer Dokumentation, „flüstern & SCHREIEN“ (1988), deren zweiten Teil ich Mitte der 90er Jahre schnitt, die DDR gut auf den Punkt gebracht: „Das totalitäre System ist paradoxerweise mit jedem Nadelstich angreifbar. Jedes falsche Lächeln zu falschen Zeit ist schon ein Angriff auf das System. Jeder Witz ist ein Angriff auf das System. Und das dreht sich (im Westen) gut um. Dieses System absorbiert alles. Nimmt auch alles auf. Nichts schadet ihm.“
Gilt für mich noch heute.
zeitgeschichte|online: Sie berichten über ihre Erinnerungen. Inwiefern prägen ihre eigenen Erinnerung an diese Zeit den Film?
Salar Ghazi: Im Grunde fast gar nicht. Denn, wie ich bereits anfangs gesagt habe, ich war an den Entscheidungsfindungen nicht beteiligt. Aber Zeitzeuge dessen, was der Film erzählt, war ich damals nicht. Ich weiß noch, dass ich als Hilfskraft bei RIAS-TV Mario Perricones Flucht auf dem Newsticker mitbekommen habe.
Emotional teilte ich mit den Protagonisten Köln als Sehnsuchtsort. Als diese zum ersten Mal 1987 als Reisekader nach Köln fuhren, schlug Thomas Vollmer, einer der Tänzer, Birgit vor, das Köln-Concert von Keith Jarrett als Basis für eihre nächste Choreografie zu nehmen. Und Sven Grützmacher, ein weiterer Tänzer, beschreibt, wie er schweren Herzens Köln zurück in die DDR verlässt, und der Dom aus seinem Blickfeld verschwindet. Den Dom konnte ich, von dort wo ich aufwuchs, dem Rodderberg bei Bonn, an klaren Tagen am Horizont sehen. Ich bin oft hingefahren. Über das hauptstädtische Bonn gab es folgenden Witz: „Bonn ist zwar nur halb so groß wie der Friedhof von Chicago, aber dafür doppelt so tot“. Ich erinnere mich an eine Mitarbeiterin der Linken, mit der ich beim Warten auf die Bonn-Mehlemer Fähre ins Gespräch kam. Sie vermisste Mitte und Prenzlauer Berg, ich dachte, gleich geht sie ins Wasser.
Jedenfalls ist heute noch, gegen jede Erfahrung Köln für mich ein Sehnsuchtsort, so wie für die Tänzer damals.
zeitgeschichte|online: Aber im Prozess des Film-Schneidens haben Sie eine bestimmte, auswählende und prägende Rolle, wenn Sie als Regisseur und Editor die Narrationen zusammenzufügen.
Salar Ghazi: Genau. Es hat sehr lange, mehr als ein Jahrzehnt gedauert, den Film zu beenden. Denn durch meinen Job als Cutter kamen immer wieder andere Projekte dazwischen. Meistens in den Sommerferien startete ich die Anläufe, den Film zu schneiden. Aber in der Zeit reifte die Erkenntnis, möglichst wenig gestalten zu wollen.
In Reportagen und Dokumentationen geht man als Stilmittel gerne von Prämissen, einem Aufhänger aus, um die Zuschauer „mitzunehmen“, so nennt man das. Zum Beispiel „Die frustrierten Helden des Mauerfalls“, der „Schlaflose Mauerschütze“ oder so. Solche Aufhänger habe ich anfangs ausprobiert, „Die erfolgreichen Ossis im Westen“ mit der Schere im Kopf, was das dann doch einen Redakteur interessieren könnte. Oder der „polyglotte Ossi“. Alle zählen auf, wo sie überall in der Welt gewesen sind. Das war einmal der Anfang des Films. Jetzt ist die Szene im Abspann. Es wirkte immer gekünstelt und hat den Protagonisten nicht entsprochen. Ich war irgendwann einfach an einem Punkt, wo ich dachte, entweder ich stelle einfach nur die Interviews um privates gekürzt auf Youtube online, quasi als Oral-History Projekt. Das wären vielleicht pro Protagonist drei Stunden gewesen. Und daraus entstand wieder der Ehrgeiz, vielleicht bekomme ich die Oral History doch in einem abendfüllenden Dokumentarfilm hin.
Eine Analogie: Von Keith Jarrett, er kann leider wegen eines Schlaganfalls nicht mehr auftreten, heißt es, er sei ohne jede Vorbereitung in seine improvisierten Solo-Konzerte gegangen, quasi „blank“, leer. Er soll täglich, nur nach Noten, mit klassischer Musik geübt haben. Erst, wenn eine Aufnahme im Studio oder ein Konzert anstanden, hat er sich ins Improvisieren gestürzt. So ähnlich war es im Schnitt. Meine „Übungsnoten“ waren die wortwörtlich, mit allen „Ähs“ und „Ähms“ transkribierten Interviews, so um die 70 Stunden. Das waberte dann zehn Jahre in meinem Kopf herum und Schnitt sich als Rohfassung mit 165 Minuten innerhalb von sechs Wochen – was als Schnittzeit recht wenig ist, dennn meine Rohschnitte haben bereits einen ausgefeilten Ton, was viel Zeit kostet. Es blieben vom Sichten und Transkribieren einzelne Bilder im Kopf, von denen ich nicht mal wusste, warum sie hängen geblieben sind, sowie die Reste eines Traums beim Aufwachen. Aber zu meiner Überraschungen kamen sie ohne Mühe in den Film. Raymond stellt sich zum Beispiel nachts bei Proben in einer Freiluftbühne auf die Bänke und schaut in den Vollmond. Nur dieses Bild. Aber um diese Einstellung entstand eine ganze Szene, die im Jahre 2009 gedreht, die Sehnsucht des Jahres 1989 bebildert, in den Westen gehen zu wollen. Trotzdem wirkt der Film relativ streng strukturiert, Interviews treiben die Erzählung voran, so wie bei Eberhard Fechner. Er hat übrigens Karteikarten mit den Interviews hin und her geschoben, bis die Struktur des Films stand. Ich schnitt mehr „aus dem Bauch“ heraus. Zwei Ansätze, ähnlicher Stil.
Ich habe im Februar 2020 noch Stadtszenen von Berlin nachgedreht, um Aussagen zu illustrieren. Aber: Zehn Jahre waren bei der Umsetzung dieses zeitlosen Themas vergangen. Jetzt würden Zuschauer dabei sein, welche die DDR nur aus Geschichtsbüchern kennen. Dadurch brauchte es den Ansatz, mehr zu erklären, was die DDR war – Hintergründe der Kindheits- und Jugendschilderungen der Protagonisten. Diese Gespräche waren beim Drehen eigentlich nur zum „Lockermachen“ gedacht und um Vertrauen zu fassen, nun landeten sie als Exposition im Film. Ich habe das Glück gehabt, dass alle Protagonisten hervorragend ihre Vergangenheit reflektieren. Ich konnte mich von ihnen leiten lassen. Ich hatte lediglich die Aufgabe,– Wahrheit ist in diesem Zuge vielleicht der falsche Begriff – zu prüfen, dass nichts Falsches erzählt wird. Dass eine Aussage durch die anderen Aussagen abgesichert ist. Eigentlich war die größte Herausforderung, Ruhepunkte, kleine Inseln im Film zu bauen, so dass man das Gehörte sacken lassen konnte.
zeitgeschichte|online: Es ist wirklich beeindruckend, wie lange Sie an dem Projekt gearbeitet haben. Daran merkt man auch, inwiefern „In Bewegung bleiben“, das Sie aus eigener Tasche finanziert haben, für Sie ein Herzensprojekt ist. Der Film ist ein „Ein-Mann-Film“, an dem nur wenige andere Personen Hilfe leistend beteiligt waren.
Salar Ghazi: Ich habe den Film neben meinem Brotjob als Cutter gemacht, deshalb waren während des Schnitts 2020 18-Stunden-Tage häufig und durch die Pandemie wurden die Arbeitseinsätze beim Fernsehen nicht weniger. Obwohl wir in Laufweite leben, hat meine Lebensgefährtin Christina Kotzamani, mich über Wochen nicht gesehen. Christina ist Krankenschwester, aber bei den Aufnahmen in Chile und der Schweiz hat sie den Ton gemacht. Und Kirstin Mascher, eine Bekannte, die ebenfalls beim Sound geholfen hat, unterrichtet Französisch. Ich habe nie einen Führerschein gemacht. Mit Kirsten bin ich in ihrem Auto zu den innerdeutschen Orten gejuckelt: Essen, Schwedt, Neustrelitz, der Darß. Die beiden kommen also nicht aus der professionellen Ecke.
Um Geld zu sparen, haben wir, wo es ging, bei den Protagonisten gewohnt, zum Beispiel bei Raymond Hilbert in Santiago de Chile. Zehn Tage Dreh, danach haben wir uns mit einer Reise zu Pablo Nerudas Grab belohnt. Die einzigen dramaturgischen Berater waren Gert Anklam und Beate Gatscha, die beiden Musiker des Films.
Beide haben wenig filmische Erfahrung. Das Ende des Rohschnitts fiel in den ersten Lockdown, im März 2020. Beide hatten unfreiwillig Zeit, denn alle Konzerte waren auf einen Schlag abgesagt. Und Jazz und Weltmusiker haben eine hohe Selbstdisziplin. Beide üben täglich. Sie haben sich den drei Stunden Rohschnitt an zwei Tagen reingezogen, und dann telefonisch übermittelt, was sie vermisst haben, was verwirrt, was noch klarer erzählt werden muss.
Das ist im Schnitt üblich, man bekommt im Prozess durch die Konzentration auf Details Scheuklappen und braucht nach einiger Zeit den frischen Blick von außen.
zeitgeschichte|online: Über ganze zehn Jahre haben Sie die Interviews für den Film geführt?
Salar Ghazi: Nein, so lange war der Zeitraum der Dreharbeiten gar nicht. Von 2007 bis 2009 habe ich die Interviews geführt. Dazwischen gab es viel Leerlauf und andere Arbeiten. Der letzte Dreh war in Chile. Kurioserweise hängt in einer Szene mit Raymond Hilbert und seiner Tochter Millantu ein Kalender von 2007 im Hintergrund. Der hing dort schon seit zwei Jahren. Danach kam der Horror des Transkribierens, dann ruhte das Projekt erst einmal.
zeitgeschichte|online: Sie haben also knapp zwanzig Jahre nach den Ereignissen gedreht. Haben Sie in der Zeit der Dreharbeiten Kontinuitäten oder Veränderungen in den Erinnerungen Ihrer Interviewten wahrgenommen?
Salar Ghazi: Nein, nur Thomas Vollmer haben wir aus Zeitgründen zweimal zum Interview aufgesucht, vielleicht im Abstand von einem Monat. Dabei haben wir sehr darauf geachtet, dass er die gleiche Kleidung trägt. Kirsten ist beim zweiten Dreh noch los gesprintet und hat Blumen besorgt, denn die hübsch drapierte Vase des ersten Interviews war nun leer.
Es gab keine große Vorbereitung zu den Gesprächen, nur im groben, was besprochen wird. Dann haben wir uns getroffen, im Schnitt kamen 7 bis 8 Stunden Interview in zwei Drehtagen zusammen das war's. Danach haben wir uns nicht mehr gesehen. Auch weil viele in die Welt verstreut waren. Nur ein paar haben untereinander noch Kontakt.
Ich glaube auch, wenn diese Interviews erst jetzt 2021 gedreht werden würden, dass die Intensität und die Klarheit der Erinnerungen verblasst wären. Einschneidende Erlebnisse, sicher, aber der Alltag? Das habe ich gemerkt, als ich alle mit der Nachricht „Wir sind auf der Berlinale!“ überraschte und wir telefonisch wieder ins Gespräch kamen. Die Erinnerungen der DDR waren inzwischen mehr durch den BRD-Alltag übergelagert. Übrigens: Wer von mir damals, 2009 als Ballettschüler, kurz vor dem Abschluss gefilmt wurde, steigt nun bald aus dem Tänzerberuf raus. David Scherzer, damals 29, hat mit 35 aufgehört, das ist recht spät. Man könnte von heute aus rückblickend sagen, diese Interviews sind zur „Halbzeit“ geführt worden. Daher war damals zur „Halbzeit“ ein relativ guter Zeitpunkt, die Interviews zu drehen.
Was die Vorrecherche anbelangt, noch eine Bemerkung: Als ich mit den Dreharbeiten angefangen habe, kam gerade das Buch „IM „Tänzer“ – Der Tanz und die Staatssicherheit“ von Ralf Stabel heraus, in dem es um die Verwickelungen der Stasi mit der Staatsoper und der Komischen Oper geht. Die Hauptaussage des Buches von Tanzhistoriker Stabel war, dass die Stasi sich gut in der Staatsoper festsetzen konnte, die Komische Oper aber relativ lange ein Stasi-freier Raum geblieben sei. Für meine Interviews habe ich die Entscheidung getroffen, dass mich der Hintergrund, wer der befragten Protagonisten eventuell IM gewesen ist, nicht interessiert. Wobei es einen Protagonisten im Film gibt, bei dem es sehr wahrscheinlich ist, dass er als IM tätig gewesen ist. Aber der Zeitraum war sehr kurz, vom Juli 1989 bis Mauerfall. Natürlich haben alle Protagonisten nur ungern darüber gesprochen und sie wollten alle auch niemanden anschwärzen. Klaus Dünnbier spricht ja sehr offen über einen IM-Verdacht. Und der Verdächtigte antwortet ähnlich offen.
zeitgeschichte|online: Diese Offenheit merkt man dem Film auch sehr an. Als Zuschauerin habe ich eine sehr starke Intimität zwischen Ihnen als Regisseur und Fragendem und den befragten Tänzer:innen wahrgenommen. Bestimme Sachen erzählt man nicht jedem und vor allem keiner Person, zu der man selbst keine Vertrautheit hat. Ihre Protagonist:innen erzählen vor der Kamera teilweise sehr private, intime und auch schmerzhafte Erlebnisse.
Salar Ghazi: Dazu muss ich sagen, ich glaube, diese Intimität entstand weniger dadurch, dass wir uns kannten. Es war eher die Tatsache, dass ich keine kommerziellen Interessen zeigte und sagte: „Ich will eure Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, was dabei herauskommen wird, ob es jemals jemand zu sehen bekommen wird. Hier, diese Kamera habe ich gerade zu diesem Zweck angeschafft, das ist meine Freundin, die ist eigentlich Krankenschwester, die macht den Ton...“, wie eine Schüler-AG aus dem Geschichte-Leistungskurs. Das hat bei den Protagonisten die Offenheit ausgelöst. Weil sie spürten, dass sie nicht Guido Knopp-mäßig verwurstet und verhackstückt werden. Ich hatte Klaus Dünnbier bis zu seinem Interview Ewigkeiten nicht gesehen und danach wieder elf Jahre nicht. Bisher gab es das erwähnte Gespräch am Telefon – wegen der Pandemie – und leibhaftig sehe ich ihn erst wieder bei der Premiere am Samstag, den 12. Juni. Ach ja, noch ein irrer Zufall – der Feinschnitt war erst Ende Juli 2020 beendet. Wer läuft mir die nächste Nacht auf der Schönhauser über den Weg – Birgit! Auch sie hatte ich Jahre nicht gesehen - aber sie seit fast acht Monaten wortwörtlich täglich auf dem Schirm gehabt. Endgültig fertig war der Film erst Anfang März 2021. Eine Maus, kein Mischpult, aber 42 Tonspuren, die im Kino gut klingen müssen – das dauert ewig.
zeitgeschichte|online: Gerne würde ich auf eine Sache zurückkommen, die Sie im Berlinale Meets Gespräch zu Linda Söffker gesagt haben. Dort erläutern Sie, dass die klischeebehafteten Schwarz-Weiß-Erzählung der Wende-Zeit, die im öffentlichen Gedächtnis sehr stark verhaftet ist, Ihnen immer mehr aufstoßen. Inwiefern unterscheiden sich die individuellen Lebensgeschichten der Tänzer:innen von der offiziellen Erinnerungskultur an die DDR?
Salar Ghazi: Ich fange so an: Ich habe die Maueröffnung schlichtweg verschlafen. Das heißt, irgendwann als die Schabowski-Meldung kam und die Menschen die Grenze stürmten, lag ich schön brav im Bett. Ich arbeitete ja zu der Zeit am Theater und hatte eine Freundin zu Besuch, die damals in Bremen lebte. Am nächsten Morgen, dem 10. November, musste sie mit einer Mitfahrgelegenheit nach Bremen zurückfahren und ich zum Theater. Wir saßen morgens um acht Uhr in der U-Bahn von Kreuzberg, Schlesisches Tor bis zum Kurfürstendamm, wo die Mitfahrt-Zentrale und auch das Theater waren. Es war ein Morgen wie jeder andere auch. Mir ist nichts aufgefallen. In meiner Erinnerung habe ich nur eine Sektflasche bemerkt, die irgendwo herumlag. Mir ist auch jemand aufgefallen, der die Berliner Zeitung las, die titelte „Die Mauer ist auf“. Ich meinte nur zu meiner Freundin: „Schöner Gag“. Also zwei Leute, wir beide waren etwas verpennt und haben nichts geschnallt.
Ich sah also kein Konfetti, keine Betrunkenen oder Feiernden, rein gar nichts. Morgens um neun Uhr, am Morgen nach der größten Zeitenwende der Menschheit sozusagen, ein stinknormaler Morgen. Erst am Theater kamen sie mit feuchten Augen rein, die meisten hatten die Nacht durchgemacht. Die Bühnenarbeiter sagten: „Was eine geile Nacht!“ Und ich fragte: „Kann mich bitte einer einmal aufklären, was los gewesen ist?“
Die Warschauer Brücke, in deren Nähe ich wohnte, wurde erst am 10. November geöffnet. Da bin ich nach der Frühschicht im Theater hin. Zwei Schnösel haben Kaugummi an heulende Menschen verteilt, die zu höchstens zu zweit durch einen engen Durchgang konnten. Coca Cola war, glaube ich, auch da. Aber das kollektive Gedächtnis kennt halt nur die Bilder stürmender, jubelnder Massen!
Ich verdiene mein Geld beim Rundfunk-Berlin-Brandenburg, ein Job, der meine Filme finanziert. Dort bin ich mit diesen Bildklischees aus dem Archiv, mit fetter Musik darunter, konfrontiert. Es ist erstaunlich wie wenig einmal emotionalisiert wurde. Das sieht man ganz toll bei „Good Night, and Good Luck“ (2005) von George Clooney. Der Film zeigt hervorragend geführte ungeschnittene Fernseh-Interview über vier Minuten aus der McCarthy-Zeit. Der Zuschauer wurde als „mündig“ begriffen, wovon das Fernsehen inzwischen komplett abgerückt ist. Wenn ich mich recht entsinne, kam im in den 70ern der Begriff des Fernsehens als „Lagerfeuer“ auf, wenn nicht schon früher. Man erzählt sich Erlebtes, spinnt daraus Mythen und röstet dabei ein Stückchen Mammut.
zeitgeschichte|online: Was bleibt für Sie von der DDR?
Salar Ghazi: Ich kann diese Frage nicht beantworten, vielleicht, dass die Mentalität des autoritären, sozialistischen Staates in den Sympathien für die AfD weiterlebt. Ich habe meine 68er-Bubble. Pink Floyds „Us and Them“ war der Soundtrack meiner Kindheit. Meine Mutter war zwar kein Hippie, aber sie atmete mit vierzehn Jahren zum Kriegsende, die Freiheit, Punkt. Wer als Mann unwesentlich älter war, war versehrt. Ihren älteren Bruder zog es nach der Kriegsgefangenschaft nach Nicaragua, der hielt es nicht im Wirtschaftswunder aus, machte aber bei der dortigen Ford-Vertretung Karriere und kaufte nach der Revolution 1979 für die Sandinistas Landmaschinen im Bruderstaat DDR.
Back to the GDR: Anfang der neunziger Jahre habe ich in Schwerin bei dem dortigen Landesfilmzentrum gearbeitet, wo ich sehr stark die Umbrüche miterlebt habe, die einen, die Sahne abschöpften, die anderen die sich von ABM zu ABM gehangelt haben. Der resultierende Frust ist Binsenweisheit. Und die DDR war meiner Meinung ein Widerspruch in sich, utopisch und rückwärtsgewandt, die „DEMOKRATIE“ im Namen und totalitär im Alltag. Anspruch und Wirklichkeit stets konträr. Die Tänzer, zumeist aus „einfachen“ Verhältnissen, konnten, vom Staat und den Erziehern gefördert, mit einer kostenlosen, künstlerischen Ausbildung ihren Horizont erweitern. Wobei Roland als Ältester die Utopie noch am meisten geatmet hat. Kirsten, die Lehrerin, prägte bei den Autofahrten der Spruch: „Roland (der Älteste im Film) ist mit der DDR groß geworden, Birgit und die anderen sind in der DDR groß geworden.“ Und die stellten fest, sich in der DDR nicht entfalten zu können. Wenn du angeeckt bist, hast du Probleme bekommen, wohl jenen, die sich in der Masse angepasst haben. Aber daraus ist ein neuer Konservatismus entstanden, der unsere Gesellschaft beeinflusst.
zeitgeschichte|online: Verständlich. Ihre Antwort trifft ja momentan einen gewissen Zeitgeist. Leider.
Salar Ghazi: Das Glück des achtziger Jahre Zeitgeistes war dieses Schwarz-Weiße-Direkte: Kernenergie und nuklearer Holocaust, am besten ausgelöst durch einen defekten Halbleiterbaustein, gegen „Freie Republik Wendland“ und der „Umweltbibliothek“ bereits vor 1990 in beiden Teilen Deutschlands vereint im Slogan „Schwerter zu Pflugscharen“. Ich denke, in der DDR war man oft dazu gezwungen, Farbe zu bekennen. Wenn du im Osten Punk warst, warst du Punk mit allen Konsequenzen. Dieses „Farbe bekennen“ gibt es so heutzutage nicht mehr und manchmal reichte ein Auslöser.
Krzysztof Kieślowski hat es mit „Der Zufall möglicherweise“ (1987) auf den Punkt gebracht. Ein junger Mann verpasst den Zug nach Warschau, streitet sich daraufhin mit dem Bahnvorsteher, landet im Knast und wird zum Oppositionellen. Doch in einer alternativen Zeitlinie erreicht er den Zug und wird zum Parteikader. Damals gab es nur wenige Themen, ein Entweder-Oder. Und ein kleines bisschen Waldsterben, was natürlich ein Witz ist gegenüber dem, was jetzt auf uns zukommt, wenn wir weiterhin so bequem bleiben.
Die Weltpremiere des Films „In Bewegung bleiben“ findet am 12. Juni 2021, um 21:30 Uhr im Freiluftkino Hasenheide im Rahmen des Summer Specials der diesjährigen Berlinale statt. Eine weitere Vorstellung gibt es am 17. Juni 2021 um 21:30 Uhr im Kiez-Freiluftkino Friedrichshagen.
Zitation
Rebecca Wegmann, Zeitzeugen als Stilmittel. Ein Gespräch mit Filmemacher Salar Ghazi über DDR-Tanzgeschichten in Grautönen, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/zeitzeugen-als-stilmittel