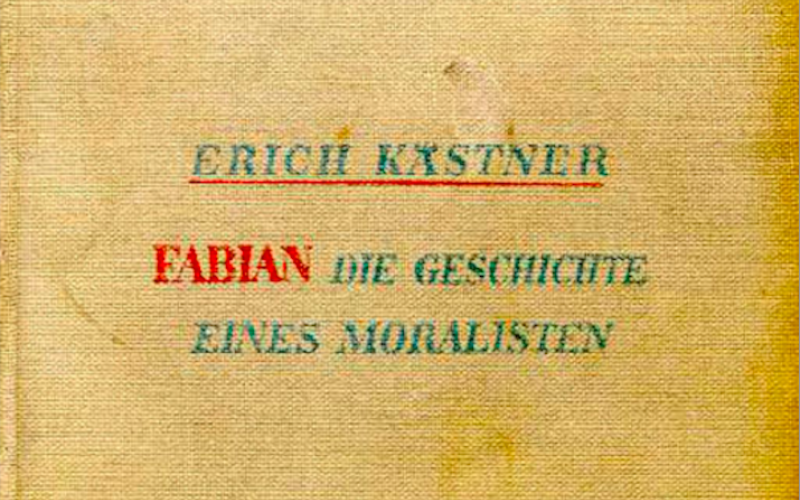Eine digitale Berlinale ist besser als keine Berlinale. Aber wenn man die 71. Ausgabe des Berliner Filmfestivals gedanklich noch einmal Revue passieren lässt, bleibt – trotz vieler sehenswerter Filme – ein fader Beigeschmack. Dabei geht es nicht nur um die Festivalstimmung, die in diesem Jahr zwangsläufig fehlte. Vor allem das halbherzige Online-Konzept der Berlinale hinterlässt ein zwiespältiges Gefühl.
Ohne Publikum
Dass die Berlinale in diesem Jahr kein normales Festival werden würde, war klar. Nur in Berlin wollte man das anscheinend nicht wahrhaben. Viel zu lange wurde das Festival als Präsenzveranstaltung geplant. Erst Mitte Dezember zog man die Reißleine und teilte das Festival auf: Zunächst eine digitale Ausgabe für die Branche und die Presse im März, Anfang Juni dann ein „nachgeholtes“ Sommer-Festival fürs Publikum. Es mag viele gute Gründe für diese Entscheidung gegeben haben, sie wirkt dennoch mutlos. Warum wurde das Publikum von der Online-Ausgabe ausgeschlossen? Gerade in Berlin, wo doch die Zuschauer*innen – ganz anders als in Cannes oder Venedig – viel stärker am Festival teilhaben? „Sind Sie sicher, die Leute wollen noch mehr Filme online gucken? Wenn sie das Festival vermissen, dann das Gefühl, etwas gemeinsam im Kino erleben zu können“, so Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter des Festivals, in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.[1] Dass die Sehnsucht des Publikums nach dem Kino der einzige Grund dafür gewesen sein soll, die virtuelle Ausgabe der Berlinale hinter geschlossenem Vorhang durchzuführen, darf man bezweifeln. Rechtliche Bedenken und vor allem die kommerziellen Interessen der Verleihe und Filmproduzent*innen dürften ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass die Berlinale den Schritt zu einem wirklichen digitalen Festival gescheut hat.
Vertane Chance
Bei einem Online-Festival besteht immer die Gefahr, dass Filme nicht für eine Premiere freigegeben werden, weil eine spätere Kinoauswertung weniger lukrativ erscheint. Vor allem bei hochkarätigen Hollywood-Produktion dürfte dies der Fall sein. Allerdings kämpft die Berlinale schon seit vielen Jahren damit, prestigeträchtige Filme als Weltpremieren für den Wettbewerb zu gewinnen. Und der gezielte Ausschluss des Publikums von der Online-Ausgabe in diesem Jahr hat dieses Problem nicht beheben können, im Gegenteil: Zum ersten Mal überhaupt hat es kein einziger englischsprachiger Film in den Wettbewerb des Festivals geschafft. Es spricht daher vieles dafür, dass die Berlinale in diesem Jahr die Chance vertan hat, sich mit einer selbstbewussten, offensiven Online-Strategie stärker als eigenständiger Akteur in einem digitalen Umfeld zu behaupten. Gerade ein Festival, das sich nicht nur der etablierten Filmkunst verschrieben hat, sondern jungen und innovativen Regisseur*innen ein öffentliches Podium bieten will, hätte den Mut haben müssen, seine sehenswerten Filme auch für ein internationales Publikum online sichtbar zu machen.
Viele andere Festivals haben diesen Weg zuvor mit Erfolg beschritten, angefangen bei den Internationalen Kurzfilmtagen im Oberhausen, die bereits im Mai 2020 aus der Not eine Tugend machten und mit einem Online-Festival ganz neue Wege einschlugen. Und auch in Saarbrücken, Mannheim oder bei der hybriden Ausgabe von DOK Leipzig wurde das internationale Publikum über das Internet eingebunden, stets mit dem gleichen Ergebnis: Den Festivals ist es gelungen, größere Aufmerksamkeit für Filme zu erzeugen, die es im Kino – auch unabhängig von Corona – sehr schwer gehabt hätten, ein Publikum zu finden. Die Berlinale hatte viele sehenswerte Filme im Programm, denen es in diesem Jahr notgedrungen an Aufmerksamkeit mangeln wird. Journalist*innen allein können die Mund-zu-Mund-Progranada, die erst durch das Publikum entsteht, nicht ersetzen, zumal auch die Berichterstattung über das diesjährige Festival deutlich schmaler ausgefallen ist als in den vergangenen Jahren. Die Gefahr, dass einige Filme schnell wieder von der Bildfläche verschwunden sein werden, ist groß.
Ein gutes Beispiel hierfür sind die Regisseure Ramon und Silvan Zürcher. Vor acht Jahren, auf der Berlinale 2013, entwickelte sich ihr ungewöhnliches Spielfilmdebüt „Das merkwürdige Kätzchen“ zu einem Geheimtipp des Festivals. Der Film war schnell in aller Munde und fand großen Zuspruch bei den Kritiker*innen wie auch beim Publikum. Anschließend war er auf diversen weiteren Festivals zu sehen; auch eine kleine, aber beachtliche Kinoauswertung folgte. In diesem Jahr waren Ramon und Silvan Zürcher mit ihrem neuen Film „Das Mädchen und die Spinne“ auf der Berlinale zu Gast – wiederum ein großartiger, experimentierfreudiger Film, der mit einer eigenwilligen Bildsprache von der Fragilität zwischenmenschlicher Beziehungen erzählt und zurecht mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde (Beste Regie im „Encounters“-Wettbewerb). Aber ob nun ein ähnlicher Erfolg gelingen wird wie bei „Das merkwürdige Kätzchen“ vor acht Jahren? Hoffentlich, aber die Chancen stehen nicht gut, denn es gibt kein Berlinale-Publikum, unter dem sich herumsprechen könnte, wie sehenswert der Film ist. Niemand kann ihn sehen. Wäre er online verfügbar gewesen, wäre die Chance für ein breiten Erfolg um ein Vielfaches größer.
Jenseits von Netflix und Co.
Natürlich möchten alle Regisseur*innen, die viel Zeit und Liebe in die künstlerische Gestaltung ihrer Filme investiert haben, dass sie unter bestmöglichen Bedingungen im Kino wahrgenommen werden, nicht auf einem Smartphone oder einem Tablet. Aber die Sehgewohnheiten des Publikums ändern sich ebenso rasant wie die digitalen Verwertungsketten der Filmindustrie. Wer sich allein auf das Kino als Ort des kulturellen Austauschs verlässt, ist hoffnungslos romantisch. Denn gerade die kleinen, künstlerisch anspruchsvollen Filme werden es in Zukunft, wenn die Kinos wieder geöffnet sind, noch sehr viel schwerer haben, ihr Publikum zu finden. Schon lange vor Corona litten die Kinos unter einem Überangebot an Filmen. Viele verschwanden schon nach ein oder zwei Wochen wieder aus dem Programm, andere kamen gar nicht erst ins Kino, weil sie keine Aussicht auf einen kommerziellen Erfolg hatten. Die Situation wird sich noch weiter verschärfen, weil es viele kleine Kinos gibt, die die Durststrecke der Pandemie wohl nicht überleben werden. Den größeren Kinos droht hingegen eine Schwemme von Filmen, die die Verleihe seit Monaten zurückhalten.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung erscheint eine Online-Auswertung für künstlerisch anspruchsvolle Filme schon lange nicht mehr als zweite Wahl, sondern als wichtige Alternative zum Kino. Am Ende geht es bei der Konkurrenz zwischen Festivals und Netflix und Co. nicht um die Frage, ob die Zuschauer*innen „noch mehr“ Filme online sehen wollen, sondern darum, welche Filme sie überhaupt sehen können. Wer sich auf den Wühl- und Grabbeltischen der großen Streaming-Portale nach spannenden Entdeckungen umsieht, stößt mit den dortigen Algorithmen schnell an Grenzen. Es braucht kenntnisreiche Kurator*innen, die aus der Vielzahl der durchschnittlichen Produktionen auf dem internationalen Markt die wirklich sehenswerten Filme auswählen und für ein interessiertes Publikum zur Verfügung stellen. Wer könnte diese Rolle besser wahrnehmen als die Filmfestivals, die über die Übersicht und die Kompetenz verfügen? Und welches Festival in Deutschland könnte dabei ein möglichst großes Publikum erreichen, wenn nicht die Berlinale?
Hoffen auf den Sommer
An Potential für ein spannendes Online-Angebot hätte es der Berlinale in diesem Jahr nicht gemangelt, im Gegenteil. Das stark ausgedünnte Programm wirkte so präzise und klug kombiniert wie selten in den Jahren zuvor. Auch für historisch interessierte Zuschauer*innen waren spannende Entdeckungen dabei. Dominik Grafs eigenwillige Kästner-Verfilmung „Fabian“ zum Beispiel, die bei der Preisverleihung leider übergangen wurde. Oder Julian Radlmeyers „Blutsauger“, ein marxistischer Vampirfilm, der auf den Spuren von Sergej Eisenstein und Dsiga Vertow wandelt. Oder „Természetes fény“ („Natürliches Licht“) von Dénes Nagy aus Ungarn, der von der Verfolgung sowjetischer Partisanen im Zweiten Weltkrieg erzählt. Viele Filme aus dem Programm wären es zweifellos wert, auch hier näher beleuchtet und im Hinblick auf ihre Geschichtsinszenierungen kritisch hinterfragt zu werden – wenn sie denn für das Publikum zugänglich sind.
Die Hoffnungen des Festivals ruhen daher nun auf dem Sommer. Vom 9 bis 20. Juni will die Berlinale mit einem Sommerevent ihr Programm öffentlich machen. Ob und in welcher Form die Pandemie dies zulässt, wird sich zeigen.
[1] „Nicht optimal, aber die bestmögliche Lösung“. Interview mit Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. In: Der Tagesspiegel, 23.2.2021, (zuletzt: 9.3.2021).
Zitation
Andreas Kötzing, Festival ohne Fest. Die 71. Berlinale fand als industry event digital statt, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/festival-ohne-fest