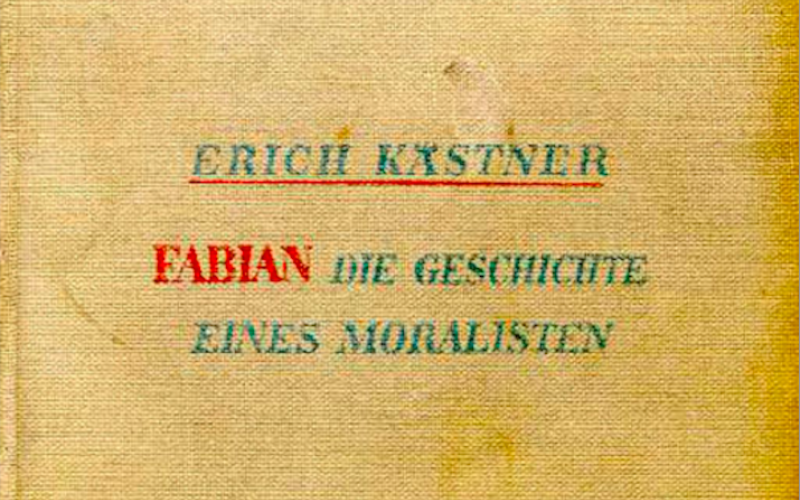Die ersten Bilder sind zwar kaum überraschend, aber auch ikonisch: Eine schwarze Frau fortgeschrittenen Alters singt und schreit mit kraftvoller Stimme und vollführt charakteristische Moves, die das ebenso verschwitzte Publikum in Ekstase versetzen. Kurz darauf hören wir aus dem Off melancholische Klaviermusik und die eben noch unerschütterlich wirkende Tina Turner: „It wasn't a good life.“
Schon in den ersten drei Minuten ihrer biografischen Dokumentation „Tina“ etablieren die Macher Dan Lindsay und TJ Martin bereits alle Motive und Narrative, die dem Publikum in den folgenden fast zwei Stunden (aufgeteilt in fünf Kapiteln) in immer neuen Variationen präsentiert werden: race/gender, Rock und Befreiung. Wie aus ihren Vorgängerwerken – etwa Undefeated (2011) und LA 92 (2017) – gewohnt, setzen Lindsay und Martin auf eine beeindruckende Menge an Archivmaterial aus sieben Jahrzehnten und Interviews mit Wegbegleiter*innen sowie mit Tina Turner selbst. Auf eine Erzählstimme und Re-Enactment wird lobenswerterweise weitgehend verzichtet. Bei „Tina“, soviel sei bereits gesagt, handelt es sich recht deutlich um ein Auftragswerk: Erwin Bach, Ehemann von Tina Turner, agiert als ausführender Produzent und auch die Interviewees äußern sich allesamt im Sinne seiner Frau. Dennoch ist „Tina“ mehr als einen Imagefilm für eine der großen Marken der Popmusik.
Ike und Tina
Ohne radikal Neues zu erzählen, zeigt der Film wie die 19-jährige Sängerin Anna Mae Bullock aus Tennessee durch die Bekanntschaft mit Ike Turner Anfang der 1960er Jahre Teil der Band „Ike & Tina“ wurde. Ike schuf für Bullock das Image „Tina Turner“ und zeigt sich für die musikalische Entwicklung der Band verantwortlich. Bis 1976 gelangen ihnen eine Reihe von Hits und beeindruckenden Auftritten, wobei insbesondere die Performances von Tina Turner ikonisch werden sollten. Schon früh war diese zunächst musikalische dann auch intime Beziehung durch extreme sexualisierte Gewalt durch Ike Turner geprägt.
„I didn't exist but I survived" fasst die Sängerin selbst diesen Abschnitt ihres Lebens zusammen, der 1976 mit einer Scheidung endete und von der ihr ökonomisch nichts blieb außer der Marke „Tina Turner“. Ihre anschließenden Comeback-Versuche stockten – nicht zuletzt, weil sie zunächst nur als eine der Hälften von „Ike & Tina“ wahrgenommen wurde. Auch aus diesem Grund entschied sich die Sängerin 1981 für ein Interview mit dem People Magazine, das den narrativen Angelpunkt des Filmes darstellt. In dem Gespräch äußerte sie sich detailliert zur damals noch nicht öffentlich verhandelten Brutalität ihres Ex-Ehemanns.
Tina ohne Ike
Im Verlauf der 1980er Jahre gelang Turner dann Unwahrscheinliches: Sie erfand sich als Rockerin neu und feierte globalen Erfolg; im von sexistischen Strukturen geprägten Pop-Business für Frauen jenseits der 40 nahezu unmöglich. Im Abschluss des Films lernen wir dann vor allem das Schweizer Schloss von Turner und Ehemann Bach genauer kennen und erfahren vom Tina-Turner-Musical und dem Einfluss, den sie auf andere Künstlerinnen hatte. In diesen Momenten schrammt der Film gefährlich an einer Art Werbevideo vorbei, das die zuvor thematisierten Krisen in ein Happy End überführt.
Das Thema race wird nur an sehr wenigen Stellen explizit angesprochen, wodurch Potenzial verschenkt wird. Denn die (pophistorische) Bewertung der Figur Tina Turner und ihrer Performances ist nicht unumstritten. Die feministische Theoretikerin bell hooks etwa kritisiert das öffentliche Bild Turners als das Produkt der männlichen Imagination Ike Turners.[1] Der Film bestätigt diese Fantasien und ihre Verbindung zu Serien wie Sheena: Queen of the Jungle. Während die „Charme School“ der Soul-Gruppe The Supremes in der ersten Hälfte der 1960er Jahre noch auf subtile Weise Vorstellungen des Schwarzen weiblichen Körpers zu unterlaufen oder zumindest aufzuweichen versuchte,[2] würden laut bell hooks Image und Bühnenperformanz von „Tina Turner“ ethnisches und sexuelles Anderssein hervorbringen und perpetuieren.[3] Dieses Bild der „wilden“ Frau diene, so die feministische Kritik, gleichzeitig als Grundlage der auch körperlichen Maßreglung durch Männer.[4] In der Tat zeigt sich in der Geschichte von Tina Turner, so wie sie auch der Film zeichnet, eine merkwürdige Spannung ab: Hinter der Bühne und direkt vor den Auftritten misshandelt Ike Turner seine Ehefrau regelmäßig und aufs Brutalste; im Konzert und vor den Fernsehkameras aber führte sie ein Bild der Freiheit und Unkontrollierbarkeit auf. Darauf, wie genau Tina Turner selbst diese Paradoxie bewertete, aushielt oder verarbeitete, geht der Film leider kaum ein.
Die Dokumentation stellt die Appropriation ihres eigenen Namens im Zuge der Scheidung Mitte der 1970er als empowernden Triumph dar. Allein das von Ike Turner kreierte Image blieb bestehen. Szenen aus den 1980er Jahren zeigen einen Pop-Sängerin, die sich weiter mit dem Dschungel assoziierte visuelle Elemente, wie die Löwenmähne, einverleibt. Auch deswegen argumentiert bell hooks gegen die erfolgte Befreiung der Turner aus der rassistisch-sexistischen Matrix der amerikanischen Kultur.[5] Gleichwohl lesen andere bereits Turners frühe Auftritte als ausufernde Über-Performanzen einer „Diva“, die etablierte Rollenbilder durch Identifikationsüberschuss herausfordert.[6] Kurz gesagt: Die Diva Turner sprengte soziale Rollen, wodurch sich eine queere Lesart ermöglicht.
Generell gelang es Tina Turner nicht, sich von den sie leitenden Männern zu lösen. Sie betont selbst, sich immer nur nach einem starken, sie nicht dominierenden Mann gesehnt zu haben. Es mutet einem Treppenwitz der Geschichte an, dass es ausgerechnet der Frauenschläger und -mörder Phil Spector war, der Tina Turner Mitte der 1960er Jahre als Produzent erstmals die Möglichkeit gab, zu singen, was sie selbst wollte, indem er ihren Partner Ike vom Studio fernhielt. Aus der Abhängigkeit von Ike Turner entkommen, wird die Sängerin nun von ihrem Manager Roger Davies zu Schritten überredet, die sie eigentlich nicht will. Dazu gehört etwa die zusammen mit dem Musikjournalisten Kurt Loder geschriebene Autobiografie „I, Tina“, auf deren Grundlage der von Turner ebenso verschmähte Film „What's love got to do with it?“ (1993) entstand. Zum Einsingen des gleichnamigen Welthits musste Turner wiederum von ihrem Produzenten geradezu gezwungen werden, weil die selbsternannte Rock-Musikerin keine Pop-Songs singen wollte.
Bekannte Pfade des dokumentarischen Biopics
„I'm a rock 'n' roller“ betont Turner wiederholt und unterstreicht damit ein weiteres Narrativ der Dokumentation. Um diesen Erzählstrang zu stützen, wird im Film etwa auf den Song „Rocket 88“ (1951) von Ike Turner verwiesen, der als eines der ersten Rock 'n' Roll-Stücke gilt, als auch auf die erfolgreiche Single „Proud Mary“ (1971) von Ike & Tina Turner, den die beiden von der Rockband Creedence Clearwater Revival coverten. Zudem betonen die Interviewten immer wieder, wie sehr die Sängerin auf und hinter der Bühne für ihre Karriere malochen musste. Hier fährt der Film in bekannten Fahrwassern anderer Biografien: Harte Arbeit, Selbstvertrauen und die Liebe zum Rock führen zum Erfolg. Noch immer steht Rock für emotionales und performatives Ausbrechen, verspricht sowohl den Musiker*innen als auch Fans Emanzipation und Authentizität. Das Idealbild der „Rockerin“ Tina Turner soll in diesem Sinne eine selbstbewusste, sich selbst befreiende Frau repräsentieren, die sich gegen die Gewalt und Zwänge der Männer- wie Popwelt zu behaupten weiß und für ihre Stärke und Ehrlichkeit belohnt wird. Dabei übergeht der Film geflissentlich, dass Turner letztlich weiterhin den Mechanismen des Musikmarkts gehorchen muss und von Männern geschriebene und produzierte Pop-Songs singt.
Turner und die beiden Filmemacher selbst wollen kein Bild einer feministischen Ikone zeichnen. Ein couragierteres und explizites Eingehen auf Themen wie Sexismus und Rassismus hätte dem Film gutgetan. So kommt er als glänzendes, aber auch ziemlich konventionelles Produkt daher, das insgesamt zu sehr auf Nummer Sicher geht. Die Rezensenten hätten sich jedenfalls mehr Mut zur Komplexität gewünscht, freilich ohne sich beim Gucken gelangweilt zu haben.
Tina, Regie: Dan Lindsay & TJ Martin, USA 2021, 118 Minuten
Der Film Tina läuft im Rahmen des Berlinale Summer Specials am 10. Juni um 21:45 im Freiluftkino Friedrichshain sowie am 12. Juni um 21:45 im Freiluftkino Biesdorfer Parkbühne und im Freiluftkino Friedrichshagen.
[1] Bell Hooks, Black Looks. Reace and representation, Boston 1992, S. 67-69.
[2] Martin Lüthe, Dancing in Heels. Motown und die Performanz schwarzer Weiblichkeit in der Popkultur der 1960er Jahre, in: Bodo Mrozek u.a. (Hg.), Popgeschichte. Band 2: Zeithistorische Fallstudien 1958–1988, Bielefeld 2014, S. 135–154; Madison Moore, Tina Theory. Notes on Fierceness, in: Journal of Popular Music Studies H. 24/1 (2012), S. 71–86, S. 76.
[3] Bell Hooks, S. 67.
[4] Ebd.
[5] Bell Hooks, S. 68–69.
[6] Moore, S. 82.
Zitation
Nikolai Okunew, Florian Völker, TINA. Die unvollendete Befreiung einer Pop-Ikone , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/tina