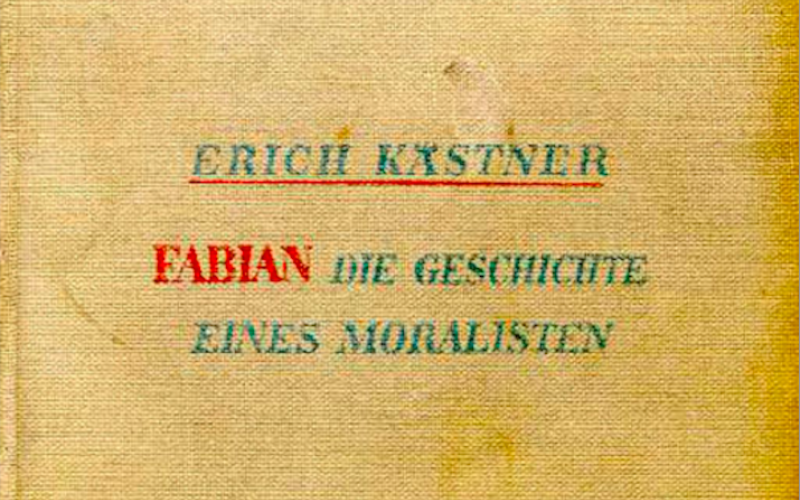Wir sehen Bilder einer perfekten Idylle. Vogelzwitschern, viel Natur, eine Datsche im Grünen. Frauen in bunten Kittelschürzen entsteinen Kirschen, kochen, beten, arbeiten im Garten. Die jüngere der Frauen, es ist die Mutter der Regisseurin, erklärt: es mag schön sein in Spanien oder am weiten Meer... vielleicht..., doch nichts geht über das unermessliche Grün und die Schönheit der moldawischen Natur. Angesichts der Bilder denkt man unwillkürlich an ein Konsumangebot für die Mittelschicht: "Es gibt sie noch, die schönen Dinge". Es sind nahezu verzauberte Bilder des einfachen Lebens, große alte Bäume, getrocknete Kamille und Tassen mit Goldrand auf staubigen Holzregalen.
Doch die Regisseurin stellt die immer gleichen Fragen an die Protagonist*innen in Kittelschürzen, die Tanten, die Mutter: Wie war ich als Kind? Erinnert ihr Euch an mich? Leise Irritation beim Gegenüber. Nun ja, normal eben. Nur die älteste der Frauen, fast blind, mit schmerzenden Gelenken, antwortet: Du warst ein wütendes, ein böses Kind? Einmal, als wir deinen Geburtstag feiern wollten und deine Spielkamerad*innen kamen, hast Du getobt und geschrien: Sie sollen alle weg gehen, jetzt sofort sollen alle weggehen. Und sie sind gegangen, mussten gehen.
Alsbald richten sich die Fragen der Regisseurin auch an ihren Onkel, Onkel Tudor. Natürlich erinnere er sich an sie, was für eine Frage, scherze sie etwa. Ein nettes Mädchen sei sie gewesen. Daraufhin fängt das ehemals nette Mädchen an, zu erzählen. Erinnerst Du Dich, fragt sie, als wir einmal ganz allein zu Hause waren, weil Du krank warst, alle anderen bei der Arbeit waren? Du hast zu mir gesagt, ich solle mich nackt ausziehen und mich dann aufgefordert, dich zu masturbieren. Ich war ein kleines Mädchen damals und wusste gar nicht, was das zu bedeuten hat. Ich habe es nicht verstanden.
Während man noch um Luft ringt, erklärt Onkel Tudor, so klein warst Du gar nicht. Ich war neun, entgegnet die Regisseurin. Nun ja, auch mit neun Jahren habe man schon eine Menge erlebt und außerdem wüsste sie gar nicht, was in einem Mann so alles vorginge und schließlich, so Tudor, habe er sie nie vergewaltigt.
Die Idylle kippt, das ganze Grün, die singenden (und betenden) Frauen, die bunten Teppiche an den Wänden und die vielen liebevoll gefilmten Stillleben werden schal. Nichts ist wie es scheint. Auch für das Kind wird sich die Welt gedreht haben, wurde das "Heile" zur Hölle.
Die Bilder bleiben schön, was kaum noch zu ertragen ist, das Grauen wird langsam und zunehmend, geradezu intravenös verabreicht.
Er mag im übrigen keine verwöhnten Mädchen, mochte sie nie, man solle mit Strenge erziehen, so Tudor weiter. Es gibt weder ein irritiertes Innehalten noch Reue beim Täter. Es schmerzt, vor allem schmerzt es die Regisseurin. Eine mittlerweile knapp dreißigjährige Frau, die sich auf den Weg gemacht hat, um zu erkunden, was gewusst wurde und was gedacht wird über den Missbrauch in der Familie. Das allumfassende Wegschauen wird körperlich spürbar und ist kaum auszuhalten. Die Ehefrau Tudors lag im selben Bett als er sich am Kind verging.
Wir haben es unzählige Male gelesen, gehört: Die Mehrzahl der Missbrauchsopfer kennt die Täter*innen. Nahezu die Hälfte der Opfer schweigt. Sie werden das Trauma, die Scham- und Schuldgefühle ein Leben lang mit sich tragen. Die schönen Bilder in Olga Lucovnicova Dokumentation, die nicht selten weichgezeichnet werden durch Vorhänge, die sich sanft im Wind bewegen, bleiben schön bis der Film endet. Sie muten an wie klassische, farbensatte Gemälde, opulente Tafeln, in denen sich, man sieht es erst auf den zweiten, dritten Blick, oft ein fieses Insekt befindet.
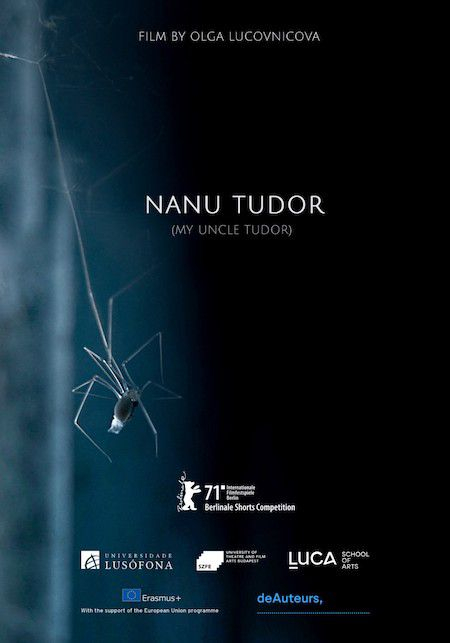
Es gibt eine Szene im Film, das Klischee würde es eine Schlüsselszene nennen, vielleicht ist sie das, aber der zwanzigminütige Film ist reich an Schlüsselszenen: Die Familie sitzt am gedeckten Tisch. Man sitzt eng, die Regisseurin mitten drin. Ihr ist das Unwohlsein anzusehen, ihre ohnehin schmächtige Figur macht sich ganz schmal. Alle anderen reden angeregt. Man habe auch was ohne Fleisch extra für sie gekocht. Die nationale Identität der Regisseurin, "unserer kleinen Olga", wird diskutiert. Natürlich sei sie Moldawierin, aber auch ein wenig Ukrainerin und irgendwie auch Russin. Und alle wissen um ihre andere Prägung und schweigen beredt. Man möchte die junge Frau wegzerren von diesem Tisch, vom fetten Essen und der Feier der Familie(nhölle).
Olga Lucovnicova ist es gelungen, ein kleines, völlig unpathetisches, grausames und dennoch furchtloses Meisterwerk zu schaffen. Dabei war nichts an ihrem Werdegang biografisch vorgesehen und so sitzt sie wie ein Fremdkörper im Kreis Ihrer Familie. Sie wird nicht lange dort bleiben, soviel ist gewiss.
Sie begann, und das hätte in die Familiengeschichte gepasst, mit einer Lehre als Buchhalterin, wechselte aber schon mit sechzehn Jahren zur Fotografie. Über das, was sie dort gelernt haben muss, legt jede einzelne Filmsequenz Zeugnis ab. Ihren ersten Abschluss in Filmwissenschaften machte sie 2011 an der Kunstakademie Chisinau (Moldawien) und setzte danach ihre Ausbildung als Dokumentarfilmerin an der DocNomad-School (gefördert u.a. durch das Erasmus-Programm der EU) in Portugal, Ungarn und Belgien fort.
Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, diesen Film zu machen, so Olga Lucovnicova in einem Interview für die Berlinale-Shorts: Mein Film begann mit dem Wunsch, erwachsen zu werden und meine Ängste aus der Kindheit loszuwerden. Es war eine herausfordernde, aber sehr wichtige Reise für mich. Tolstoi sagte: "Alle glücklichen Familien sind gleich; jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich." Ich würde sein Zitat erweitern und sagen, dass alle Familien glücklich aussehen wollen und dabei manchmal unbewusst die geliebten Menschen opfern, um schreckliche Geheimnisse zu verbergen. Dann kann der sicherste Ort der Welt, unsere Familie, zu einem Käfig tiefer Ängste und Befürchtungen werden.
Diesen Film nicht zu drehen, so die Regisseurin weiter, wäre eine Entscheidung gegen sich selbst gewesen. Die Arbeit daran sei einer Therapie gleich gekommen.
Erzähl mir von Dir, damit ich die Welt verstehe ist das Motto der diesjährigen Sektion Shorts der Berlinale. Der Film Nanu Tudor der 1991 geborenen Olga Lucovnicova ist ein mutiger, wenngleich beängstigender Film. Er erzählt nicht nur vom Missbrauch, er erzählt von Feigheit, Lüge und einem grundstürzenden Mangel an Empathie. Und nicht zuletzt zeigt er uns, wie trügerisch Bilder sein können, Bilder von der perfekten Familie, die es nicht gibt, nicht geben kann und davon, wie diese Lüge immer und immer wieder erzählt wird. Olga Lucovnicova setzt die Geschichte ihres Traumas mit großer Ernsthaftigkeit und einer Meisterschaft um, die staunen macht. Für "Nanu Tudor" (dt. Onkel Tudor) erhielt sie den Goldenen Bären der diesjährigen Shorts-Sektion der Berlinale, eine kluge Entscheidung der Jury. Als ihr Anna Henckel-Donnersmarck, Leiterin der Shorts-Sektion, im März die Entscheidung der Jury via zoom mitteilt, konnte sie es kaum fassen. Es war, so die Regisseurin, eine sehr schwierige Entscheidung diesen Film zu machen: Viele meiner Familienangehörigen wollten mich dazu bewegen, still zu sein.
Olga Lucovnicova ist überwältigt angesichts der digitalen Preisverleihung und kann kaum ausdrücken, was sie fühlt. Wir indessen haben diesen Film, der viel über diese junge Regisseurin erzählt, aber auch über die Welt. Wir dürfen gespannt sein auf die nächsten Filme dieser klugen und talentierten „Erzählerin“.
Im Film zu sehen sind: Onkel Tudor, Mutter, Großmutter, zwei Tanten (unter anderem die Frau von Tudor)
Nanu Tudor (My Oncle Tudor). Regie: Olga Lucovnicova (Belgien, Portugal, Ungarn), Sprachen: rumänisch, russisch, 20’.
Olga Lucovnicova über „Nanu Tudor“: Interview auf dem Short-Blog der Berlinale vom 3. März 2021 (zuletzt 4.6.21).
Der Film ist am 11. Juni um 21.45 Uhr im Freiluftkino an der Hasenheide und am 12. Juni ebenfalls um 21.45 Uhr im Filmrauschpalast zu sehen.
Sämtliche Termine der Berlinale Shorts im Summer-Special.
Zitation
Annette Schuhmann, Die große Lüge. Olga Lucovnicova gewinnt mit ihrem Dokumentarfilm „Nanu Tudor“ (My Uncle Tudor) den goldenen Bären der Berlinale- Shorts , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/die-grosse-luege