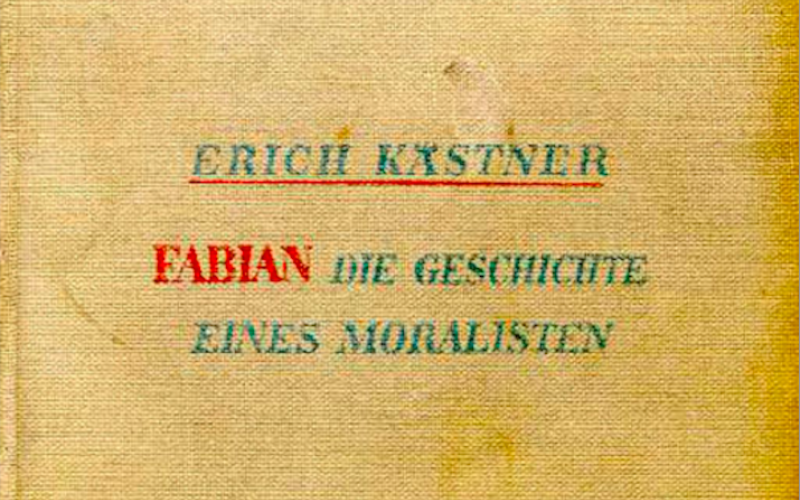Neben dem Wettbewerb und den profilierten Nebenreihen Forum und Panorama führt die Berlinale-Sektion Generation, die sich insbesondere – aber nicht ausschließlich – an Kinder und Jugendliche richtet, in der allgemeinen Wahrnehmung des Festivals eher ein Schattendasein. Dabei kommt dort eine große Zahl junger Zuschauer:innen in Kontakt mit anspruchsvollen Spiel- und Dokumentarfilmen und kann in Austausch mit den Filmemacher:innen treten, womit hoffentlich zukünftige Generationen für das Kino gewonnen werden können. Aus diesem Grund ist es besonders schade, dass Tracy Deers Spielfilmdebüt Beans, der den Gläsernen Bären als Hauptpreis der Sektion Generation K+ gewonnen hat und wichtige Themen rund ums Erwachsenwerden und die Auswirkungen von Rassismus behandelt, statt mehrfach in großen Kinosälen, dieses Jahr pandemiebedingt nur einmal in einem Freiluftkino aufgeführt werden kann.
Erwachsenwerden in einer Krise
“My name is Tekehentahkhwa.” So stellt sich die zwölfjährige Protagonistin (Kiawentiio) der Direktorin der Privatschule vor, die sie in Zukunft besuchen möchte. Selbst mit mehreren Anläufen schafft diese es nicht, den Namen auszusprechen. Deshalb bietet ihr Tekehentahkhwa ihren Spitznamen Beans an. Der Besuch einer Schule mit überwiegend weißer Schüler:innenschaft ist ein Konfliktpunkt in der Familie: Während ihre Mutter (Rainbow Dickerson) große Ambitionen für Beans hat, ist ihr Vater (Joel Montgrand) skeptisch, sie selbst ist sich ihrer Entscheidung nicht sicher. Die Frage des Schulbesuchs gerät aber vor dem historischen Hintergrund der Oka-Krise, in welche die Familie verwickelt wird, zunehmend in den Hintergrund.
1990 eskalierte der Konflikt um Land zwischen der Kanehsatà:ke-Gemeinde der Mohawk und der Stadt Oka, der bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht. Um einen Golfplatz von neun auf 18 Löcher zu erweitern, sollte ein Waldstück namens The Pines, das auch einen Friedhof umfasste, bebaut werden. Um dies zu verhindern, besetzten Aktivist:innen der Mohawk das Land. Die anfänglich durchaus optimistische Stimmung – nachdem sie ihre Cousine in den Nachrichten gesehen haben, besuchen Beans, ihre jüngere Schwester Ruby (Violah Beauvais) und ihre hochschwangere Mutter das Protestcamp; auf der Autofahrt tanzen die drei dabei zu Snaps „I‘ve got the power“ – kippt jedoch, als bei einem Räumungsversuch unter Gewaltanwendung durch die Polizei einer der Polizisten erschossen wird. In der Folge errichten die Aktivist:innen der Mohawk Barrikaden und unterbrechen mit der Besetzung der Mercier Bridge eine wichtige Verbindung nach Montreal. Als die kanadische Armee anrückt, dürfen Frauen, Kinder und Alte die Siedlung verlassen. Am Ende der Brücke erwartet diese Flüchtlinge jedoch ein aufgebrachter Mob, der die Autos mit Steinen bewirft.
Vor dem Hintergrund dieser Krise entwickelt sich Beans Charakter: Ist sie zu Beginn des Films noch ein unschuldiges Kind und verbringt ihre Zeit mit ihrer jüngeren Schwester, wendet sie sich mehr und mehr einer von April (Paulina Alexis) und ihrem Bruder Hank (D’Pharaoh McKay Woon-A-Tai) angeführten rauen Gruppe älterer Jugendlicher zu. Ging sie diesen erst aus dem Weg, sucht Beans nach dem Vorfall im Protestcamp den Kontakt zu April. Sie strebt danach, sich von ihrer Identität als „good girl“ freizumachen und von ihrer behütenden Familie zu lösen. So lässt sich Beans von April in die Technik des schmutzigen Kampfes einführen, mit einer Rute Schmerztoleranz antrainieren – getreu Aprils Motto „If you can’t feel pain, no one can hurt you.“ –, kleidet sie sich provokativer und lernt das Fluchen. Erfahrungen von Zurückweisung treiben diese Entwicklung an: Als ein Supermarkt ihrer Familie den Einkauf untersagt und die Beistehenden sie rassistisch beleidigen, klaut sie eine Box Süßigkeiten. Dass April die Privatschule ablehnt, stachelt sie ebenfalls an. Auf die Tatenlosigkeit der Polizei gegenüber dem Mob an der Mercier Bridge reagiert sie mit einer Attacke auf zwei Polizistbeamte. Zudem verletzt sie sich erstmals selbst, als sie mit einem der im beschädigten Auto aufgelesenen Steinen ihren Oberschenkel ritzt. All dies kulminiert an einem Abend in dem Hotel, in dem die in Sicherheit gebrachten Mohawk einquartiert wurden. Nach einer Party attackiert Beans ein frankokanadisches Mädchen körperlich und beschimpft sie als „frog“. Als ihre Mutter sie daraufhin zurechtweist, erklärt sie, nicht mehr die Privatschule besuchen zu wollen und alle Weißen zu hassen.
In derselben Nacht kehren Beans, ihre Schwester und Mutter sowie April und Hank in die Gemeinde zurück, wobei sie auf dem Weg einem aufgebrachten Mob begegnen und sich verfolgt von der Polizei durch den Wald kämpfen müssen. Die Sorge um ihre in den Wehen liegende Mutter und die Schuldzuweisung durch ihre kleine Schwester lassen Beans wieder bei Aprils Gang Zuflucht suchen. Dort versucht Hank sie zum Oralverkehr zu nötigen. April, die Beans schon vorher im Rahmen eines Wahrheit-oder-Pflicht-Spiels zu schützen versucht hatte, offenbart in diesem Zusammenhang ihre eigene Missbrauchserfahrung durch ihren Vater. Dieser Moment bricht die rebellische Phase von Beans, die ans Bett ihrer Mutter zurückkehrt, April beim Einzug bei deren Großmutter unterstützt und dann beim Abbau der Barrikaden nach der Lösung der Oka-Krise durch Verhandlungen hilft. Am Schluss steht Beans vor ihrer neuen Klasse: “My name is Tekehentahkhwa.”
Projektionsfläche vs. autonomes Kunstwerk
Schon bei seiner Premiere auf dem Toronto International Film Festival wurde Tracey Deers Film sowohl von der Regisseurin selbst als auch von der Kritik mit über die eigentliche Handlung hinausgehenden Deutungen versehen, die insbesondere im Kontext der Black-Lives-Matter-Proteste des Sommers 2020 angesiedelt waren. Dies ist nicht weiter verwunderlich: So führt Beans Mutter eine Gruppe von Frauen an, sich in einer angespannten Situation zwischen den verbarrikadierten Aktivist:innen der Mohawk und der Polizei zwischen den beiden Linien eine lebende Barrikade zu bilden.
Dies rief auch bei mir sofort Bilder der „Wall of Moms“ in Portland, Oregon im Sommer 2020 wach, die Protestierende vor der Polizei schützen sollte. Nikki Baughan zog sogar eine Linie von der Bedeutung der Mercier Bridge als Freiheitssymbol für die Mohawk zur Edmund Pettus Bridge in Selma mit ihrer Rolle für die Bürgerrechtsbewegung in den USA.[1] Als Zuschauer kommen mir leicht weitere Bezüge in den Sinn wie etwa die Proteste gegen die Dakota Access Pipeline. Sowohl in der Eröffnungssequenz als auch am Schluss, als Beans mit dem gelben Schulbus ihre Gemeinde verlässt und vor ihre neue Klasse tritt, konnte ich nicht umhin, an die 215 Kinderleichen zu denken, die vor Kurzem auf dem Gelände der Kamloops Indian Residential School in British Columbia gefunden wurden.[2]
Dass diese vielen möglichen Bedeutungsaufladungen und Anknüpfungspunkte den Film aber nicht erdrücken, liegt vor allem in der darstellerischen Leistung Kiawentiios begründet, die 2019 bereits in der kanadischen Fernsehserie Anne with an E auf sich aufmerksam machte.
Ihr gelingt es, den Wandel vom Good Girl zur Rebellin und dann eine identitäre Katharsis am Ende des Films aufrichtig zu verkörpern. Als sie die beiden Polizisten mit den Steinen aus ihrem Auto attackiert, ist es der einzige Moment, in dem sie über das Glaubhafte hinauszuschießen droht. Auf diese Szene folgt dann aber ihr emotionaler Zusammenbruch in der Abgeschiedenheit des abgeschlossenen Badezimmers, in dem sie sich dann auch selbstverletzt. Dies ist zwar in Deers Drehbuch angelegt, jedoch ist es Kiawentiio, die hier Wahrhaftigkeit vermittelt. Auch die hervorragende Chemie zwischen Kiawentiio, Violah Beauvais als ihrer kleinen Schwester und Rainbow Dickerson als ihrer Mutter hält den Film zusammen. Hervorzuheben ist die Leichtigkeit und Pointierung der Erzählung: Die Ambivalenz und Verletzlichkeit der äußerlich toughen April wird sorgfältig und zurückgenommen entwickelt. Es braucht keine Konfrontation mit dem betrunkenen Vater, um das Problem des Alkoholismus in indigenen Communities zu thematisieren; dessen Schlaf unter seinem Rausch und die Sorge bei seiner Rückkehr, als Beans gerade April hilft, ihre Habseligkeiten aus dem Haus zu schaffen, vermitteln alles, was nötig ist. Die Missbrauchserfahrung wird in ein, zwei wohlgesetzten Sätzen aufgebracht. Drehbuch und Cast bewahren den Film also vor allzu dramatischer Umsetzung von Klischees, was sicher auf Deers Teilhabe an der Gemeinschatz zurückzuführen ist. Hinzu kommt die Kameraarbeit von Marie Davignon, der es gelingt die Nähe zu den Protagonist:innen zu vermitteln. Ihre engen Bildausschnitte und die Untersicht im inneren des Autos, während der Autokorso angegriffen wird, vermögen es, ein Gefühl von Klaustrophobie und des Horrors dieser Situation zu erzeugen.
Das Verhältnis der fiktionalen Erzählung und des Archivmaterials in Beans bleibt nicht ohne Spannungen und die Wechsel zwischen Orten innerhalb der Mohawk-Territorien und rund um Montreal, während sich die Krise zuspitzt, könnten zeitweise die Orientierung der Zuschauer:innen, der keine Vorkenntnisse über die zeitgenössischen Umstände hat, erschweren. Das könnte negativ als handwerklicher Fehler ausgelegt werden, unterstreicht aber letztendlich den persönlichen Zugang und die fragmentarische Wahrnehmung der historischen Vorgänge durch die Akteur:innen, insbesondere durch eine zwölfjährige Protagonistin. In diesem Sinne erscheint mir die teilweise Zurücknahme der auktorialen Erzählhaltung mehr als feature denn als bug. Der oftmals geradezu nahtlose Übergang zwischen fiktionaler Handlung und Archivmaterial, das nicht nur authentifizierendes Beiwerk ist, sondern Teile der Rahmenhandlung der Oka-Krise trägt, lässt sich wohl auf der Vertrautheit Deers als Dokumentarfilmerin mit diesem Material zurückführen. Mich haben diese Bilder, aber auch insbesondere die Tonspur, genauso in den Bann gezogen wie die schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerinnen.
Tracey Deers eigene Geschichte, Tracey Deers Manifest
Als sich Beans in ihrer Schuluniform von Eltern und Schwester verabschiedet, haben sich die Rollen im Vergleich zum Beginn des Films verschoben. Während die Mutter nun Zweifel hat, bestärkt der Vater die Entscheidung seiner Tochter. Dem Hinweis, sie könne immer noch den Schulwechsel absagen, entgegnet Beans: „I’m just doing what you said, mom. We need more friends, right? That’s what I’m gonna do, so they’ll never throw rocks at us again.” Im Vergleich zu anderen Momenten in diesem Film ist diese Szene nicht sonderlich dramatisch, mir ging sie jedoch besonders nahe, da sie für mich eine direkte Verbindung zwischen der Filmemacherin und ihrem Werk herstellt. In gewisser Weise erinnerten mich Beans Worte an ein Manifest Tracey Deers, das die ihrer Arbeit zugrunde liegende Prämisse ausdrückt.
Beans basiert auf Tracey Deers Erfahrungen des Aufwachsens als indigenem Mädchen in Kanada und der Oka-Krise, die sie als Zwölfjährige durchlebte. Für das kanadische Fernsehen beschrieb sie ihre Erfahrung im Autokorso auf der Mercier Bridge und es ist deutlich, wie prägend diese Vorkommnisse für Deers Identität wurden.[3] Ihre Entscheidung Filmemacherin zu werden, verortet sie in derselben Zeit. Deers Schaffen scheint von genau dem kommunikativen Verlangen geprägt zu sein, dass Beans gegenüber ihrer Mutter ausdrückt. So gab Deer ihr Debüt 2005 mit der Dokumentation Mohawk Girls, in der sie drei indigenen Mädchen beim Aufwachsen folgte. In der Folge legte sie drei weitere Dokumentationen vor, in denen sie sich insbesondere mit Fragen der Identität der Mohawk auseinandersetzte. Zwischen 2014 und 2017 setzte Deer Mohawk Girls als Comedy-Drama-Serie fürs Fernsehen um. 2019 arbeitete sie dann als eine der Drehbuchautorinnen an der dritten Staffel der Fernsehserie Anne with an E, die international von Netflix vermarktet wird und einen indigenen Erzählstrang erhielt. Das junge Mi'gmaq-Mädchen Ka'kwet wurde dabei von Kiawentiio gespielt, die damit auf das Radar Deers für das Casting als Beans geriet. Von den Dokumentarfilmen der 2010er-Jahre, die wohl eher ein Nischenpublikum angesprochen haben dürften, über ihre Arbeit an Fernsehserien bis hin zu Beans als ihrem ersten Spielfilm fürs Kino scheint Deer ihre Stimme gegenüber einem immer größeren möglichen Publikum gefunden zu haben.
Während Tracey Deer ihrem Trauma mit der filmischen Arbeit über Fragen der Selbstfindung als indigene Kanadierin begegnete und sich um die Vermittlung indigener Perspektiven bemüht, ist der Konflikt um das Land, der in der Oka-Krise ausgetragen wurde, auch über 30 Jahre später noch nicht abschließend gelöst, da es sich bei der Siedlung Kanehsatà:ke nicht um ein offizielles Reservat handelt.[4] Von einem Film wie Beans, der seine Stärken vor allem in der Darstellung von Identitätsfragen, verwoben mit dem allgemeinen Prozess des Heranwachsens hat, wird man kaum einen Beitrag zur Lösung dieses Konfliktes erwarten dürfen. Er dürfte jedoch das Bewusstsein dafür stärken und wirft für die heutige Zeit global bedeutende Fragen auf. Der Berlinale-Preis erscheint mir aufgrund der gesunden Mischung aus künstlerischer Qualität und gesellschaftlicher Relevanz deshalb durchaus gerechtfertigt und es sei dem Film, der qualitativ auch in jeder anderen Sektion hätte mithalten können, ein großes, vor allem junges Publikum gewünscht.
Beans, Regie: Tracey Deer
Kanada 2020, Laufzeit: 92 Min.
Produktion: EMA Films
Beans läuft im Rahmen des Berlinale-Summer-Specials am Dienstag, den 15. Juni um 17:30 Uhr auf der Neuen Bühne Hasenheide.
[1] Vgl. Nikki Baughan, ‚Beans‘: Toronto Review, in: Screendaily.com, 13. September 2020, abgerufen am 4. Juni 2021, [zuletzt abgerufen am 15. Juni 2021].
[2] Vgl. Ian Austen, How Thousands of Indigenous Children Vanished in Canada, in: The New York Times, 7. Juni 2021, abgerufen am 7. Juni 2021, [zuletzt abgerufen am 15. Juni 2021].
[3] Vgl. Tracey Deer, Tracey Deer on the moment in 1990 that changed everything, CBC, 2017, abgerufen am 5. Juni 2021, [zuletzt abgerufen am 15. Juni 2021].
[4] Vgl. Marian Scott, Christopher Curtis, Oka crisis, 30 years later: Kanesatake's long struggle for land rights, in: Montreal Gazette, 11. Juli 2020, abgerufen am 4. Juni 2021, [zuletzt abgerufen am 15. Juni 2021].
Zitation
Julius Redzinski, “If you can’t feel pain, no one can hurt you“. Erwachsenwerden während der Oka-Krise in Tracey Deers „Beans“, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/if-you-cant-feel-pain-no-one-can-hurt-you