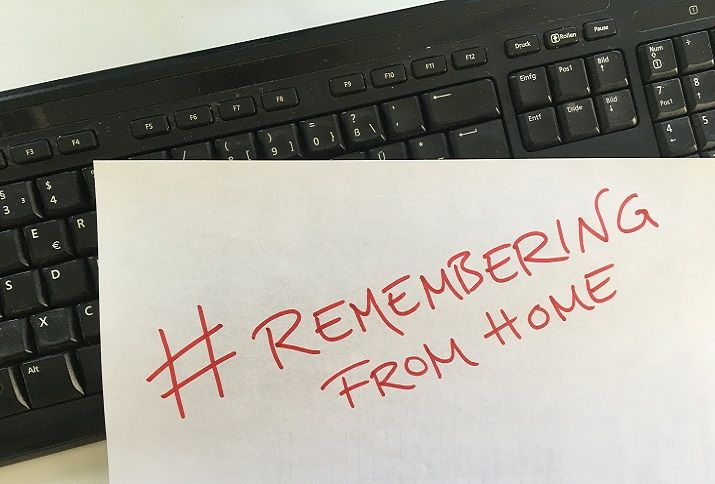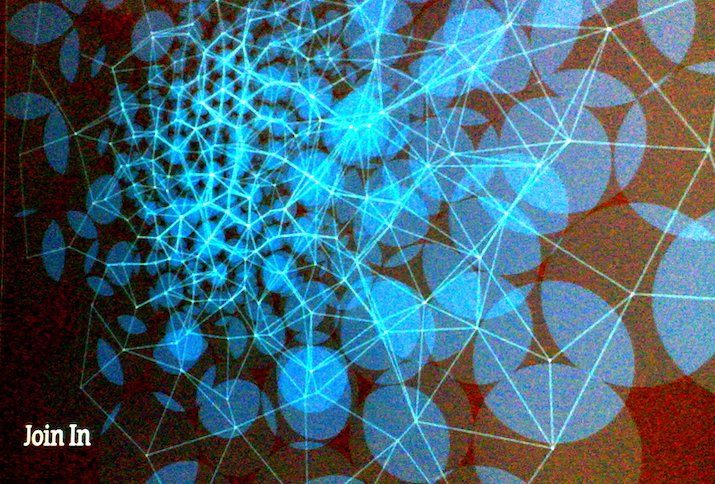„Hoffnungslosigkeit ist eine Extravaganz, die man sich nicht leisten kann, wenn es wirklich schlecht steht“, schrieb der Journalist und Autor Heribert Prantl im Jahr 2017.[1] Zwei Jahre später und um die Erfahrung einer weltweit wütenden Pandemie „reicher“, taugt dieser Satz hervorragend als Geleitwort zum Jahresende 2020.
Was mir in diesem Jahr Hoffnung gemacht hat, ist die ungeheure Kreativität, die Künstler*innen, Autor*innen, Wissenschaftler*innen und Lehrende entwickelt haben, um neue Formen der Vermittlung zu finden, um uns aufzuklären über die Ereignisse, die wir später erforschen werden, um Kunstwerke trotz geschlossener Museen zu zeigen, uns Musik hören zu lassen und nicht zuletzt, um finanziell zu überleben. Wir können uns Hoffnungslosigkeit in der Tat nicht leisten, nicht nur mit Blick auf diese Pandemie, aber ebenso wenig können wir uns leisten, den Klimawandel, die soziale Frage, Antisemitismus und Rassismus aus dem Blick zu verlieren. All diese Probleme werden wieder sichtbarer, wenn sich der Nebel der Inzidenz- und Ansteckungszahlen lichten wird.
Unsere Autor*innen haben auch in diesem Jahr viele kluge und spannende Texte geschrieben, mehr noch sogar als in den vergangenen Jahren (inzwischen veröffentlichen wir pro Jahr zwischen sechzig und achtzig Texte). Es sind diese Texte, die uns hoffnungsvoll stimmen sollten, denn sie können uns wappnen gegen einfache Wahrheiten. Die Welt war immer und bleibt kompliziert.
Wir haben zum Jahresende Kolleg*innen aus der Redaktion gebeten, uns einen für sie wichtigen Text aus diesem Angebot zu wählen. Diese Auswahl stellen wir Ihnen im Folgenden vor und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre an einem ruhigen Ort. Ich danke all unseren Autor*innen für die (unbezahlte) Arbeit, die sie mit jedem ihrer Texte leisten. Unseren Leser*innen danke ich dafür, dass sie lesen, was allein schon das Gefühl der Hoffnungslosigkeit verringert. Und meinen Kolleg*innen Sophie Genske, Rebecca Wegmann und Alina Müller danke ich für ihre immer konstruktiven Ideen, ihren Enthusiasmus und die Bereitschaft zu nächtlichen Überstunden und (ganz wichtig) für ihren Humor und ihre Freundlichkeit. Ohne sie wäre ein solches Portal in seiner Vielfalt nicht möglich.
Annette Schuhmann, 22. Dezember 2020
Tobias Ebbrecht-Hartmann, Die Erinnerung an den Holocaust in Zeiten von COVID-19. Eine Bestandsaufnahme
Irmgard Zündorf: Der Text hat mich aus Sicht der Public History besonders interessiert, da in diesem Jahr, genau wie Tobias Ebbrecht-Hartmann erläutert, zahlreiche Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung der Konzentrationslager geplant waren. Ich wollte selbst gern an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen, nicht zuletzt weil mich die Rituale des Gedenkens, die im Rahmen solcher Feierlichkeiten entwickelt werden, für meine eigenen Forschungen zur Erinnerungskultur interessieren. Die Rituale haben sich jedoch in diesem Jahr verändert, manche komplett, andere wurden auf dieselbe Weise wie in anderen Jahren durchgeführt, nur mit weniger Teilnehmer*innen, dafür mit einem virtuellen Publikum.
Tobias Ebbrecht-Hartmanns Beobachtungen sind für mich hochinteressant, seine Fußnoten mit den zahlreichen Links zu den online-Angeboten der Gedenkstätten ein wahrer Schatz, auch für die langfristige Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Wandel des Gedenkens.
Juliane Fürst, Anika Walke und Sasha Razor, On Free Women and a Free Belarus. A look at the female force behind the protests in Belarus
Annette Vowinckel: Ich favorisiere den Text über die belarusischen Demonstrant*innen , aus dem ich wirklich etwas gelernt habe. Der Text ist aktuell, sehr schön geschrieben und klug. Außerdem ist es ein Text von starken Frauen über starke Frauen, das brauchen wir in diesen Zeiten.
Nils Theinert und Nikolai Okunew, Die Pandemie als Generationenkonflikt. Von „Corona-Partys“ und Moral Panics
Robert Mueller-Stahl: Die Corona-Pandemie hat die Geisteswissenschaften in eine zweifache Krise gestürzt. Einerseits haben sich die praktischen Arbeitsbedingungen insbesondere für Promovierende enorm erschwert. Andererseits aber hat die Pandemie auch eine Sinnkrise hervorgerufen. In einer so erdrückenden Präsenz der Gegenwart, in der die drängenden Fragen derart klar vor uns liegen wie selten, was bringt da das Stöbern in den abseitigen Ecken der Geschichte? Nikolai Okunew und Nils Theinert haben in ihrer Hinterfragung der sogenannten „Corona-Partys“ eine Antwort aufgezeigt, die ein halbes Jahr später immer noch aktuell ist, und so ganz nebenbei auch den Wert einer zeithistorischen Aneignung des Augenblicks unterstreicht.
René Schlott: Die Autoren legen offen, dass es sich beim Phänomen der „Corona-Partys“ vor allem um ein Produkt unserer von Erregung und Empörung geleiteten medialen Aufmerksamkeitsökonomie handelt. Mit historischen Beispielen und unter Mithilfe des soziologischen Begriffes der „Moral Panic“, der eine auf schmaler empirischer Grundlage ausgelöste breite Medienberichterstattung bezeichnet, ordnen sie „Corona-Panik“ in eine Kontinuität von Generationenkonflikten ein, in der die Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft als von der Norm abweichendes „Feindbild“ dienen. Als der sehr gut geschriebene und klug argumentierende Beitrag im April erschien, konnten die Autoren nicht ahnen, dass uns das dargestellte Phänomen bis zum Jahresende und wahrscheinlich darüber hinaus erhalten bleibt. „Corona-Party“ ist zum geflügelten Wort geworden und sicher einer der Anwärter auf das Unwort des Jahres.
Florian Völker, Der kalte Deutsche: Zur Thermoästhetik von Kraftwerk. Ein Kommentar zu den Nachrufen auf Florian Schneider
Ronald Funke: „Nichts ist so ‚deutsch‘ wie Kraftwerk, nicht einmal die Deutschen selbst.“ Es ist faszinierend, wie ein musikalisches Konzept- und Kunstprodukt aus Düsseldorf zu einem internationalen Inbegriff (moderner) „Germanness“ wurde – durch eine einzigartige Mischung aus Vergangenheitsbezug und Futuristik, deutscher Identität und Internationalität sowie dadurch, dass beim Aufgreifen von Klischees und Vorstellungen des „Deutschseins“ vielfach bewusst offen und mehrdeutig blieb, was Hommage und was Bruch, was Pathos und was Ironie war.
Christian Mentel, Fragen über Fragen. Antisemitismusforschung als politisches Projekt
Christoph Classen: Der Beitrag von Christian Mentel zeigt für mich „in a nutshell“ ein fundamentales Missverständnis zwischen Politik und Forschung in den Geisteswissenschaften auf: Während erstere völlig selbstverständlich davon ausgeht, Wissenschaft habe die Aufgabe, die gegenwärtigen normativen und (geschichts-)politischen Programme mit wissenschaftlicher Autorität auszustatten, muss letztere Prinzipen wie Distanz, Ergebnisoffenheit, Pluralität und Historisierung verpflichtet sein. Oder konkreter formuliert: Ihrer gesellschaftlichen Funktion, einen Reflexionsraum für die Gegenwart zur Verfügung zu stellen, kann historische Forschung eben nur dann nachkommen, wenn sie nicht schon a priori auf Kriterien der Gegenwart festgelegt wird. Der Beitrag von Christian Mentel bringt dieses fundamentale Missverständnis über die Aufgaben geisteswissenschaftlicher Forschung am Beispiel der Pressekonferenz der Bundesforschungsministerin und des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung ebenso pointiert wie klar zum Ausdruck. Das ist auch deshalb ein Verdienst, weil solche Kritik zu selten offen ausgesprochen wird: Zu groß ist offenbar die Sorge, sie könne sich negativ auf zukünftige Drittmittelquoten auswirken.
Tilmann Siebeneichner, We are all astronauts? Zur conditio humana in Zeiten der Corona-Krise
Christine Bartlitz: Warum ist es nur immer so schwer auszuwählen? – Im Leben sowieso, aber nun auch unter den vielen klugen, relevanten und meinen Blick weitenden Artikeln auf zeitgeschichte|online. Meine Wahl ist auf den Beitrag von Tilmann Siebeneichner gefallen: Meine Wohnung als eigene Raumstation, „Astro-Alex“ und Major Tom Hand in Hand, der erste Lockdown im Frühjahr und dazu noch die „Fünf Freunde“ unterwegs mit Hannah Arendt – sowie die Frage, wie all das miteinander zusammenhängt. Das ist „der” Text für mich in diesem Jahr in Zeiten der Pandemie: „Can you hear me, Major Tom?”
Annette Weinke, „Alles noch schlimmer als ohnehin gedacht?“ Neue Wege für die Behördenforschung
Claudia Prinz: Als besten Beitrag würde ich – komplett subjektiv auch den Lektürethemen der letzten Wochen geschuldet – Annette Weinkes Artikel auswählen. Eine der wichtigsten Historiker*innenkontroversen der jüngsten Zeitgeschichte, die um „Das Amt und die Vergangenheit” und alles, was folgte, und ein sehr relevantes zeithistorisches Forschungsfeld, die Behördenforschung, werden hier souverän zusammengefasst, in den größeren Trends der Historiographie und Zeitgeschichte verortet. Vor allem aber nutzt Weinke dies, um dann wiederum einige der großen Narrative der deutschen Zeitgeschichte (wie jenes der Demokratisierung) sowie blinde Flecken der Zeitgeschichtsforschung zu problematisieren. Die Forderungen beispielsweise nach einer Historisierung des Demokratiebegriffs, nach einer Weitung des oft nationalgeschichtlich fokussierten Blickfelds und einer Emotions- und Wertegeschichte des Beamtentums werden hoffentlich Nachhall finden.
Susanne Schattenberg, Tschernobyl. Europas größtes Freilichtmuseum
Judith Berthold: Neben vielen anderen wichtigen, habe ich mich für diesen Text aus zwei Gründen entschieden: Erstens habe ich mich persönlich dieses Jahr in zufälligen Gegebenheiten mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl beschäftigt und dies hat nachhaltig auf mich gewirkt. Daher sprach mich in der Durchschau besonders dieser Beitrag sehr an. Zweitens lässt mich die Beschreibung des Tschernobyl-Tourismus ziemlich verstört zurück. Die Forderung nach einem Museumskonzept finde ich daher enorm wichtig. Für die Museumswelt stellt es zwar eine große Herausforderung dar, gleichzeitig aber auch die Chance, mit neuen innovativen Konzeptionen über sich hinauszuwachsen.
Sophie Genske, Rebecca Wegmann und Annette Schuhmann, Frauen* in der Wissenschaft. Ein kritischer Blick auf Alltags- und Arbeitswelt von Frauen im akademischen Betrieb
Jutta Braun: Dieses Dossier ist deshalb mein Favorit, weil so unglaublich viel drinsteckt und es über die Seite zeitgeschichte|online in einer Weise zugänglich wird, wie es mit den „klassischen“ Medien in der Wissenschaft nicht möglich gewesen wäre.
Autor*innenkollektiv der Redaktion (Hg.), Das erste digitale Semester. Erfahrungen und Eindrücke aus dem Sommersemester
Christoph Plath: Der für mich persönlich bedeutsamste Beitrag dieses Jahres war das Dossier zum ersten digitalen Semester. Die Covid-19-Krise ist fraglos ein epochales Ereignis, das unser aller Leben prägte und dessen langfristige Auswirkungen momentan noch nicht absehbar sind. Auch der Einfluss auf die universitäre Lehre war erheblich und die Interviews des Dossiers vermitteln einen guten Einblick in die Herausforderungen und Chancen, die mit der erzwungenen Umstellung auf digitale Formate einhergingen. Für mich als Dozent boten diese außerdem die Möglichkeit, die Erfahrungen von Kolleg*innen an anderen Hochschulen mit meinen eigenen zu vergleichen.
Alexandra Klei, Katrin Stoll und Annika Wienert, Der 8. Mai, ein staatlicher Feiertag? Kritische Anmerkungen zum Begriff der Befreiung im Kontext der deutschen Gedenkkultur
Jens Brinkmann: Es ist alles andere als leicht, einen einzelnen Text aus den vielen guten und eben vielfältigen zeitgeschichte|online-Beiträgen des Jahres 2020 hervorzuheben. Sollte man im verfluchten Corona-Jahr nicht einen der beiden schönen, melancholisch-reflexiven Texte von Tilmann Siebeneichner und Annette Schuhmann auswählen? Die Gedanken über das Geworfensein in die Vakuum-Raumstation des Home-Office, das Unbehagen über den rein digitalen Zugang zur Welt, die Sehnsucht nach Erdung oder dem sonst so nervenaufreibenden Jahrmarkt in der Teeküche, der Traum vom schönen gemeinsamen Arbeiten mit Empathie und Offenheit, ohne Eitelkeit und Narzissmus lagen mir jedenfalls deutlich näher als der ganz große Hammer, wegen einiger vielleicht fragwürdiger Corona-Maßnahmen überschießend zu argumentieren.
Wie man dagegen im besten Sinne polemisch und zeithistorisch fundiert argumentieren kann, zeigt etwa der Meinungsbeitrag von Yves Müller zum unsäglichen Wiederaufbau des Hohenzollern-Schlosses mitsamt der inzwischen auch in höheren Historiker*innenkreisen ubiquitären geschichtsklitternden Preußen-Milde und -Gloria. Dies gilt auch – und das soll hier schließlich mein ausgewählter Beitrag des Jahres sein – für die kritischen Anmerkungen zum Begriff der „Befreiung“, die Alexandra Klei, Katrin Stoll und Annika Wienert aus Anlass des 75. Jahrestags des 8. Mai 1945 verfasst haben. Die Autorinnen zeigen ebenso schonungslos wie überzeugend die Ambivalenzen des Befreiungsbegriffs. Sie äußern ihre Skepsis, ob ein Feiertag der Befreiung der Komplexität dieses Tags gerecht werden und der „selbstgefälligen deutschen Gedenkweltmeisterei“ etwas entgegensetzen könne. Insbesondere legen sie damit den Finger in die Wunde einer Erinnerungskultur, die noch in dem Narrativ der befreiten Deutschen eine lange zurückreichende Tradition der Selbstviktimisierung der Mehrheitsgesellschaft fortführt. Den Gedenkritualen stehe eine mangelnde Auseinandersetzung mit den Verbrechen und ganz einfach mangelndes Wissen gegenüber. Zugespitzt formulieren sie sogar, dass ebenjener Mangel an Wissen konstitutiv für die breite Akzeptanz der deutschen Gedenkkultur sei.
Das sind zugespitzte, provokante Thesen, denen man vielleicht differenzierende Aspekte entgegenhalten könnte, die aber zu einer Auseinandersetzung mit der deutschen Erinnerungskultur und dem heutigen Umgang mit jenem Zivilisationsbruch anregen, den Zeithistoriker*innen meinem Eindruck nach nur noch selten und oftmals seltsam routiniert in den Blick nehmen.
[1] Heribert Prantl, Die Kraft der Hoffnung. Denkanstöße in schwierigen Zeiten, Verlag Süddeutsche Zeitung, 2017.
Zitation
Autor*innenkollektiv der Redaktion (Hg.), Am Ende eines „Ausnahme-Jahres“. Die Kolleg*innen der Redaktion stellen ihre Lieblingsbeiträge des Jahres 2020 vor, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/editorial/am-ende-eines-ausnahme-jahres