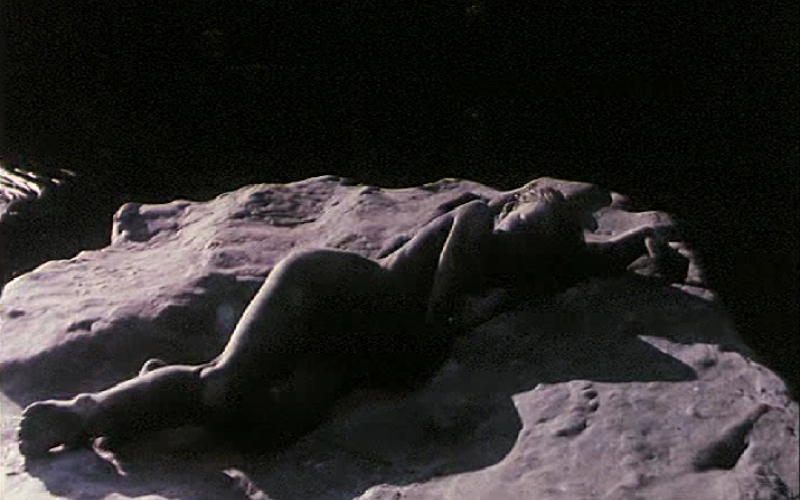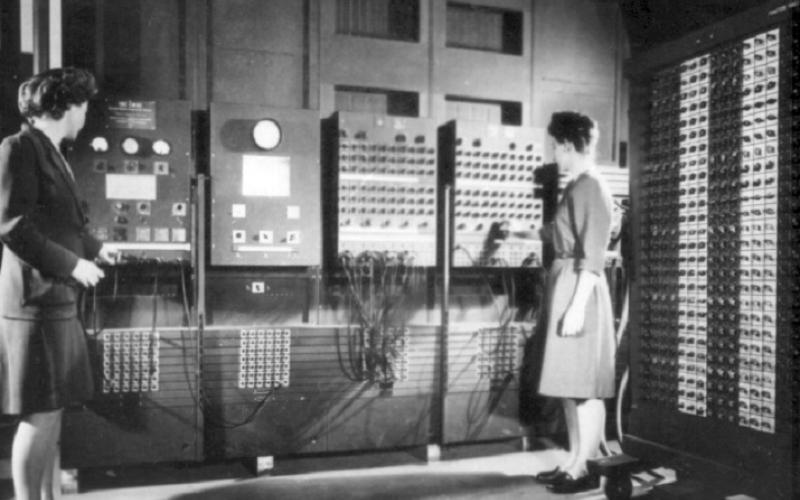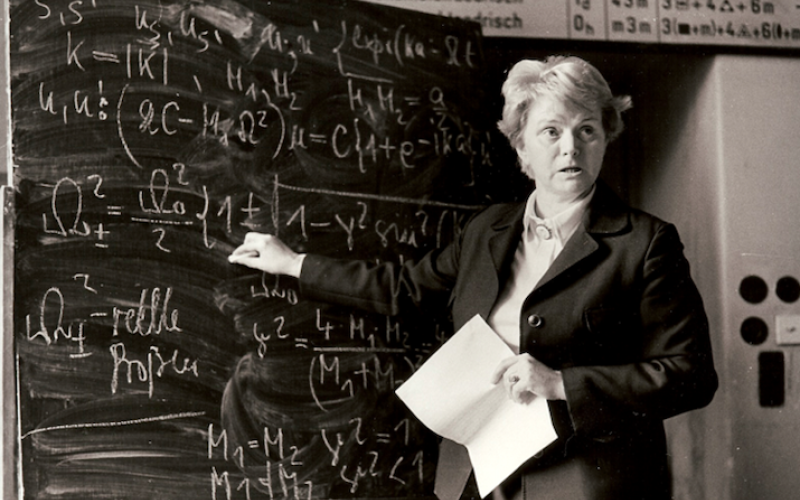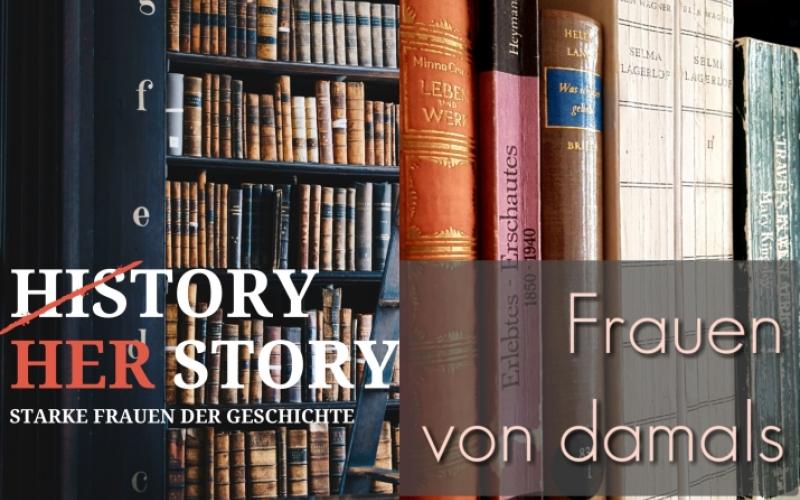zeitgeschichte|online (z|o): Du hast nach der Schule zunächst eine Buchändler*innenlehre absolviert und in diesem Beruf auch ein paar Jahre gearbeitet. Warum hast du dich schließlich entschieden, ein Geschichtsstudium zu beginnen?
C.B.: Für Geschichte habe ich mich schon immer interessiert, auch in der Schule. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, dass ich damit jemals mein Geld verdienen könnte. Dazu kam, dass es Ende der 1980er Jahre eine große Lehrer*innenschwemme gab – das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es hieß, dass man mit einem Studium der Germanistik, Geschichte oder Kulturwissenschaften überhaupt keine Chance auf einen Arbeitsplatz hat. Deswegen dachte ich, eine Buchhändler*innenlehre sei eine gute Alternative und habe insgesamt acht Jahre lang in einer Buchhandlung gearbeitet. Mit dreißig kam der Wunsch nach Veränderung, und so habe ich mich für ein reines Neigungsstudium entschieden und mir gedacht: Ich studiere jetzt Geschichte, weil ich es will! Ich bekam elternunabhängiges BAföG und hatte einen kleinen Job – so konnte ich mich gut finanzieren.
z|o: Hattest du, abgesehen von deinem Interesse für das Fach, noch andere Ziele vor Augen? Hast du dir damals schon vorstellen können, einmal in die Wissenschaft zu gehen?
C.B.: Nein, an Wissenschaft habe ich nicht gedacht. Die Idee dazu kam im Studium durch die Unterstützung und Förderung einer Dozentin. Eva Schöck-Quinteros hat mich und andere Frauen sehr gefördert, unterstützt und uns auch schon im Studium angeregt, eigene kleine Aufsätze zu schreiben und zu veröffentlichen. Dadurch habe ich mir über eine Tätigkeit in der Wissenschaft erste Gedanken gemacht.
z|o: Gab es einen Zeitpunkt, an dem du dachtest, dass das Studieren nichts mehr für dich ist oder dass dir irgendetwas fehlt?
C.B.: Nein, gar nicht. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich dreißig Jahre alt war. Ich habe acht Jahre lang „nine to five“ gearbeitet. Ich fand diese Freiheit großartig, dieses „nicht jeden Tag arbeiten zu müssen“, etwas Neues zu lernen. Mein Gedanke dabei war: Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, wenn ich es nicht hinbekomme, wenn irgendwie die Motivation fehlt, dann steige ich wieder aus und arbeite als Buchhändlerin weiter. Dadurch habe ich das Studium ganz anders mitgenommen.
Die Bremer Uni war anfangs nicht so vergnüglich: eine Massenuni aus Betonklötzen, die asbestverseucht war. Mit dreißig war ich natürlich im Verhältnis sehr alt – oder habe mich alt gefühlt. Dieses Wissen darum, dass ich jetzt das mache, was ich wollte, das hat aber vieles getragen.
z|o: Du hast gerade schon die Welt der Universität angesprochen, in der man sich ja erst einmal zurechtfinden muss. Inwiefern hast du die Diskrepanz zwischen dir und den anderen Jüngeren wahrgenommen?
C.B.: Es gab mehrere andere Frauen, die in meinem Alter waren, und wir haben uns in der Uni gefunden. Entweder waren die Kinder aus dem Gröbsten raus, die Frauen waren über den zweiten Bildungsweg an die Uni gekommen oder wollten, wie ich, noch einmal etwas ganz Neues beginnen. Ich habe bis heute enge Freundinnen aus dieser Zeit. Mit diesen Frauen zusammen zu sein hat sehr geholfen, den Unialltag zu bewältigen und sich gegenseitig zu motivieren.
z|o: Haben dir deine Erfahrungen als Buchhändlerin bei deinem Studium geholfen?
C.B.: Als Buchhändlerin entwickelt man rasch die Kunst des Schnelllesens. Du musst den Kund*innen Empfehlungen für Weihnachten und andere Anlässe geben, und diese Bücher kann man nicht alle lesen. Dieses schnelle Lesen, das Über-den-Text-huschen, habe ich damals in der Ausbildung und dann auch während des Arbeitens sehr gut beherrscht – und das kann ich bis heute.
z|o: Akademische Lebensläufe wirken oft sehr geradlinig, obwohl sie es vielleicht nicht immer gewesen sind. Wie war das bei dir? Als wie „geradlinig“ würdest du deinen Karriereweg beschreiben?
C.B.: Überhaupt nicht geradlinig. Gar nicht. Die Konstante, die sich durch mein Leben zieht, sind die Bücher. Ich habe früher Bücher verkauft, dann habe ich sie im Studium gelesen, sie während meiner Selbstständigkeit geschrieben und sie im ZZF am Anfang auch gesetzt. Später habe ich Bücher im Verlag lektoriert und redigiert. Jetzt bin ich gerade dabei, am ZZF einen eBook-Verlag ins Leben zu rufen, das heißt, ich verlege sie jetzt auch. Das Buch zieht sich durch, alles andere nicht. Ich würde nie von Geradlinigkeit sprechen. Es sind Zufälle, Weggabelungen, an denen man sich aus verschiedenen Gründen für eine Richtung entscheidet. Und, was ich auch ganz wichtig finde, wenn das alles nicht funktioniert hätte, dann würdet ihr jetzt auch nicht mit mir sprechen. Dadurch, dass ich in die Wissenschaft zurückgekehrt bin und euch jetzt diese Geschichte erzähle, machen wir eine gewisse Geradlinigkeit daraus.
z|o: Wie verlief dein Weg in die Wissenschaft?
C.B.: Ich hatte nach dem Studium eine Promotionsstelle am ZZF. Nach zwei Jahren hat die DFG den Vertrag nicht weiter verlängert. Daraufhin war ich von einem auf den anderen Tag arbeitslos, habe Hartz IV bezogen und 200 Bewerbungen geschrieben. Es sah trostlos aus. Niemand wollte mich überhaupt auch nur zum Bewerbungsgespräch einladen. In dieser Situation, mit vierzig Jahren, das Alter kam also auch noch hinzu, habe ich gedacht, das war eine totale Fehlentscheidung mit dem Studium und der Idee, dass ich in die Wissenschaft gehen könnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich bei einer Veranstaltung, ich glaube, das war ein runder Geburtstag von Konrad Jarausch, unserem damaligen Direktor. Die Kolleginnen und Kollegen waren alle total nett. Sie haben gefragt, was ich jetzt mache und wie es mir geht, und ich erzählte ihnen von meiner Arbeitslosigkeit – es war ein grauenvoller Abend. Ich habe die ganze Rückfahrt in der S-Bahn geheult und beschlossen: Ich gehe nie wieder ins ZZF, wenn ich nicht irgendetwas vorzuzeigen habe.
z|o: Wie ging es dann weiter? Wie bist du dazu gekommen, eine eigene Agentur zu gründen?
C.B.: Aus dem Mut der Verzweiflung heraus ist das entstanden. Nachdem ich ein Jahr zu Hause gesessen hatte, musste ich etwas tun. Am Anfang habe ich noch versucht, die Dissertation weiterzuschreiben, aber ohne Finanzierung und Anbindung ging das nicht. Mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein waren im Keller. Daraufhin habe ich gemeinsam mit einer Freundin und einem Freund eine eigene Agentur gegründet, um Auftragsbiografien zu schreiben. Wir haben uns zusammen ein kleines Büro in Kreuzberg genommen und zehn Bücher geschrieben. Wir hatten das gar nicht intendiert, aber die Geschichte ist auf diesem Weg wieder zu uns gekommen: Die Mutter einer Auftraggeberin ist in Auschwitz ermordet worden, die eines anderen Kunden hat Ravensbrück überlebt. Es war eine sehr intensive und beeindruckende Erfahrung.
Auf der anderen Seite ist mir jedoch auch klar geworden: Die Existenz als freie Historikerin ist prekär. Die Bezahlung ist schlecht, und man arbeitet sehr, sehr viel. In meinen allerbesten Zeiten habe ich 2000 € brutto verdient. Aber davon ging noch die Krankenkasse und Rentenversicherung ab, von Urlaub, Krankheit oder Büromiete ganz zu schweigen. Immerhin konnte ich mich ernähren, und ich bin bis heute stolz auf diese Zeit; darauf, dass ich es aus eigener Kraft geschafft habe, mich weiterhin mit Geschichte zu beschäftigen und damit auch meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
z|o: Wie habt ihr eure Kund*innen gefunden?
C.B.: Über unsere Agentur gab es mehrere Zeitungsartikel, über die sich Leute bei uns gemeldet haben. Biografien erfuhren damals eine regelrechte Konjunktur. Rohnstock-Biografien waren in Berlin gerade groß geworden, und wir haben die Deutsche Biografische Gesellschaft mitbegründet. Das Ganze hatte auch etwas Demokratisches: Jedes Leben ist es wert, erzählt zu werden. Auffällig war, dass es viele Frauen gab, die eigentlich interessiert waren, ihr Leben niederschreiben zu lassen, aber sich letztendlich dann doch dagegen entschieden haben: „Ich habe ja eigentlich gar nichts Besonderes erlebt.“
z|o: Du wolltest nicht mehr ans ZZF zurück, ohne etwas vorweisen zu können. Im Jahr 2009 bist du als wissenschaftliche Mitarbeiterin zurückgekehrt. Was war passiert?
C.B.: Dass ich nicht mehr dahin zurück wollte, hatte etwas damit zu tun, dass ich mich geschämt habe. Geschämt darüber, dass ich es nicht geschafft habe und rausgeflogen bin. Meine Rückkehr hatte mit Netzwerken und Kontakten zu tun. Ich war die gesamte Zeit mit Annette Schuhmann, Projektleiterin bei zeitgeschichte|online, befreundet. Sie erzählte mir von einer Ausschreibung für zwei halbe Redakteursstellen für das Docupedia-Projekt. Ich glaube, ich hätte das gar nicht mitbekommen, weil für mich die Wissenschaft eigentlich vorbei war. Ich war selbstständig, hatte meine Biografien und mein Lektorat, und ab und an habe ich in der Buchhandlung gearbeitet – damit hatte ich mich eingerichtet. Ich habe mich dann doch beworben, und es kamen zwei Umstände zusammen. Zum einen kam ich mit meinem krummen Lebenslauf auf den richtigen Haufen und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil die Leute mich kannten. Aber meine Erfahrungen in den wissenschaftsbenachbarten Bereichen, in der Öffentlichkeitsarbeit bei der UFA, der Arbeit im Verlag, der Buchhandlung und der biografischen Arbeit, waren auf einmal auch von großem Vorteil. Ich bin überzeugt, dass jemand mit einer klassischen wissenschaftlichen Karriere nicht so gut gepasst hätte. Insofern habe ich mich auch gefreut, wiederzukommen. Im Jahr 2013 ist dann die halbe Stelle für das Online-Portal Visual History hinzugekommen. Diese beiden Portale leite ich jetzt. Seit 2014 habe ich eine feste, unbefristete Stelle, was im Wissenschaftsbetrieb ja einem Lotteriegewinn gleicht.
z|o: Dann war Visual History auch wieder etwas ganz Neues für dich?
C.B.: Absolut, ich hatte davor überhaupt keine Ahnung von Bildern. Durch die vielen Beiträge, die wir veröffentlichen, durch die Gespräche, die wir führen, auch in der Abteilung mit Annette Vowinckel, Sandra Starke, Violetta Rudolf und Robert Mueller-Stahl, habe ich mich über die Jahre zur Expertin ausgebildet. Die Wahrnehmung von Bildern als Quelle nimmt ja zu. Die Vermittlung an den Universitäten fehlt allerdings noch.
z|o: Eva Schöck-Quinteros hast du als Mentorin während deines Studiums erwähnt, hattest oder hast du noch andere Vorbilder? Wie wichtig sind Vorbilder generell?
C.B.: Ich hatte Vorbilder und habe sie auch immer noch. Eigentlich sind das all die Menschen, die diese Begeisterung für Geschichte ausstrahlen. Bei denen ich weiß, warum ich Geschichte studiert habe. Ich habe damals auch Geschichte studiert, weil ich wissen und verstehen wollte, wie der Nationalsozialismus möglich war. Bei der Abschiedsvorlesung von Michael Wildt ist mir wieder klar geworden, ja genau, deswegen habe ich Geschichte studiert. Manchmal geht diese Begeisterung im Alltagsgeschäft ja etwas verloren. Daher sind die Momente, wenn Leute engagiert sind, für das Fach brennen und den gesellschaftlichen Auftrag sehen, mir umso wichtiger. Wir Historiker*innen sind ja auch in der Geschichtsvermittlung tätig, das ist ein unabdingbares Gut für unser Geschäft. Das müssen wir immer mitdenken, weil wir einen gesellschaftlichen Auftrag haben.
Es müsste viel mehr Abteilungsleiterinnen, Direktorinnen und Präsidentinnen in der Wissenschaft geben. Es war interessant, als wir in einem Coaching, von Annette Schuhmann organisiert, den sogenannten Elevator Pitch geübt haben: In einem Fahrstuhl treffe ich zufällig eine Person, die ein Vorbild für mich ist: Was sage ich zu ihr? Vier der Frauen haben sich Jutta Allmendinger vorgestellt, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Da ist mir noch einmal deutlich geworden: Es gibt wirklich nicht viele Frauen in hohen Positionen in der Wissenschaft.
z|o: Hast du irgendwann schon mal die Gläserne Decke gespürt oder über deinem Kollegium wahrgenommen?
C.B.: Klar, ich glaube, die kennen wir alle. Man muss sich nur die Zahlen angucken. Nach oben hin wird es dünn. Natürlich gibt es unterschiedliche Gründe, warum Frauen nach der Promotion die Wissenschaft verlassen. Das hängt mit den prekären Arbeitsverhältnissen zusammen, Stichwort #IchBinHanna, aber auch mit männlich geprägten Kommunikations- und Machtstrukturen.
Ich bin absolut für eine Quote und für Geschlechterparität. Dadurch ändert sich die Kultur einer Institution, aber auch die Kultur innerhalb der Geschichtswissenschaft. Diese ist immer noch recht männlich geprägt, gerade in der Zeitgeschichte, auch wenn man bedenkt, wer unser Fach in der Öffentlichkeit repräsentiert.
Bei mir ist es nochmal anders, weil ich nicht einmal den Doktortitel habe. Insofern ist es noch schwieriger, in diesem System mitzuhalten. Es ist immer noch so, dass die Promotion die Eintrittskarte für das Wissenschaftssystem ist. Aus meiner Perspektive heraus wäre es sinnvoll, wenn es viel mehr Wissenschaftler*innen gäbe, die interdisziplinär gearbeitet oder schon einmal etwas ganz anderes in ihrem Leben gemacht haben als nur studiert und promoviert. Wer mit achtundzwanzig promoviert ist, stellt natürlich jemanden ein, der*die einen ähnlichen Lebenslauf hat wie man selbst. Insofern finde ich es auch wichtig, dafür zu kämpfen, diese gläserne Decke zu durchdringen, um zum einen Vorbild zu sein, aber auch um die Kultur zu verändern. Das funktioniert nur, wenn mehr Frauen da sind, wenn die Institutionen diverser werden.
z|o: Was wäre noch eine Möglichkeit außer der Quote, diese Strukturen und Kulturen zu verändern. Hast du noch andere Vorstellungen?
C.B.: Schließt euch zusammen! Ich finde es ein ganz tolles Zeichen, dass sich unsere Gleichstellungsbeauftragte jetzt aus vier Frauen „zusammensetzt“ und wir ein Gleichstellungskollektiv gegründet haben. Dadurch ist die Last auf mehrere Schultern verteilt. Das heißt auch, dass man sich gegenseitig stärkt, unterstützt und darüber nachdenkt, wie bestehende Strukturen verändert werden können. Ich finde das überaus innovativ. Dass wir offiziell nur „eine“ Gleichstellungsbeauftragte haben, ist nur dem Gesetz geschuldet, aber alle vier agieren mit, und der Posten rotiert jedes halbe Jahr.
z|o: Was würdest du all jenen, die jetzt an ihre Laufbahn im Bereich Geschichtswissenschaften denken, mit auf den Weg geben?
C.B.: Ich würde sagen, dass man nah bei sich selbst bleiben soll. Dass man versuchen soll, das, was man gerne tun möchte, auch umzusetzen und sich den eigenen Weg sucht. Und ganz wichtig: Bildet Banden. Sucht euch Gleichgesinnte, gründet Gesprächskreise und Netzwerke, denkt gemeinsam über Dinge nach und macht euch gegenseitig stark. Holt euch von anderen Kraft und Unterstützung, um nicht den Mut und die Zuversicht zu verlieren. Allein ist es immer sehr schwierig. Mir würde auch gefallen, wenn sich Alters- und Erfahrungsgruppen mehr durchmischen. Das ist für beide Seiten produktiv, und das Blickfeld weitet sich: Wo will ich hin, was könnte ein möglicher Weg für mich sein?
Das Gespräch mit Christine Bartlitz führten Pia Dressler und Alina Müller am 02. März 2022 über Zoom.
Zitation
Alina Müller, Pia Dressler, Christine Bartlitz, „Die Konstante, die sich durch mein Leben zieht, sind die Bücher“. Ein Interview mit Christine Bartlitz, Projektleiterin von Docupedia und Visual History am ZZF , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/die-konstante-die-sich-durch-mein-leben-zieht-sind-die-buecher