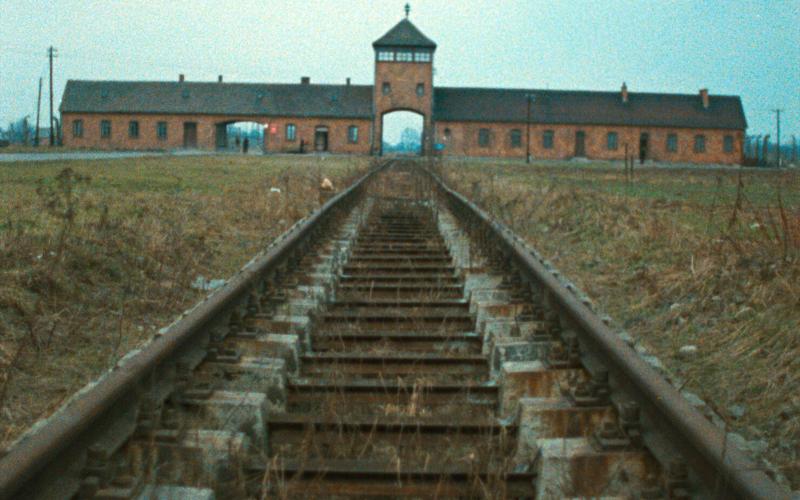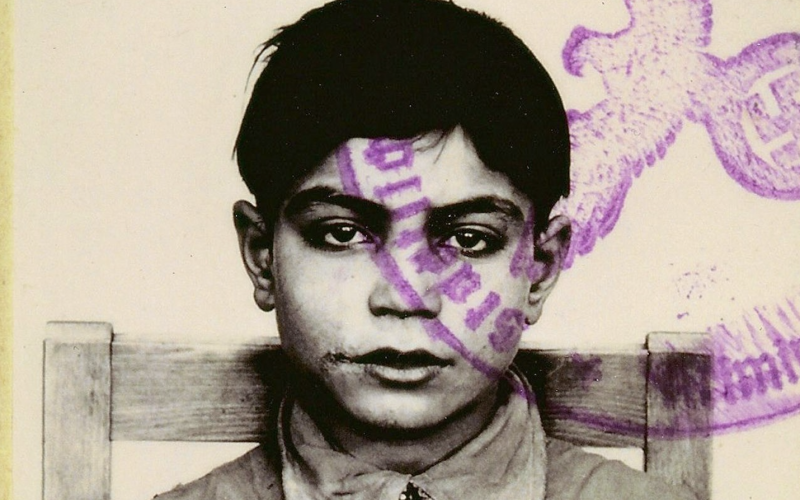Der Alltag vieler Menschen in der DDR war geprägt durch ihre Arbeitswelt. Rückblickend wird die DDR deswegen sogar als „Arbeitsgesellschaft“ beschrieben. Den hohen Stellenwert der Arbeit muss man sich bewusst machen, wenn man verstehen will, welche Folgen die Privatisierung der DDR-Industriebetriebe für die ostdeutsche Gesellschaft in den 1990er Jahren hatte. Viele Menschen verloren damit nicht einfach „nur“ einen Job, sondern vielmehr einen Teil ihrer Identität. In seinem neuen Film „Stolz & Eigensinn“, der im „Forum“ der 75. Berlinale seine Weltpremiere feierte, spürt der Regisseur Gerd Kroske diesen Verlusterfahrungen nach.
Als Grundlage für seinen Film konnte Kroske auf einen zufälligen Archivfund zurückgreifen: In den Beständen von „Kanal X“, einem Leipziger „Fernsehpiratensender“, der in den 1990er Jahren kurzzeitig ein eigenes Programm ausstrahlen konnte und darüber hinaus eigenständig Filme produziert hat, stieß Kroske auf eine Reportage über Frauen aus der DDR. Sie schildern darin ihren Arbeitsalltag und berichten von den massiven Umbrüchen in ihren Betrieben seit 1990. Die Reportage („… früher waren wir gut genug“, 1994, Regie: Norbert Meißner) ist ein seltenes, wertvolles Zeitdokument. Kroske nahm den Film zum Anlass, um nach den Frauen von damals zu suchen. Wie blicken sie heute, 30 Jahre später, auf ihre Erfahrungen aus der Nachwendezeit zurück? Einige von ihnen hat Kroske tatsächlich ausfindig machen können und mit ihnen gesprochen. Die neuen Interviews und die Archivaufnahmen von damals verdichtet er in „Stolz & Eigensinn“ zu einem vielstimmigen Porträt, das einen persönlichen Blick auf den historischen Umbruch von 1989/90 wirft.
Auffällig ist etwa, mit welchem Selbstvertrauen die Frauen auf ihre Arbeit zurückblicken, ohne die Verhältnisse zu beschönigen. Einige waren in „klassischen“ Männerberufen tätig – z.B. im Bergbau, als Lokführerin oder als Chemikerin. Die Widerstände, gegen die sie sich dabei behaupten mussten, waren groß und hatten Folgen, auch im privaten Alltag, der häufig darunter litt, z.B. weil der Ehemann zeitversetzt im Schichtsystem tätig war und man sich unter der Woche nie sah, wie eine der Frauen nüchtern berichtet. Das Gefühl, sich in einer Männerdomäne behauptet zu haben, begründete ein trotziges Selbstbewusstsein, das sich bis heute erhalten hat, etwa wenn eine der Frauen mit verschmitztem Blick erzählt, wie sie – als einzige Frau in ihrem Fachbereich – ihren Meistertitel machen konnte, eine der schönsten Szenen des Films.
Der Umbruch in den 1990er Jahren ist an keiner der Frauen spurlos vorübergegangen, das ist in allen Interviews zu merken. Trotz ihrer hohen beruflichen Qualifikation konnten manche ihre ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr ausführen, zumal in den „männlich dominierten“ Berufen, in den Frauen nicht mehr erwünscht waren. Auch hart erkämpfte Errungenschaften wie die gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit gingen verloren – ein Missstand, der bis heute andauert. Dass sich angesichts dieser Erfahrungen in den Gesprächen auch Verbitterungen zeigen, ist wenig verwunderlich. Nostalgie oder romantische Verklärung vermeidet der Film dennoch konsequent. Dass viele Betriebe durch die ruinöse SED-Wirtschaftspolitik abgewirtschaftet waren und kurz vor dem Zusammenbruch standen, ist in den historischen Aufnahmen kaum zu übersehen. Auch die zum Teil widrigen Arbeitsbedingungen und katastrophalen Umweltverschmutzungen in vielen Industriebetrieben verschweigt der Film nicht. Schließlich hatte die in der DDR vielgepriesene Gleichberechtigung ihre Grenzen – in den höheren Leitungsebenen dominierten stets die Männer, auch davon erzählen die Frauen im Film.
Neben den eindringlichen Erinnerungen der Frauen schöpft „Stolz und Eigensinn“ seinen filmischen Reiz aus der Gegenüberstellung der Aufnahmen von 1994 und den heutigen Interviews. Daraus ergibt sich ein spannender filmischer Kontrast, den Kroske zusätzlich vertieft, indem er wiederholt Splitscreens verwendet. Die Frauen beobachten die alten Aufnahmen und kommentieren sich zum Teil selbst, häufig mit Zustimmung, manchmal auch mit Verwunderung über die eigenen Äußerungen. Der Film wirft damit auch die Frage auf, ob sich persönliche Erinnerungen im Verlauf der Zeit verändern oder verstetigen. Das gilt für die Erfahrungen aus der Nachwendezeit im besonderen Maße, weil in vielen Familien in der Öffentlichkeit lange Zeit nur wenig über individuelle Erlebnisse gesprochen wurde. Wie wichtig es ist, dieses Schweigen zu überwinden, zeigt „Stolz & Eigensinn“ mit Nachdruck, denn hinter den abstrakten Zahlen der tausenden geschlossenen Betriebe verbergen sich individuelle Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.
Damit stößt „Stolz & Eigensinn“ nicht zuletzt in eine Lücke in der filmischen Inszenierung der ostdeutschen Vergangenheit. Seit 1989/90 wurden zwar hunderte Spielfilme über die DDR und die „Wendezeit“ gedreht, aber kein einziger davon spielt in einem der Betriebe, die nach 1990 privatisiert wurden. Die Erfahrungen der Menschen, die von den Betriebsschließungen betroffen gewesen sind, waren (und sind bis heute) filmisch kaum präsent oder erstarren in Klischees. Im Dokumentarfilm hat es zwar Versuche gegeben, diese Erfahrungen unmittelbar festzuhalten, denkt man etwa an die beiden nach 1990 entstandenen Teile der Langzeitbeobachtung von Volker Koepp über das Näherinnenwerk in Wittstock („Neues in Wittstock“, 1992, und „Wittstock, Wittstock“, 1997). Mit „Stolz & Eigensinn“ knüpft Kroske an diese und andere Filme an und ermutigt hoffentlich weitere Menschen dazu, über die Erfahrungen der Nachwendezeit zu erzählen, in ihren Familien, aber auch im öffentlichen Raum. Das Sprechen (und Zuhören) über diese Zeit hat erst begonnen.
Zitation
Andreas Kötzing, „Stolz und Eigensinn“. Erinnerung und Verlusterfahrung: DDR-Frauen und ihre Arbeitswelt vor und nach der Wiedervereinigung, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/stolz-und-eigensinn