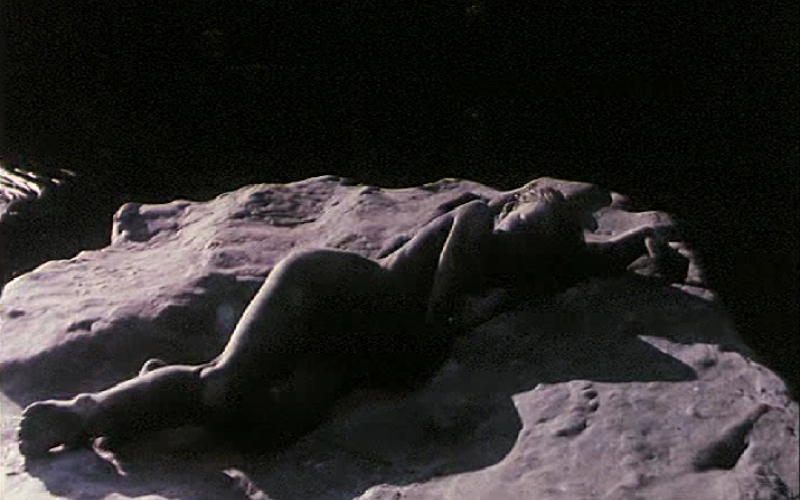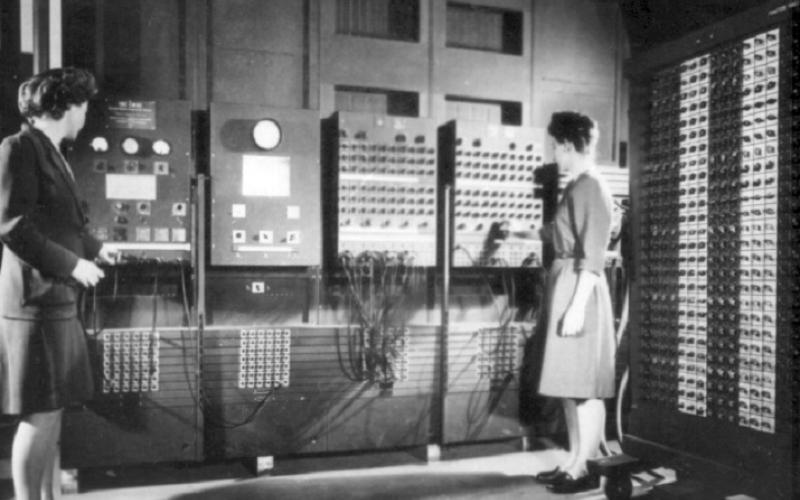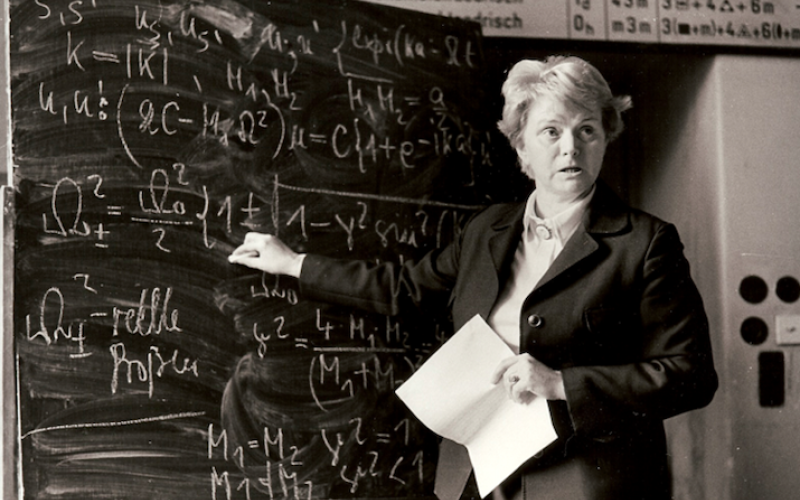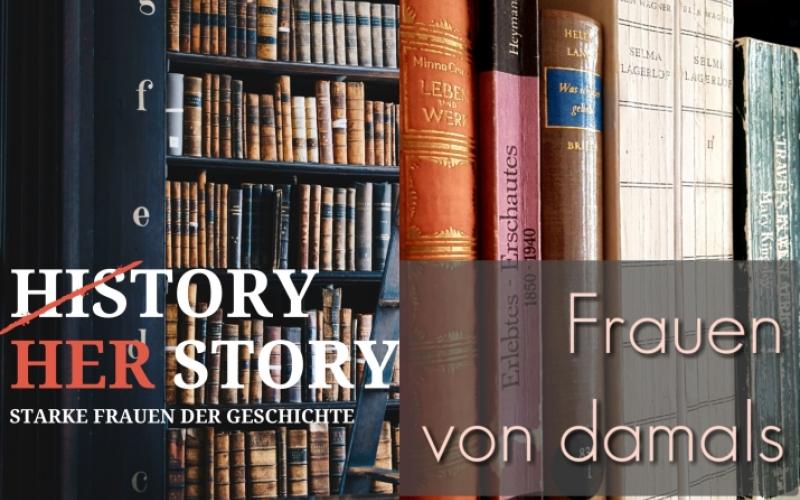ZOL: Als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit eigenem Forschungsprojekt, als Kuratorin und Künstlerin…braucht man da zusätzlich noch das aufreibende und aufwändige Amt der Gleichstellungsbeauftragten? Warum haben Sie dieses Amt angenommen?
Necker: Wenn Wissenschaft ein Teil der Gesellschaft sein will, dann geht es auch hier, im Bereich der Gleichstellung, um Teilhabe und Mitbestimmung. Ich habe das Amt angenommen, weil es ein politisches Amt ist und es auch in diesem Sinn ausgeführt.
ZOL: Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem „Amt“ am IfZ gemacht?
Necker: In einem hierarchischen System wie das der Wissenschaft, ist ein Amt immer gut, denn es bedeutet Macht. Natürlich ist die Macht der Gleichstellungsbeauftragten wohl kalkuliert eingeschränkt und eingehegt, aber formal bedeutet es, nach dem Gleichstellungsgesetz erst einmal den Institutsleitungen beratend zur Seite zu stehen, in Personalfragen unmittelbar und zeitnah eingebunden zu sein und im besten Falle mit der Leitungsebene gemeinsam strategische Fragen die Gleichstellung betreffend zu diskutieren. Mittlerweile sind strategische Papiere wie ein Gleichstellungsplan und erworbene Zertifikate wie „Total E-quality“ ja auch relevant, wenn es um die Evaluierung eines Instituts geht oder bei der Vergabe von Drittmitteln. Insofern ist dieses Amt gut, um an diesen Grundsatzfragen – im besten Fall ideengebend – mitzuwirken.
Nach den Erfahrungen und Widerständen gefragt: Diese sind tatsächlich nicht IfZ-spezifisch. Meine Erfahrungen machen Gleichstellungsbeauftragte am ZZF, an Universitäten, an geistes- wie an naturwissenschaftlichen Instituten. Das hat zumindest der Austausch mit den Gleichstellungsbeauftragten innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft gezeigt, in deren Sprecherinnenrat ich saß. Gleichstellungsfragen sind dann eben doch strukturelle Fragen und Problemlagen, und keine institutionellen im eigentlichen Sinn. Deshalb ist aus meiner Sicht das Amt auch politisch und nicht nur auf die lokalen Schwierigkeiten in der Umsetzung der Gleichstellung in einem Institut beschränkt.
Widerstände rühren immer von der nicht selbstverständlichen Akzeptanz in der Gesellschaft, dass Gleichstellung ein im Grundgesetz verankertes Ziel ist und die Gleichstellungsbeauftragte eine offiziell benannte bzw. gewählte Person im Amt ist, die die Institutsleitung und das Institut selbst in der Umsetzung dieses Ziels unterstützt. Und deshalb gehört es zu den „klassischen“ Erlebnissen von Gleichstellungsbeauftragten, dass so mancher männliche Kollege sich einen ironischen Kommentar nicht verkneifen kann. Besonders beliebt und für Männer offensichtlich besonders witzig, wobei sich mir der Witz – wahrscheinlich aufgrund meines Geschlechts – bis heute nicht erschließt, war der Kommentar, man(n) fühle sich durch die Gleichstellungsbeauftragte benachteiligt. Das ist natürlich ein schlagendes Argument, waren sie – in diesem Fall im IfZ – aufgrund der Wahlordnung zur Wahl der Gleichstellungsbeauftragten von der Wahl ausgeschlossen und auch nicht wählbar. Sie waren somit nicht repräsentiert. Dabei ging es gerade darum, die Unterrepräsentanz von Frauen in allen Beschäftigungsfeldern und Entgeltgruppen zu verändern und eine angemessene Geschlechterrelation (seit mehreren Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten sind das 50:50, auch wenn das mancher Kollege immer noch als absurde Forderung abtut) anzustreben. Dass dabei dann auch Bereiche verändert werden müssen, in denen Frauen überrepräsentiert sind (meist in den schlechter bezahlten Beschäftigungsfeldern wie dem sogenannten wissenschaftsstützenden Bereich), ist klar. Aber schon reiten die Ritter der Männergleichberechtigung ins Bild und beklagen die bemitleidenswerte Eingruppierung z.B. eines männlichen Hausmeisters und übertönen mit ihren Rufen die oft gravierenden Ungleichheiten auf den Entgeltstufen 14 und 15 beziehungsweise den außertariflichen Bezahlungen von Abteilungs- und Institutsleitungen, auf denen viele Institute diese Geschlechterrelation von 50:50 oft nicht einmal annähernd erreichen.
Das Gesamtbild bleibt aus der Sicht der Gleichstellungsbeauftragten immer noch übersät von Ungleichheiten, die mir zu oft mit zu großer Selbstverständlichkeit hingenommen wurden, denn machen könne man(n) ja nichts, Stellen könne man(n) schließlich nicht herzaubern. Das ist richtig, und doch nutzen Institute und Universitäten immer noch viel zu selten Recruiting-Methoden, um Frauen für (Führungs-)Positionen zu gewinnen. Zudem gibt es wenig Verständnis dafür, dass bestehende Strukturen, die auf männlich dominierten Netzwerken, mit männlich geprägtem Habitus und männlich performten Kommunikationsstrukturen basieren, für (junge) Wissenschaftler*innen – also für Männer und Frauen, die sich dieser scheinbar unverrückbar geltenden Kultur nicht zugehörig fühlen und das auch nicht wollen – reichlich unattraktiv sind. Ein Unternehmen der freien Wirtschaft würde Consultants einfliegen lassen, um zu klären, wie das Unternehmen ihre Unternehmenskultur in Sachen Gender und Diversity verändern kann. Wissenschaftsinstitute und Universitäten in Deutschland scheinen das nicht zu brauchen. Da reicht schulterzuckend, meist männlicher Schultern, der Satz: Uns sind die Hände gebunden. Deshalb würde ich sagen, es gab nicht so sehr viele Widerstände. Gleichstellung und Diversity wollten immer alle, allein es fehlten manchmal die Taten.
ZOL: Gibt es rückblickend auf die Zeit als Gleichstellungsbeauftragte Erkenntnisse, die Sie zuvor nicht hatten, ein tieferes Verständnis für die Probleme der Gleichstellung im Wissenschaftsbetrieb?
Necker: Ich habe immer geahnt, wie schlimm alles ist. Aber als Gleichstellungsbeauftragte erhebt man gemeinsam mit der Institutsleitung jede Menge Zahlen, die die bestehenden strukturellen Ungleichheiten auch empirisch deutlich machen, was mitunter reichlich deprimierend ist. Und natürlich hat der Austausch mit den Kolleginnen, besonders als ich gemeinsam mit Elke Bauer vom Herder-Institut Sprecherin der Gleichstellungsbeauftragten der Sektion A der Leibniz-Gemeinschaft war, sehr viele Insights zu Tage gebracht, von denen ich vorher nichts wusste. Manche Schwierigkeiten, die etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen betreffen, waren einfacher zu beheben. Im IfZ gibt es mittlerweile jährlich ein von der Gleichstellungsbeauftragten initiiertes und von der Institutsleitung tatkräftig unterstütztes „IfZ-Sommercamp“, das in den Sommerferien für Kinderbetreuung im Institut sorgt. Oft kann auch individuell unterstützt werden. Problematisch und härter umkämpft zwischen Gleichstellungsbeauftragten und Institutsleitung wird es immer, wenn es um deutliche Eingriffe in die Struktur geht, z.B. bei Stellenbesetzungen etwa von Abteilungsleiter*innenstellen.
ZOL: Worin sehen Sie die Ursachen für die strukturelle Ungleichheit im Wissenschaftsbereich? Und wo fangen die Probleme an, die beginnen ja nicht erst im Forschungsbetrieb?
Necker: Darüber ließen sich ganze Abhandlungen verfassen. Aber kurz gesagt, fehlt es an zwei Dingen: Zum einen fehlt es an Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen auf Panels, in Zeitschriften, in Beiräten, in Gremien aller Art und natürlich auf der Leitungsebene, die die Bedingungen des Wissenschaftsbetriebs mitgestalten. Und zum Zweiten haben wir immer noch sehr eingefahrene Vorstellungen von Berufswegen und Lebensentwürfen, in denen Familiengründung und wissenschaftliche Karriere auf einen Timeslot zusammenfallen. Das kann nicht gut gehen, weder für Frauen noch für Männer.
Und das Ganze weiter gedacht, ist Gleichstellungsarbeit natürlich auch nicht nur im Kontext von Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sehen, sondern als generelles Thema für den gesellschaftlichen Diskurs. Deshalb habe ich am IfZ mit großer Unterstützung der Institutsleitung eine eigene Veranstaltungsreihe der Gleichstellungsbeauftragten mit dem Titel „Das ham’ wir gleich“ etabliert. Die Reihe soll städtische Öffentlichkeit in das IfZ bringen, um dort an der Schnittstelle von Stadt und Wissenschaftsbetrieb diese Fragen zu diskutieren. Und natürlich reflektiert der Titel der Reihe auf humorvolle Weise, dass Gleichstellung eben kein Selbstläufer ist, sondern viel Engagement und Diskussion notwendig sind, um auf diesem Gebiet Veränderungen zu erreichen.
ZOL: Wie haben Sie in den vielen Bewerbungsgesprächen, an denen Sie qua Amt beteiligt waren den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Bewerber*innen wahrgenommen?
Necker: Die Bewerber*innen hatten unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Strategien, in ein Bewerbungsgespräch hineinzugehen, und sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem Job, um den sie sich beworben haben. Den eigentlichen Unterschied habe ich stattdessen oft in der Kommission selbst wahrgenommen. Wie sehr die Kolleg*innen doch unterschiedlich auf männliche oder weibliche Bewerber*innen reagierten, war frappierend. Wie schnell Männern und Frauen bestimmte Kompetenzen zugeschrieben wurden, obwohl sowohl Lebenslauf wie auch die Person, die gerade noch vor der Kommission saß, einen ganz anderen Eindruck gemacht hat. Aber die Schubladenzuordnung sind wir – Männer und Frauen gleichermaßen – in allen Lebenslagen gewöhnt, es beginnt bei der rosa Puppe und dem blauen Plastikschraubenzieher und endet damit, dass Männern häufiger Durchsetzungsvermögen zugetraut wird als Frauen. Noch gravierender ist es bei Bewerber*innen, die sich diesen Zuordnungen entziehen: Männer, die zurückhaltend in ein Gespräch hineingehen, werden oft genauso misstrauisch beäugt wie Frauen, die besonders selbstbewusst auftreten.
ZOL: Was würden Sie jungen Wissenschaftlerinnen raten, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben?
Necker: Die Frage geht ausgerechnet an eine Wissenschaftlerin, die einen Weg genommen hat, der gerade nicht als Karriereberatung taugt. Oder vielleicht doch? Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, neugierig zu sein und sich nicht zu naiv und zu schnell auf vorgegebene und vermeintlich unveränderliche Karrierewege zu begeben. Ratschläge und Erfahrungen anderer Kolleginnen und Kollegen sind wichtig, doch muss jede ihren eigenen Weg gehen. Und bitte, was soll eine „Karriere“ in der Wissenschaft sein? Möglichst viel publiziert zu haben? Eine Dauerstelle zu bekommen? Tausende Follower auf twitter zu haben? Direktor*in zu werden? Oder mit Georg Kreisler gefragt: „Was hast Du davon, wenn ich Direktor bin?" Also ich würde raten, Karriere nicht anzustreben, sondern sie zu machen, auch wenn das jetzt sehr platt daherkommt. Aber da die Beschäftigungsverhältnisse so unsicher und in den meisten Fällen befristet sind, diffundiert doch ein klarer Zielpunkt. Insofern muss jede Wissenschaftlerin für sich entscheiden, in welchem Feld unserer Profession sie am ehesten und vor allem in welchem Umfeld sie arbeiten möchte. Ob das dann alles klappt, steht genauso wie eine „Karriere“ in den Sternen.
ZOL: Sie selbst sind seit vielen Jahren als Wissenschaftlerin und Künstlerin tätig. Wie schätzen Sie die gegenwärtigen Fortschritte ein? Gibt es überhaupt einen Fortschritt oder doch eher Stagnation?
Necker: Das kommt doch sehr darauf an, was wir als Fortschritt und was als Stagnation werten. Gleichstellungsarbeit, was de facto ja lediglich ein Beitrag zur Einhaltung des Grundgesetzes besonders von Artikel 3 ist, und so gesehen sich auf einem viel besseren Niveau befinden sollte, bleibt doch ein sehr mühsames Geschäft. Lohnenswert allemal politisch, aber persönlich war es sehr oft mit Enttäuschung, Wut und Empörung verbunden. Diese Empörung braucht es nach meiner Erfahrung auch, um etwas zu bewegen. Doch die Enttäuschung und Wut lässt sich auf Dauer nicht alleine tragen. Es braucht immer Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die im entscheidenden Moment in einer Sitzung, in einer Bewerbungskommission, auf einem Diskussionspanel mit die Stimme erheben. In München war das für mich neben vielen anderen die IfZ-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ute Elbracht und meine Stellvertreterinnen Annemone Christians und Anna Ulrich, die mich nicht zur einsamen Streiterin im Amt werden ließen.
Als Künstlerin erlebe ich das Feld ganz anders. Während in der Wissenschaft halbwegs funktionierende Strukturen zur Erreichung von Gleichstellung und Mitbestimmung etabliert sind, fehlen diese hier. Immer noch geht es um den ersten Schritt, der Sichtbarkeit von Regisseurinnen, Dramaturginnen, Musikerinnen, Komponistinnen, bildende Künstlerinnen, Bildhauerinnen, Kamerafrauen etc. und noch lange nicht um angemessene Teilhabe unter Kulturschaffenden. Ich selbst habe in Hamburg über 10 Jahre lang eine Konzertreihe für frei improvisierte Musik organisiert und habe versucht, bewusst für die Sichtbarkeit meiner Kolleginnen zu sorgen. Doch die tägliche Erfahrung als Musikerin und Komponistin für Klanginstallationen ist, bis heute wesentlich seltener eingeladen zu werden, vergessen zu werden, trotz vielfältiger Konzerttätigkeit. Man(n) übersieht so schnell die anderen 50%, die auch aufregende Konzerte spielen und Klangarbeiten realisieren und lädt stattdessen lieber seinen Kumpel ein. Deshalb bin ich froh um Netzwerke wie etwa femalepressure.net, die mit einer gut funktionierenden Mailinglist für Sichtbarkeit und Vernetzung weiblicher Musikschaffender sorgen.
Zitation
Sylvia Necker, „Diese Empörung braucht es!“. Ein Interview mit Sylvia Necker über ihre Erfahrungen als Gleichstellungsbeauftragte am Institut für Zeitgeschichte in München , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/diese-empoerung-braucht-es