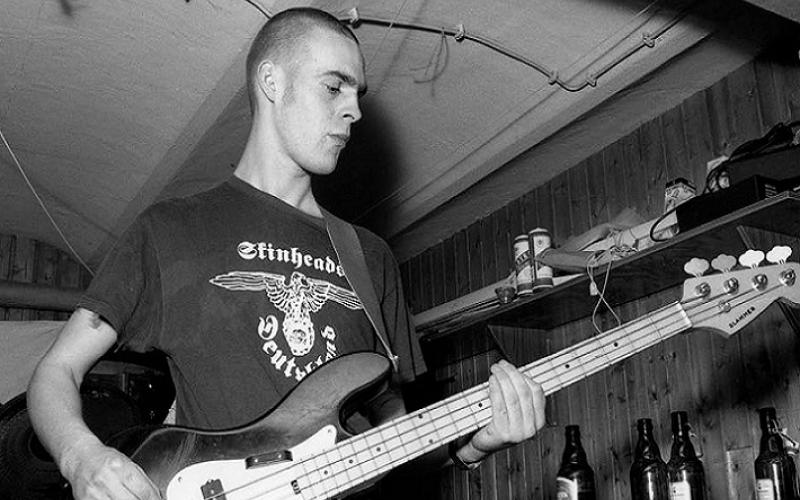„Mit Angst, Hass und entgrenzter Gewalt – und nicht mit Sektflaschen begann die Deutsche Einheit für Linke, Deutsche mit Migrationshintergrund, Ausländerinnen und Ausländer in vielen ostdeutschen Städten“, kommentierte unlängst Christian Bangel den 3. Oktober 2020 in DIE ZEIT. „Das war nicht nur ein schlechter Start der Deutschen Einheit. Es war ein Fanal für die neuen Zeiten.“ Tatsächlich bekamen die rechten Gewalteskalationen im Übergang von der DDR zur vereinigten Bundesrepublik, die von körperlicher Bedrohung und Herabsetzung bis zu tödlichen Angriffen reichten – zuletzt immer mehr Aufmerksamkeit. In manchen Regionen hatte diese „Gewalt der Vereinigung“ vor allem für nicht-weiße Personen, Wohnungslose und Linke eine permanente Bedrohungslage geschaffen.
Unter #Baseballschlägerjahre forderte Bangel vorletztes Jahr dazu auf, die Erinnerungen an die Vereinigungsgewalt zu teilen. Innerhalb einer Woche sammelten sich mehrere hundert kurze Einzelberichte an; im November 2020 veröffentlichte der RBB in Kooperation mit ZEIT ONLINE daran anknüpfend zusätzlich sechs Kurzfilme, die Schlaglichter auf einzelne Orte werfen und Geschichten von Bedrohung, Terror und Angst erzählen. Es gibt aber auch einige autobiographische Romane. Jene, die zu dieser Zeit ihre Jugend in Ostdeutschland erlebten, erzählen davon, wie sie angegriffen, bedroht und zusammengeschlagen wurden: Clemens Meyer in „Als wir träumten“ (2007), Peter Richter in „89/90“ (2015), Manja Präkels in „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ (2017).
Die autobiografischen Texte stehen im Mittelpunkt dieses Beitrages, da sie eine neue Perspektive auf die Erfahrung der Transformationsprozesse der Vereinigung eröffnen und sich mit einem anderen Phänomen der postsozialistischen Gesellschaft in Zusammenhang bringen lassen: der Abwanderung. Die enthemmte rechte Gewalt war für die in diesem Beitrag ausgewählten Berichtenden ein wichtiger Anlass, den Osten zu verlassen.
Abwanderung oder Heimatverlust?
Die Autorinnen und Autoren der hier behandelten Texte wurden in der DDR zwischen 1973 und 1979 geboren, erlebten ihre Jugend in den neuen Bundesländern und erzählen von der Vereinigungsgewalt. Alle kommen in diesen Erzählungen an einen Punkt, an dem sie entscheiden, den Ort der Gewalterfahrung zu verlassen. Nach dieser räumlichen und mentalen Distanzierung von ihrer Herkunftsregion beginnen sie nun, ihre Jugenderfahrungen zu bilanzieren und differenzierter auf die Transformation Ostdeutschlands zu blicken.
Um den Zusammenhang zwischen rechter Gewalt und der persönlichen Entscheidung zur Binnenmigration zu beschreiben, spreche ich von Heimatverlust. Als analytischer Begriff impliziert Heimat die Vorstellung einer sicheren und geborgenen Lebenswelt, die durch die Gewalterfahrung nachhaltig zerstört wurde.[1] Wie zu zeigen sein wird, handelt es sich zugleich um einen Quellenbegriff, mit dem die autobiografischen Sprecherinnen und Sprecher ihre Zugehörigkeit zu einem Ort und ihre Verbundenheit mit dessen sozialem Gefüge betonen. Gleichzeitig war Heimat immer auch ein politischer Kampfbegriff, der im rechtsextremen Sprechen eine zentrale Stellung innehat und dort rassistische und nationalistische Positionen chiffriert.[2] Gerade auch in den ersten Jahren nach der Vereinigung verstanden Neonazis unter dem Begriff des Heimatschutzes die gewalttätigen Aktionen gegen Menschen, die aus Deutschland vertrieben werden sollten. Diese Handlungsmuster hatten sich bereits in der späten DDR etabliert. Zahlreiche Angriffe richteten sich gegen Menschen aus Vietnam, Mosambik oder Algerien, es gab Brandanschläge auf deren Wohnheime und direkte Gewaltanwendung gegen ihre (körperliche) Präsenz. Ebenso wurden Punks und „alternative“ Jugendliche angegriffen.[3]
Nach 1990 verschränkten sich die ost- und westdeutschen Entwicklungen. Viele Vertreter*innen der rechtsextremen Szene in Westdeutschland erlebten die Vereinigung beider deutscher Staaten als nationale Erweckung. Inspiriert von den Inszenierungsformen und Handlungsmöglichkeiten der „nationalen Opposition“[4] in den neuen Bundesländern, planten nun westdeutsche Kader einen eigenen „Aufbau Ost“. Sie konzentrierten ihre politische Arbeit im Osten, integrierten die rechten Gruppen und imaginierten – wie das Beispiel Michael Kühnen zeigt – in Dresden eine neue „Hauptstadt der Bewegung“.[5] Nicht zuletzt dadurch konnten sie Rechtsextremismus auch fest in den neuen Bundesländern verankern und hier „national befreite Zonen“ mit Gewalt durchsetzen. Zugleich scheinen hier die rechtsextremen Angriffe in der alten Bundesrepublik fortgeführt zu werden, wo (vermeintliche) Kommunistinnen und Kommunisten seit den 1950er Jahren angegriffen wurden und neben „Ausländerstopp“-Kampagnen auch Übergriffe auf Geflüchtete stattfanden.[6]
Diese „Vereindeutigung“[7] der Heimatvorstellungen durch rechtsextreme Akteur*innen lässt es zuerst als widersinnig erscheinen, Heimat als Analysebegriff zu verwenden. Aber der Heimatverlust der Erzählenden resultierte direkt aus dem gewalttätigen Heimatschutz der rechten Schläger. Daher verdichtet sich im Sprechen von der Heimat diese Spannung und deckt direkt die vielfältigen Aneignungen auf. Ich behaupte jedoch keine essentialistische Verbindung zwischen Menschen und Herkunftsorten, vielmehr eignet sich der Begriff, weil er sowohl zeitgenössische Diskurse aufgreift, als auch eine historische Analyse von Selbstbeschreibungen erlaubt. Er bindet wie kaum ein anderer Begriff emotionalen Weltbezug und alltägliche Lebenspraxis zusammen, weshalb er unabhängig von politischen Systemen durchgängig Konjunktur hat.[8] Damit lassen sich die Erzählungen von der Vereinigungsgewalt als Berichte von veränderten Lebenswelten beschreiben und mit den unmittelbaren Effekten dieser Gewalthandlungen erklären: Heimat wurde zu einem Angstraum.
Die Vereinigungsgewalt erzählen
Die Gewalt der „Faschos“ ist elementarer Bestandteil vieler Erzählungen von der Transformation. Noch losgelöst von politischen Kontexten erzählt Clemens Meyer in „Als wir träumten“ die Gewalt der Rechten als ein Ringen um Leipziger Industriebrachen und den entstaatlichten Raum, die Auseinandersetzungen erscheinen als Geltungskampf um Männlichkeitsvorstellungen und subkulturelle Jugendstile. Peter Richter hingegen schildert in seinem Roman „89/90“ ganz explizit die gewaltförmigen Aktionsformen der Naziskins: Er erzählt die Friedliche Revolution in Dresden nicht als gewaltlosen Zusammenfall der alten Ordnung. Vielmehr betont er, dass körperliche Übergriffe und Konflikte den Prozess die ganze Zeit über begleiteten. Er verknüpft die Erzählung vom umfassenden Wandel der gesellschaftlichen Ordnung mit der eigenen Wendegeschichte und seiner ganz alltäglichen Erfahrung von gewaltförmiger Enthemmung. Das Ende der DDR beschreibt Richter als besonderen biographischen Bruch, da diese Gewalt von jenen ausging, die vorher zu Richters Freundeskreis zählten: Statt gemeinsam nachts ins Freibad einzubrechen oder die neu verfügbaren Tonträger zu feiern, jagten seine früheren Freunde nun Menschen über die Prager Straße, überfielen Hausprojekte und machten Jugendclubs zu Angsträumen.
Diese Erfahrungen stehen ebenfalls im Zentrum des Buches „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“. Darin formt Manja Präkels ihre Jugenderinnerungen aus dem Brandenburgischen in eine Verlusterzählung: Sie verliert darin den besten Freund, das Vertrauen in die Veränderungsbereitschaft ihrer Umgebung und letztendlich den Bezug zu ihrer Heimat. Manja Präkels bringt in dem Roman ebenso wie in späteren Wortmeldungen immer wieder die Spannung zum Ausdruck, die sie begleitet, wenn sie ihren Herkunftsort bedenkt und besucht: Sie fühlt sich dem Ort zugehörig und würde ihn als Heimat bezeichnen, zuweilen wohnen dort Menschen, denen sie verbunden ist. Aber die Erfahrungen des Nazi-Terrors haben daraus eine No-Go-Area gemacht. Die Gewalt war massiv, permanent möglich und direkt; die Erfahrungen reichten von alltäglichen Bedrohungen in den sozialen Räumen, die von Neonazis dominiert wurden, Treibjagden durch Straßen und über Felder bis hin zu exzessiven Schlägereien, bei denen Menschen getötet wurden. Im Zentrum von Präkels autobiographischem Roman steht die Eskalation der Gewalt von der Drohung bis zur Ausübung, die im Tod eines Freundes kulminiert. Mit diesem Ereignis wird ihre Heimat zur verbrannten Erde und die Bedrohung durch permanenten Terror dominiert das Geschehen.
Tatsächlich ist Terror in der Zusammenschau der hier vorgestellten Erzählungen auch als analytischer Begriff angemessen. Denn in allen Texten wird die Gewalterfahrung zum wesentlichen Katalysator für die eigenen Praktiken: Aus Angst selbst (wieder) ein Opfer der Gewalt zu werden, meiden fortan die Erzählerinnen und Erzähler Orte und Veranstaltungen, dunkle Straßen und offene Plätze, Sprechweisen und Gesten, bis sie schließlich die Dörfer und Städte verlassen. Dass damit die Strategie rechtsextremer Gruppen aufgeht, „national befreite Zonen“ zu schaffen, ist die bittere Quintessenz dieser Erzählungen. Letztlich haben rechte Gewalttäter den demokratischen Aufbruch in das vereinigte Deutschland gestört, indem sie alternative Lebensentwürfe und politischen Widerspruch marginalisierten und terrorisierten. Da sich Rechtsextreme unter dem Begriff Heimat vergemeinschafteten, ihn völkisch ausdeuteten und Heimatschutz als Aufforderung zur Gewalt verstanden, ließ diese Begriffsbestimmung keinen Platz mehr für alternative politische Weltdeutungen und erzeugte die Angst vor der eigenen Heimat.
Manja Präkels erzählt auch von ihren Bemühungen, der rechten Gewalt etwas entgegenzusetzen. Sie arbeitete lange für eine Lokalzeitung, um Strukturen und Gewalt sichtbar zu machen: Fehlten in den Berichterstattungen die politische Motivation der Gewalthandlungen, schrieb sie eigene Artikel dazu. Erfuhr sie von Versammlungen und Konzerten, zeigte sie diese bei der Polizei an. Jedoch veränderten ihre Bemühungen nicht den Umgang mit den Neonazis vor Ort. Vielmehr nahm für sie die Bedrohungslage durch ihr Engagement zu. Selbst nachdem sie die Region verlassen hat, berichtet sie von einem dumpfen Gefühl der Bedrohung: „In meiner ersten Zeit in Berlin habe ich darauf verzichtet, meinen Namen an die Klingel zu schreiben. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass jemand hinter mir her ist. So ganz verschwunden ist es nie.“ Präkels beschreibt den Heimatverlust damit als permanent – die Gewalterfahrungen der Transformation konfigurieren auch weiterhin ihre Vorstellungen von Sicherheit. Also imaginiert sie ihre Heimat als unerreichbaren Sehnsuchtsort: „Ich kann mir fast nichts Schöneres vorstellen, als hier über die Felder zu laufen oder im Wald Pilze zu suchen. Ich komme gerne her, mir gefällt der Landstrich. Ich mag Gegend und Menschen. Aber hier leben, das ist vorbei. Dafür ist zu viel passiert.“[9]
Christian Bangel hat neben seinen journalistischen Interventionen ebenfalls eine literarische Form für seine eigenen Erfahrungen gesucht. 2017 veröffentlichte er den Roman „Oder Florida“, der seine Jugend in Frankfurt/Oder schildert und dabei die Bedrohungslage und Gewaltpräsenz von Rechts als alltägliche Erfahrungsdimension integriert. Darin, wie in einem kürzlich erschienen Bericht der Reihe Baseballschlägerjahre, bringt er es auf den Punkt: Die alltäglichen Gewalterfahrungen und die permanente Angst, teilweise Todesangst, gehörten zu seiner ostdeutschen Jugend. Also hat er „seine Heimatstadt“ verlassen.[10]
Die Transformation ist in diesen Erfahrungen immer auch eine ambivalente; letztlich eröffneten sich für die Autorinnen und Autoren durch den gesellschaftlichen Wandel neue Perspektiven und Möglichkeiten. Sie konnten sich die Welt und ihre Umwelt neu erschließen, alternative Wissensräume entdecken und an unbekannten Diskursen teilhaben. Dafür verließen sie die neuen Bundesländer, studierten und entdeckten alternative Lebensentwürfe, die zuvor nicht möglich gewesen wären. Dennoch heben ihre Erzählungen darauf ab, dass sie Heimat – sowohl den aktuellen Wohnort als auch die Herkunftsregion – seitdem nicht mehr als sicheren Rückzugsort wahrnehmen: Bangel, Präkels und Richter mussten lernen, sich vielleicht nie wieder vollkommen sicher an ihrem Lebensmittelpunkt fühlen zu können; egal wie weit sie von den Orten der Gewalterfahrung weg waren.
Die Vereinigungsgewalt erforschen
Eine umfassende Analyse der Geschichte rechtsextremer Gewalt der Transformationsgesellschaft steht noch an ihrem Beginn. Die hier vorgestellten ersten Einblicke sind keine biographischen Erinnerungen – es sind autobiographische, literarische Narrationen. Jedoch teilen sie den Topos des Heimatverlustes. Dieser Verlust gründet in den Gewalterfahrungen ebenso wie der ausbleibenden Gegenwehr der sich neuformierenden Gesellschaft. In diesen Erzählungen gerinnt die Gewalt von Rechts zu einer generationellen Grunderfahrung. Vielstimmig und zugleich eindeutig, strukturieren und formatieren diese Erzählungen einen Erinnerungsdiskurs an die eigene Jugend in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, und integrieren damit generationelle Erfahrungen. Sie stecken die Grenzen des Sagbaren von den Gewalterfahrungen in der Transformationsphase mit symbolischen Repräsentationen und mit expliziten Beschreibungen ab. Zugleich binden sie diese in einem wiederum Identität stiftenden Narrativ zusammen.
Eine weitergehende Analyse von Zeitzeugen*innenberichten und Archivbeständen kann diese Erzählungen stützen und sie zugleich erweitern: In den Erfahrungsberichten unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre erscheint die Gewalt omnipräsent und alltäglich, sodass auch Christian Bangel von einer Generationenerfahrung spricht. Diese Erinnerungen müssen noch verifiziert und anhand von Belegen gesichert werden.
Bangel betont zudem, dass migrantische Perspektiven fehlen. Auch in diesem Beitrag wurden diese noch nicht berücksichtigt: Für sie alle war aber die Gewalt mindestens ebenso real, in vielen Fällen existenzieller. Migrant*innen waren im Fokus der rechtsextremen Täter*innen der frühen 1990er-Jahre. Dennoch, ja trotz der alltäglichen Ausgrenzung haben viele lange genug in der DDR und der vereinten Bundesrepublik gelebt, um in ähnlicher Weise Beziehungen und Verbindungen aufzubauen und (ost-)deutsche Identitäten zu entwickeln.[11] Ich möchte zum Schluss daher nochmal darauf verweisen, dass Gewalterfahrungen multiperspektivisch erzählt werden müssen und eine umfassende Geschichte rechtsextremer Gewalt in der Transformationsgesellschaft unbedingt migrantische Erfahrungen und Erinnerungen integrieren muss. Auch dieser Aspekt verweist erneut auf die Notwendigkeit einer geschichtswissenschaftlichen Erforschung der Zeitgeschichte der Rechten.
Es ist nun Aufgabe der historischen Transformationsforschung im weitesten Sinne, diese Erfahrungen systematisch zu erfassen, zu analysieren und kritisch zu befragen. Historiker*innen sind dabei gefragt, Polizeiakten, Medienberichte und Antifa-Recherchen zu untersuchen, Ego-Dokumente zu sammeln und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu interviewen, zeitgenössische Diskussionen und gesellschaftliche Beobachtungen in den Blick zu nehmen, die sozialen Konstellationen und politischen Möglichkeitsbedingungen herauszuarbeiten, die Diskurse, Akteure*innen und Praktiken der rechten Gewalt zu untersuchen. Es bedarf einer grundlegenden Erforschung der Verschränkung von Jugenderinnerungen und Gewalterleben. Ohne die Erforschung der Gewalterfahrungen in der postsozialistischen Transformationsgesellschaft, ist ein Verständnis ostdeutscher Gegenwarten nur schwer möglich.
[1] Vgl. auch Susanne Scharnwoski, Heimat. Geschichte eines Missverständnisses, Darmstadt 2019; in historischer Perspektive: Jens Jäger, Heimat, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 09.11.2017.
[2] Wolfgang Benz, „Heimat“ als Metapher im Diskurs der völkischen Rechten, in: Michael Kohlstruck, Andreas Klärner (Hg.): Ausschluss und Feindschaft. Studien zu Antisemitismus und Rechtsextremismus. Rainer Erb zum 65. Geburtstag, Berlin 2011, S. 124 –134. Timo Büchner, Der Begriff „Heimat“ in rechter Musik. Analysen – Hintergründe – Zusammenhänge, Frankfurt/Main 2020.
[3] Harry Waibel, Der gescheiterte Anti-Faschismus der SED. Rassismus in der DDR, Frankfurt/Main 2014; Die braune Saat. Antisemitismus und Neonazismus in der DDR, Stuttgart 2017. Diese Arbeiten sind vor allem unter dem Aspekt zu betrachten, dass sie auf das Ausmaß und die Quellenbelege rassistischer Gewalt verweisen und gezielte Recherchen ermöglichen. Da Waibel jedoch mitunter recht unkritisch mit den Quellen umgeht, sind die einzelnen Ereignisse jeweils zu überprüfen. Ich bereite dazu eine Publikation vor, die 2021 erscheinen wird.
[4] Gideon Botsch, From Skinhead-Subculture to Radical Right Movement. The Development of a ‚National Opposition‘ in East Germany, in: Contemporary European History 21 (2012), S. 553–573.
[5] Vgl. Hans-Gerd Jaschke, Biographisches Porträt. Michael Kühnen, in: Jahrbuch Extremismus und Demokratie 4 (1992), S. 168–180; Rainer Erb, Kühnen, Michael, in: Wolfgang Benz (Hg.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Bd. 8, Berlin 2015, S. 91 f.
[6] Vgl. auch Dominik Rigoll, Rechte Gewalt in und aus Deutschland. Ein Jahrhundertproblem, in: Luxemburg 2/2020. Zur kleinen, aber realen Emigration aus der Bundesrepublik in die DDR vgl. Bernd Stöver, Zuflucht DDR. Spione und andere Übersiedler, München 2009; Enrico Heitzer, DDR-Systemgegnerschaft von rechts. Anregungen für eine Perspektiverweiterung, in: Enrico Heitzer, Martin Jander, Anetta Kahane, Patrice Poutrus (Hg.), Nach Auschwitz: schwieriges Erbe DDR. Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der DDR-Zeitgeschichtsforschung, Berlin 2018, S. 64-82.
[7] Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt, Stuttgart 2018.
[8] Alon Confino, Germany as a Culture of Remembrance. Promises and Limits of Writing History, Chapel Hill 2006.
[9] Zit. n. Anna Fastabend, Wenn die eigene Heimat Angst macht, in: Süddeutsche Zeitung, 10.12.2017..
[10] Sehr ähnlich ist der Bericht von Christian Gesellmann, Warum ich aus Sachsen weggezogen bin, in: krautreporter.de, 11.03.2021.
[11] Nick Wetschel, Claudia Pawlowitsch, Nach der Vertragsarbeit. Ein Werkstattbericht zu Verschränkungen von Migration und Transformation am Beispiel Dresdens, in: Volkskunde in Sachsen. Jahrbuch für Kulturanthropologie 32 (2020), S. 239–258; dies., Neue Heimat Sachsen? ‚Heimat‘ als Argument in der Aushandlung von Migrationsgesellschaft, in: Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde, 03.11.2020; dies., Warum nicht nach Hause? Umbruchserfahrungen von Vertragsarbeiter*innen in Dresden, in: Ira Spieker (Hg.): Umbrüche. Erfahrungen gesellschaftlichen Wandels nach 1989 (Spurensuche. Geschichte und Kultur Sachsens 8), Dresden 2019, S. 56–67; Carsta Langner, „Affen und Banditen“ – über die historische Rekonstruktion von Rassismus und rechter Gewalt in der späten DDR, in: Wissen schafft Demokratie, Schwerpunkt: Kontinuitäten, Schriftenreihe des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, 07/2020.
Zitation
Johannes Schütz, Wenn Heimat Angst macht. „Gewalt der Vereinigung“ in biografischen Erzählungen , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/wenn-heimat-angst-macht