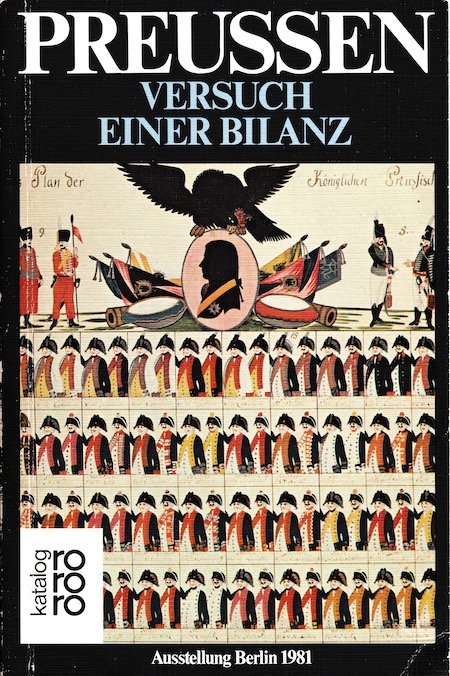Kaum eine Ausstellung hat eine derartige Aufmerksamkeit auf sich gelenkt wie diese. In der Zeitgeschichtsforschung ist die durch sie und mit ihr herbeigeführte epochale Zäsur unbestritten. Im Jahr 1981 bildete die Ausstellung „Preußen – Versuch einer Bilanz“ den Höhepunkt einer regelrechten „Preußenwelle“. Bereits gegen Ende der 1970er Jahre war ein gestiegenes Interesse der Öffentlichkeit an „deutscher“ Geschichte festzustellen.[1]
Die Debatte um die Preußen-Ausstellung im Westberliner Martin-Gropius-Bau und die Frage eines nationalen Geschichtsortes öffnete aber ebenso ein Fenster für die Erschließung des „Prinz-Albrecht-Geländes“, dessen Geschichte Anfang der 1980er Jahre (fast) vollkommen unbekannt war und an dessen Ort sich heute das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors befindet. Der „History Boom“ ging einher mit einem „Memory Boom“. Vielmehr noch: Beide verliefen nicht lediglich parallel, sondern sind verschränkt.
Ich möchte aufzeigen, dass beide – Preußen-Ausstellung und Topographie des Terrors – in den zeitgenössischen Debatten um den Umgang mit Vergangenheit verbunden sind. Doch zunächst skizziere ich knapp Vorgeschichte und Entstehung der Preußen-Ausstellung.
Ein Stück Preußen in Westberlin
Gegen Ende der 1970er Jahre hatte sich das lange von der SPD regierte Westberlin herausgeputzt. 1978 beschloss man die Instandsetzung und „Wiedergewinnung“ des innerstädtischen Altbaukerns der geteilten Stadt im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA). Auch bauliche Großprojekte wie das 1979 eröffnete Internationale Congress Centrum (ICC) oder das Philharmonie, Neue Nationalgalerie und Staatsbibliothek umfassende Gebäudeensemble des Kulturforums am Potsdamer Platz zeugen von dem Selbstverständnis der „Insel der Freiheit“ als einem kulturellen Zentrum. Bis zur 750-Jahr-Feier Berlins im Jahr 1987 sollte der „Zentrale Bereich West“ (ZBW) in neuem Glanz erstrahlen.
Fast beiläufig hatte der Regierende Bürgermeister Dietrich Stobbe (SPD) im Juni 1977 eine Ausstellung über Preußen angekündigt. Vorbild sollte die zu diesem Zeitpunkt in Stuttgart gezeigte Ausstellung „Zeit der Staufer“ sein, deren Erfolg man in Westberlin nacheifern wollte. Die Idee für eine Preußen-Ausstellung entstand aber an anderer Stelle, und zwar in den Gesprächskreisen des Verlegers Wolf Jobst Siedler und von Bundeskanzler Helmut Schmidt.[2] Die neue Ausstellung sollte das nun als Martin-Gropius-Bau firmierende ehemalige Kunstgewerbemuseum nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wiederbeleben. Der Bau war im Zweiten Weltkrieg schwer in Mitleidenschaft gezogen worden und seitdem baufällig, im Gegensatz zu den Ruinen des Völkerkundemuseum und Prinz-Albrecht-Palais in den 1950er und 60er Jahren wurde er jedoch nicht abgerissen. Der Maler Dieter Ruckhaberle, damals Leiter des Kunstamts Kreuzberg, hatte sich für den Erhalt des Gebäudes eingesetzt. Da kam die Preußen-Ausstellung gerade recht. Bereits im März 1981 hatte hier nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf eine Ausstellung über Karl Friedrich Schinkel ihre Pforten geöffnet. Schließlich sollte eine Ausstellung über „Preußen“ auch den insbesondere von dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Werner Knopp, befürchteten Attraktivitätsverlust Westberlins aufhalten helfen.
Es wurde ein Vorbereitungsausschuss unter Vorsitz von Stobbe und Dieter Sauberzweig (SPD), Senator für kulturelle Angelegenheiten, gebildet. Eingerahmt werden sollte die Ausstellung, deren Kosten mit 13 Millionen DM veranschlagt waren, in die von der Berliner Festspiele GmbH unter dem Intendanten und Festspiele-Geschäftsführer Ulrich Eckhardt organisierten Sommerfestspiele im August 1981 und die für September und Oktober geplanten 31. Berliner Festwochen. 1951, dem Jahr der Ostberliner Weltjugendfestspiele, unter dem Regierenden Bürgermeister Ernst Reuter (SPD) als „Berliner Festwochen“ ins Leben gerufen, um die internationale Kultur-, Theater- und Musikszene nach der Isolierung im nationalsozialistischen Deutschland nach Westberlin zurück zu holen und das „freie Berlin“ als „Schaufenster des Westens“ zu etablieren, hatte die 1967 gegründete Berliner Festspiele GmbH bedeutende Theateraufführungen und ab 1979 das „Festival der Weltkulturen“ organisiert. Nun also die Preußen-Ausstellung, die vom 15. August bis zum 15. November ihre Pforten öffnen sollte.
Doch lange vor seiner Eröffnung sorgte das Ausstellungsprojekt für Zündstoff auf Landesebene. In einer Großen Anfrage übte die FDP-Fraktion im Schöneberger Rathaus Kritik an den Vorbereitungen. Der Abgeordnete Jürgen Kunze kritisierte die Art und Weise der Planungen der Preußen-Ausstellung und fürchtete, dass diese ihr Ziel verfehle. In einer Plenarrede am 22. Mai 1980 bekundete er: „Die Preußenausstellung, wenn sie einen Sinn haben soll, muß die produktive Kontroverse über die preußische Geschichte nicht scheuen, sondern sogar bewußt in Kauf nehmen, wenn nicht sogar suchen“.[3] Dass die Ausstellung „wirklich eine souveräne Wertung unserer eigenen preußischen Geschichte im Sinne einer kritischen Bewältigung tatsächlich zu leisten“ im Stande sein könne, bezweifelte Kunze. Die Vergabe der Ausstellungskonzeption an die Berliner Festspiele und das diffuse Konglomerat an personellen Verantwortlichkeiten waren Gegenstand der Kritik des christdemokratischen Abgeordneten Uwe Lehmann-Brauns. Er fragte danach, warum die Verantwortung nicht „kompetenten Leuten“ übergeben worden sei. Die Mutlosigkeit des Senats beschere dem Publikum eine „tödlich langweilig[e]“ Ausstellung, so die Befürchtung. Sozialdemokrat Horst Kollat hingegen betonte, dass man die Existenz Preußens als „Coincidentia oppositorum“ (lat. Zusammenfall der Gegensätze) betrachten müsse, es in diesem Sinne also nicht um „Ausgewogenheit“ gehe könne. Die preußische Geschichte sei vielmehr als „eine höchst eigenartige Mischung von zwanghafter Staatsraison und gesellschaftlichen Normen, die äußerst progressiv sein können“, zu verstehen. Kollat wies zudem – ob unbewusst oder nicht – auf die erinnerungspolitische Dimension einer Befassung mit dem Thema „Preußen“ hin. So wandte er sich klar gegen aus seiner Sicht unzulässige Parallelisierungen von Preußen mit dem „Dritten Reich“: „Man muß aufhören mit dieser blödsinnigen Parallele, die nach 1945 uns Deutschen oktroyiert wurde, nämlich eine Linie zu ziehen von Friedrich dem Großen über Bismarck zu Hitler. Das ist Geschichtsfälschung, die wir nicht weiter betreiben wollen.“ Damit war der Ausstellung die politische Aufmerksamkeit gewiss.
Die Ausstellung...
„Versuch einer Bilanz“ – defensiver und zugleich entschlossener konnte man den Titel einer Ausstellung nicht wählen. Mit einer Exposition versuchte man einen Staat, seine Habenseite ebenso wie dessen Schulden zu bilanzieren, letztlich seinen Wert zu ermitteln. Zugleich sollte es nur der keineswegs abschließende Versuch dieses Summenspiels sein. Es galt, die über 300-jährige Geschichte Preußens in all seinen Facetten, mit seinen Widersprüchen und Brüchen abzubilden.
Schon das Gebäude – regelrecht ein „Kriegsinvalide“[4] – verlieh der Ausstellung den Charme des Provisorischen, des Bruchstückhaften und Unfertigen. Die Ausstellungsmacher*innen verfolgten keineswegs den Anspruch historischer Vollständigkeit, ebenso wenig war ihnen an einer bloßen chronologisch-ereignisgeschichtlichen Abfolge gelegen. Vielmehr sollten thematische Schwerpunkte gesetzt werden. Mit variierenden Raumdesigns und ungewöhnlichen Arrangements waren die Besucher*innen stets aufs Neue herausgefordert. So ging die Ausgestaltung der Exposition neue Wege. Das bis dahin gültige 2D-Dogma älterer Ausstellungen lehnten die Macher*innen der Preußen-Ausstellung ab. Die schiere Zahl der Ausstellungsstücke war beeindruckend. In 33 Räumen wurden etwa 2500 Exponate unzähliger öffentlicher und privater Leihgeber gezeigt. Die räumliche Inszenierung der Originale und das ensemblehafte Arrangement der Objekte sollte die Sinne der Besucher*innen anregen. Über den Weg der ironischen Brechung der Ausstellungsstücke versuchte man, dem Verdacht der Apologetik zu entgehen, was bei einem Thema wie Preußen fatale Auswirkungen hätte zeitigen können. Reichsgründer Kaiser Wilhelm I. wurde zum Schweben gebracht: Der Abguss des Kölner Reiterstandbilds hing im Lichthof des Gropius-Baus an einem Fesselballon sprichwörtlich in der Luft und verlor so seine dynastische Schwere. An anderer Stelle arrangierte man einen Kanzelaltar aus dem 18. Jahrhundert, zusammen mit einem Kirchenbänken nachempfundenen Holzgestell. Sichtachsen sollten zudem Perspektiven und Zusammenhänge erkennbar werden lassen. Im Lichthof präsentierten sich Dampfmaschinen und Riesenkanonen. Sogar lebende Seidenraupen bemühte man, um die friderizianischen Anstrengungen im textilen Gewerbe des 18. Jahrhunderts zu veranschaulichen. Der Blick aus dem Fenster eröffnete zudem die Sicht auf ein Roggenfeld. Preußen war ein Agrarstaat gewesen, der sich zum Industriegiganten mit Großmachtambitionen entwickeln sollte.[5]
Bei dem Seiteneingang – das Hauptportal war durch die direkt davor verlaufende Berliner Mauer versperrt – standen einige marmorne Herrscherstatuen die dereinst auf der Siegesallee Platz gefunden hatten. Der Erwerb der Eintrittskarten – 6 DM sowie zum halben Preis für Schüler*innen und Studierende – für die Ausstellung, die täglich bis 19 Uhr und am Wochenende sogar bis 23 Uhr geöffnet hatte, erfolgte in einem Entwürfen des Architekten Karl Friedrich Schinkels nachempfundenen Zelt. Die Brache sollte zudem mit einem Moses-Mendelssohn-Pfad entlang der Mauer wiederbelebt werden, der allerdings erst einige Jahre später 1987 zustande kam.[6]
... und ihre Macher*innen
Erdacht hatten dies alles der Architekt Jan Fiebelkorn, der Bühnenbildner Kai-Ernst Herrmann sowie die Gestalter Gottfried Engels und Jürg Steiner, der die Produktionsleitung übernahm. Mit der wissenschaftlichen Leitung war der Mannheimer Historiker Manfred Schlenke, der erster Vorsitzender der 1973 ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft zur preußischen Geschichte (APG) gewesen war, beauftragt worden. Ihm standen ein international besetzter 16-köpfiger Wissenschaftlicher Beirat sowie 16 weitere wissenschaftliche Berater (alle männlich) zur Seite. Den Vorsitz übernahm der Wirtschaftshistoriker Otto Büsch. Im Beirat saßen zudem die renommierten Historiker Karl Dietrich Bracher, Fritz Stern, Rudolf von Thadden und Reinhard Rürup, um nur einige Namen zu nennen. Bald schon kam es zu Reibereien unter den Beteiligten. So versuchte Büsch, die Planungen an sich zu reißen. Doch die Entmachtung der Berliner Festspiele misslang.[7] Mit der konkreten Ausgestaltung hatten weder Schlenke noch der Beirat etwas zu tun.
Zentrale Figur aber war der zum Generalsekretär berufene Kulturwissenschaftler Gottfried Korff, der mit seinem Diktum statt Preußens „Glanz und Gloria“ zeigen zu wollen, lieber „Land und Leute“ in den Mittelpunkt zu stellen, der Ausstellung sein Gepräge geben sollte. Ihm stand ein junges, progressives und überaus ambitioniertes Team zur Seite, in dem konservative Kreise bald eine „rote Zelle“ vermuteten.[8] Unter den 19 mit der Ausstellungsgestaltung betrauten wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen (15 Männer, vier Frauen) finden sich für die Berliner Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur so bedeutende Akteur*innen wie der Kunsthistoriker Heinrich Dilly, der heutige Leiter des Museums Neukölln, Udo Gößwald, oder Andreas Nachama, der spätere Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Nachama war über Heinz Galinski, den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, zum Team gestoßen und sollte Prolog sowie Epilog der Ausstellung gestalten. Zu einer Zeit, als das noch absolut unüblich war, setzte er dabei auch eine Videoinstallation ein.
Gerahmt werden sollte die Ausstellung durch fünf Begleitbände im Taschenbuch-Format, die in einer Kassette beim Rowohlt Verlag zum Kaufpreis von 45 DM erschienen. Neben dem sämtliche Ausstellungsstücke auflistenden Ausstellungsführer (Band 1), widmeten sich die Aufsätze des zweiten Bandes den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, während der dritte Band die Sozialgeschichte Preußens behandelte und sich Band 4 mit Kultur und Literatur befasste. Die Autor*innen des fünften und letzten Bandes beschäftigten sich mit der Rezeptionsgeschichte Preußens im Film. Unter ihnen finden sich einige heute bekannte Hochschullehrer*innen wie der Historiker Peter Brandt oder die Medizinhistorikerin Barbara Duden.[9] Ein Ausstellungsführer wurde für 3 DM zudem in englischer, französischer und türkischer Sprache angeboten. Im Nachgang erschien ein reich bebilderter Band der auch die Kontroversen um die Ausstellung dokumentierte.[10]
Am 15. August 1981, einem Samstag, wurde die Ausstellung mit einem morgendlichen Festakt in der Philharmonie feierlich eröffnet, nicht jedoch von Stobbe, der inzwischen von Richard von Weizsäcker als Regierender Bürgermeister abgelöst worden war. Es fehlten trotz Zusagen, Bundespräsident Karl Carstens und Bundeskanzler Helmut Schmidt. Bundesinnenminister Herbert Baum musste kurzfristig absagen. Gekommen waren neben den westalliierten Stadtkommandanten lediglich der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht und der Hohenzoller Prinz Louis Ferdinand von Preußen, um dem Festvortrag von Rudolf von Thadden beizuwohnen.[11] Anschließend (er-)öffnete die Eröffnungsfeier auf der östlich des Gropius-Baus gelegenen Brache mit einem klassischen Konzert unter dem Titel „Menschenbrüder – Musik zum langen Sterben Preußens“ einem breiten Publikum das Gelände und dessen widersprüchliche Geschichte.[12]
Die Berliner Festwochen selbst, ebenso wie schon die Internationalen Sommerfestspiele, standen ganz im Zeichen der Preußen-Ausstellung. Neben weiteren Ausstellungen – allen voran die als „absichtsvoll hergestellter Kontrapunkt“[13] gedachte Ausstellung „Musée sentimental de Prusse“ im Berlin Museum – wurden unzählige Veranstaltungen – Konzerte, Streitgespräche, literarische Abende, Theateraufführungen – dargeboten, so ein „Kulturlehrpfad der historischen Imagination“ mit dem Kunsttheoretiker Bazon Brock.[14]
Die Ausstellung und das Gestapo-Gelände
Als die Preußen-Ausstellung ihre Pforten öffnete, war die Geschichte des daneben brachliegenden, bald gemeinhin „Prinz-Albrecht-Gelände“ benannten Areals nicht mehr ganz unbekannt. Jahrzehntelang war „vergessen“, dass sich hier unter anderem die Zentrale der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) und ihr „Hausgefängnis“ sowie verschiedene SS-Dienststellen, so ab 1939 das Reichssicherheitshauptamt (RSHA), befunden hatten. Bereits im Rahmen des TUNIX-Kongresses im Januar 1978 inszenierte Stadtplaner Dieter Hoffmann-Axthelm den Ort, auf dem sich neben einer für die Flächensanierung Kreuzbergs genutzten Schutthalde ein Übungsgelände für Fahrschüler*innen, das „Autodrom“, befand, eine symbolische Wiederentdeckung. Daraufhin hatte Hoffmann-Axthelm für die IBA ein Gutachten erarbeitet, in dem er auf die historische Bedeutung des Geländes hinwies und sich für eine Debatte über dessen künftige Nutzung aussprach.[15]
Im Zuge der öffentlichen Diskussion rund um die Preußen-Ausstellung sollte diese Debatte nun angestoßen werden. Der „Antifaschistische Ausschuss“ der Internationalen Liga für Menschenrechte formulierte am 24. Januar 1980 in einem Offenen Brief an Innensenator Peter Ullrich (SPD) im Vorfeld seine Sorge um eine Überlagerung des Opfergedenkens angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit zum Thema Preußen und fragte: „Wenn im Jahre 1981 mit viel Aufwand an das alte Preußen erinnert wird – wer denkt dann an die Erniedrigten und Beleidigten, die in direkter Nachbarschaft unsägliche Qualen erleiden mußten?“[16]
Die Ausstellung im Gropius-Bau griff diese Kritik auf. Die Behandlung des Nationalsozialismus nahm einen zentralen Platz innerhalb der Ausstellung ein: Hitler, Göring, Goebbels und Rosenberg wurden mit Bekenntnissen zu Preußen zitiert. Dieser Teil der Ausstellung beschränkte sich ansonsten auf einige wenige Wahlplakate und Erläuterungen. Die Nachbildung eines Sargs mit der Zahl der während der Shoa ermordeten Juden und Jüdinnen bestimmte den vorletzten Ausstellungsraum über „Preußen im Nationalsozialismus“ (Raum 32). Der Besuchende sollte „zuletzt noch einmal innehalten“, hieß es im Katalog.[17] Die Macher*innen wollten verdeutlichen: Preußen habe Charakterzüge gehabt, die dem Nationalsozialismus „Vorschub“ geleistet hätten.
Man wollte den Blick auf das Gestapo-Gelände richten, eine Verbindung herstellen. So fiel der Blick der Besucher*innen im Raum durch ein – ausnahmsweise nicht abgedunkeltes – Fenster nicht nur auf die Silhouette Ostberlins, sondern genau auf die geschichtsträchtige Brache. Ein vor dem Fenster in einer Vitrine ausgestellter Geländeplan zeigte das Areal vor seiner Zerstörung. Eine mehrsprachige Hinweistafel machte die unscheinbare Brache als Ort des NS-Terrors kenntlich.
Gedenkstätte oder Museum
Die Ausstellung war gerade eröffnet worden, als die Berliner Morgenpost vorschlug, das Areal um den Gropius-Bau zu einer „nationalen Gedenkstätte für die Opfer der Unmenschlichkeit“ umzugestalten und im ehemaligen Kunstgewerbemuseum selbst ein „Museum nationaler Geschichte – und Tragödie“ einzurichten.[18] Doch genau darum ginge es eben nicht, so Architekturkritiker Hoffmann-Axthelm, denn „monolithische nationale Gedenkstätten bauen konnten die Nazis auch.“[19]
Da ging die Debatte bereits in eine ganz andere Richtung: In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sinnierte man angesichts der Preußen-Ausstellung: „Die Zeit ist reif, in Berlin – und nur in Berlin – ein repräsentatives Museum für deutsche Geschichte zu gründen“.[20] Ein „Museum der deutschen Geschichte“, dafür schien die Zeit reif in der Bundesrepublik. Im Jahr 1982 verkündete der neue Bundeskanzler Helmut Kohl eine stärkere Hinwendung zur Nationalgeschichte – Befürworter*innen wie Gegner*innen als Teil einer„geistig-moralischen Wende“[21] bekannt – und griff die von Bundespräsident Walter Scheel eingebrachte Idee der Gründung einer „Sammlung der deutschen Geschichte“ in Bonn wieder auf. Fünf Jahre später wurde aus Anlass der 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin der Aufbau des Deutschen Historischen Museums (DHM) durch Bundesregierung und Senat beschlossen, das sich sein Domizil wahlweise im Reichstagsgebäude oder im Gropius-Bau finden sollte, nachdem Kohl bereits auf dem 35. Historikertag 1984 in Westberlin die Idee eines solchen Geschichtsortes wieder aufgenommen hatte. Während das DHM die deutsche Geschichte bis 1945 darstellen sollte, sei das Haus der Geschichte der Bundesrepublik der Entstehung und Entwicklung der selbigen zu widmen.
Die Preußen-Ausstellung hatte die Diskussion um eine (Nach-)Nutzung des Gropius-Baus eröffnet, doch stritten Vertreter*innen der Politik und Kulturschaffende um die inhaltliche Ausgestaltung des Gebäudes. Das exponat- und heimatlose DHM erfand sich 1990 neu, als es das im Ostberliner Zeughaus beheimatete Museum für Deutsche Geschichte der abgewickelten DDR übernahm. 1994 wurde in der alten Bundeshauptstadt am Rhein das Haus der Geschichte der Bundesrepublik feierlich eingeweiht. Seit 2001 betreiben die Berliner Festspiele den Gropius-Bau als Ausstellungshaus.
Topographie des Terrors
Doch auch die Erforschung der Geschichte des Gestapo-Geländes war inzwischen fortgeschritten. Um die künftige Nutzung des gesamten Areals entbrannten in den 1980er Jahren Diskussionen. Die Vorstellungen reichten von einem Wiederaufbau des Prinz-Albrecht-Palais über einen begrünten Stadtpark bis hin zur Errichtung eines Holocaust-Mahnmals, das dann 2005 südlich des Brandenburger Tors eingeweiht wurde.
Im Abgeordnetenhaus rangen die Parteien um eine angemessene Würdigung der Verbrechen des Nationalsozialismus und seiner Opfer am Täter-Ort. Anlässlich des 50. Jahrestages der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten kam die Idee einer Ausstellung auf. Im November 1981 hatte die Alternative Liste (AL) unter dem Eindruck der enormen Ausgaben für die Preußen-Ausstellung beantragt, Gelder für eine „Ausstellung im Jahre 1983 zur Machtergreifung der NSDAP im Jahre 1933“ bereitzustellen. Tatsächlich waren Haushaltsmittel aus einigen ehemaligen preußischen Bankhäusern in Millionenhöhe vorgesehen. Ursula Schaar (AL) sprach sich in einer Debatte am 28. Januar 1982 jedoch entgegen dem vorherigen Antrag ihrer Fraktion gegen eine große Schau ähnlich der Preußen-Ausstellung aus und plädierte für eine Vielzahl von Ausstellungen und Veranstaltungen im Jahresverlauf 1983. Parallel diskutierte man wiederholt über Nutzungsmöglichkeiten für Gestapo-Gelände und Gropius-Bau. Schließlich reichte die SPD-Fraktion einen Antrag auf „Errichtung eines Mahnmals für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ ein. Zu prüfen sei, ob das Gestapo-Gelände als Ort einer solchen Gedenkstätte in Betracht käme.[22]
Zentrale Akteurin in der ganzen Zeit war der im Gedenkjahr 1983 gegründete Verein „Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin“, die den Prozess der Erschließung in den folgenden Jahren kritisch begleitete. Die vielerorts einsetzende „Erinnerungsarbeit“ (Wolfgang Ruppert) der oft als „Barfußhistoriker“ (Hans-Ulrich Wehler) Gescholtenen erst machte es möglich, historische Aufklärung für die Gegenwart zu betreiben, konkret: sich selbst ins Verhältnis zur nationalsozialistischen Vergangenheit zu setzen. So hatten im Sommer 1986 archäologische Grabungen auf Initiative der Grabe-wo-du-stehst[23]-Aktiven die Fundamente des Prinz-Albrecht-Palais zutage gefördert und die historische Bedeutung des Geländes noch einmal unterstrichen. Das Aktive Museum setzte sich auch dafür ein, dass ein Dokumentationszentrum als Teil der Planungen einbezogen wurde. Dafür kam zwischenzeitlich sogar das Deutschlandhaus in Betracht. Die Idee war jedoch schnell verworfen – in dem in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Gebäudekomplex eröffnete zuletzt das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Eine enorme Rolle spielten abermals die Berliner Festspiele. Denn die Trägerschaft überließ Kultursenator Volker Hassemer keineswegs dem als „links“ verschrienen Aktiven Museum. Eine „Verlegenheitslösung“, wie Ulrich Eckhardt später feststellte. Gottfried Korff und Reinhard Rürup hatten im Gropius-Bau die zentrale Ausstellung zur 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin organisiert. Die Ausstellung „Berlin, Berlin“ thematisierte auch die Zeit des NS-Regimes. Günter Morsch, der später über viele Jahre die Leitung der Brandenburgischen Gedenkstätten innehatte, war einer der Verantwortlichen für die Ausstellungsräume, die sich dem Aufstieg und dem Terror der Nazis widmeten. Gropius-Bau und Gestapo-Gelände sollten fortan als Einheit zusammen gedacht und entwickelt werden. Der 2018 verstorbene Historiker Rürup, der auch maßgeblich an der Gründung des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin (1981) beteiligt gewesen war, ist seitdem eng mit der Entwicklung des Geländes verbunden. In seinem Kolloquium an der TU tummelte sich so manche*r Akteur*in. Rürup war es auch, der 1987 mit dem Kurator Frank Dingel einen Pavillon konzipierte, der dem heutigen Gedenkort bereits seinen Namen verlieh: Topographie des Terrors. Über eine angemessene Verdauerung der temporären – Eckhardt verstand sie als „transitorische“ – Ausstellung und eine Ablösung des Provisoriums stritten die Beteiligten in den Folgejahren.[24] Noch vor dem Mauerfall 1989 konnte die Ausstellung im Ostteil der Stadt gezeigt werden. 1992 gründete sich die unselbständige Stiftung Topographie des Terrors unter dem Festspiele-Dach, die 1994 verselbständigt wurde. Die Realisierung eines ersten Architektenentwurfs scheiterte hingegen und Rürup trat zurück. Erst im Jahr 2010 konnte das Dokumentationszentrum eröffnet werden.[25]
In der Vogelperspektive zu sehen sind Gropius-Bau (links) und die Brache des Gestapo-Geländes mit dem „Autodrom“. Im Hintergrund die Berliner Mauer und das Reichsluftfahrtministerium. Foto: Margret Nissen, Lizenz: Mit freundlicher Genehmigung von Margret Nissen.
Blick auf den Gropius-Bau und den 1986 errichteten Ausstellungspavillon des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors. Foto: Margret Nissen, Stiftung Topographie des Terrors, Lizenz: Mit freundlicher Genehmigung von Margret Nissen, Stiftung Topographie des Terrors.
Fazit
Als die Preußen-Ausstellung am 15. November 1981 schloss, hatten sie fast 575 000 Besucher*innen gesehen. Es war das bis dahin teuerste Ausstellungsprojekt Berlins.[26] Die Ausstellungsmacher*innen unternahmen auch den Versuch, das Verhältnis zum Nationalsozialismus zu „verorten“. Im Zuge der Diskussionen um die Ausstellung hatte sich eine nachhaltige Debatte um das Gestapo-Gelände entsponnen. Zwar war die Geschichte des Geländes nicht von den Ausstellungsmacher*innen „wiederentdeckt“ worden, aber man griff die Nachbarschaft auf und integrierte sie in eine Beziehungsgeschichte Preußens zum Nationalsozialismus. Gleichwohl stand die Ausstellung selbst wie auch die Debatte um den Ort Preußens in der deutschen Geschichte stärker im Zeichen der Frage nach Kontinuitäten zum Nationalsozialismus. Eine praktische Erinnerungsarbeit an konkreten Orten wie dem Gestapo-Gelände war damit (noch) nicht verbunden. Diese kam erst im Verlauf der kommenden Jahre zustande. Aber schon damals erkannte Gottfried Korff die von der Ausstellung ausgehenden „Langzeitwirkungen bei der Formierung eines allgemeinen und eben nicht preußischen Geschichtsbewußtseins.“[27]
Mein Dank gilt besonders Ulrich Eckhardt, der geduldig meine Fragen beantwortete. Nützliche Hinweise gaben mir Thomas Lutz, Dominik Rigoll, Matthias Stange, Ulrich Tempel und Anne Wanner. Für die freundliche Genehmigung zur Nutzung der Fotografien danke ich der Stiftung Topographie des Terrors, Stefanie Endlich und Margarete Nissen. Unterstützung bei der Bereitstellung erhielt ich außerdem von Ulrich Eckhardt, Werner Friedrich, Jürg Steiner und Ulrich Tempel.
[1] Franka Maubach, Normalisierung und Kritik. Zum „Geschichtsboom“ seit den 1980er Jahren, in: Tim Schanetzky et al. (Hg.), Demokratisierung der Deutschen. Errungenschaften und Anfechtungen eines Projekts, Göttingen 2020, S. 238-251; Gabriele Metzler, Der Staat der Historiker. Staatsvorstellungen deutsche Historiker seit 1945, Berlin 2018, S. 205-210; Edgar Wolfrum, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zu bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990, Darmstadt 1999, S. 316-325.
[2] Gespräch mit Ulrich Eckhardt vom 23.8.2021.
[3] Dieses und folgende Zitate nach Plenarprotokoll Ausgabe 1980/81, 8. Wahlperiode, Band II, 1980/1981, 19.-53. Sitzung, 27. Sitzung vom 22. Mai 1980, S. 1206, 1209, 1210.
[4] Preußen: Resümee und Rückbesinnung, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 17.8.1981, S. 19.
[5] Gottfried Korff, Zur Einleitung, in: Ulrich Eckhardt (Hg.), Preußen – Versuch einer Bilanz. Bilder und Texte einer Ausstellung, Berlin 1982, S. 14-17; ders., Zielpunkt: Neue Prächtigkeit? Notizen zur Geschichte kulturhistorischer Ausstellungen in der „alten“ Bundesrepublik [1996], in: ders., Museumsdinge. deponieren – exponieren, hg. von Martina Eberspächer, Gudrun Marlene König und Bernhard Tschofen, Köln 2007 [2002], S. 24-48, hier: S. 35; Hartmut Boockmann, Zwischen Lehrbuch und Panoptikum: Polemische Bemerkungen zu historischen Museen und Ausstellungen, in: Geschichte und Gesellschaft 11 (1985), 1, S. 67-79, hier: S. 76 f.
[6] Die Geschichte bringt Leben an die Wüste an der Mauer, Berliner Morgenpost v. 19.7.1981, S. 7; Preußens Anatomien in zehn Bildern, Berline Morgenpost v. 13.8.1981, S. 3; Geschichtsporträt mit Sechser und Seidenraupe, Berliner Morgenpost v. 15.8.1981, S. 3; Ulrich Eckhardt, Der Moses Mendelssohn Pfad. Eine Berliner Zeitreise oder Wanderwege in eine versunkene Stadt, Berlin 1987.
[7] Lukas Uhde, 1981. Preußen – Versuch einer Bilanz, in: Mario Schulze, Anke te Heesen, Vincent Dold (Hg.), Museumskrise und Ausstellungserfolg. Die Entwicklung der Geschichtsausstellung in den Siebzigern, Berlin 2015, S. 109-121, hier: S. 110.
[8] Geburtszange und Flohfalle neben den Werken Kants (Bodo-Michael Baumunk), Berliner Zeitung-Magazin v. 26./27.5.2001, S. 6-7.
[9] Gottfried Korff (Hg.), Preußen. Versuch einer Bilanz. Ausstellungsführer, Bd. 1; Manfred Schlenke (Hg.), Preußen. Beiträge zu einer politischen Kultur, Bd. 2; Peter Brandt (Bearb.), Preußen. Zur Sozialgeschichte eines Staates, Bd. 3; Hellmuth Kühn (Hg.), Preußen. Dein Spree-Athen. Beiträge zu Literatur, Theater und Musik in Berlin, Bd. 4; Axel Marquardt, Heinz Rathsack (Hg.), Preußen im Film. Eine Retrospektive der Stiftung Deutsche Kinemathek, d. 5, alle Reinbek b. Hamburg 1981.
[10] Ulrich Eckhardt (Hg.), Preußen – Versuch einer Bilanz. Bilder und Texte einer Ausstellung, Berlin 1982.
[11] „Preußen – Versuch einer Bilanz“. Ausstellung mit Festakt eröffnet, Der Tagesspiegel v. 16.8.1981, S. 1; „Über Geschichte sprechen, dann wird sie zum gemeinsamen Besitz“, Die Welt v. 17.8.1981, S. 3; Verschlußsache. Preußen-Ausstellung eröffnet, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 17.8.1981, S. 19.
[12] Stefanie Endlich, Die Schauplätze der Geschichte zum Sprechen bringen. Vom Umgang mit historischen Orten, in: Die Berliner Festwochen. Eine kommentierte Chronik 1951-1997, hg. von der Berliner Festspiele GmbH, Berlin 1998, S. 158-164, hier: S. 159 f.; Angela Rosenberg, Festspielgeschichten: Das Nachbargrundstück, 28.6.2021; Dariuš Zifonun, Gedenken und Identität. Der deutsche Erinnerungsdiskurs, Frankfurt am Main 2004, S. 60.
[13] Ulrich Eckhardt, Geleitwort, in: Marie-Louise von Plessen, Daniel Spoerri, Le Musée sentimental de Prusse. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH vom 16. August bis 15. November 1981, Berlin 1981, S. 6.
[14] Berliner Festwochen 81. Magazin, hg. von der Berliner Festspiele GmbH, [Berlin 1981]. Siehe auch Ulrich Eckhardt, Berliner Festwochen im 5. Jahrzehnt. Eine subjektive Chronik, in: Die Berliner Festwochen. Eine kommentierte Chronik 1951-1997, hg. von der Berliner Festspiele GmbH, Berlin 1998, S. 8-123, hier: S. 69-71; Torsten Mass, Die Stadt als Spielstätte. Versuch einer Bilanz in vier Kapiteln, in: ebda., S. 170-189, hier: S. 174.
[15] Dieter Hoffmann-Axthelm, Prinz-Albrecht-Palais oder Reichssicherheitshauptamt?, in: Bauwelt 1982, H. 43, S. 1778-1787.
[16] Offener Brief der „Internationalen Liga für Menschenrechte“ an den Senator für Inneres vom 24. Januar 1980 (Text 81), in: Reinhard Rürup (Hg.), Topographie des Terrors. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt auf dem „Prinz-Albrecht-Gelände“. Eine Dokumentation, 14. überarb. u. erweit. Aufl., Berlin 2020 [zuerst 1987], S. 208.
[17] Korff, Preußen, S. 592.
[18] Hier saß das Hirn des Grauens. Plädoyer für eine nationale Gedenkstätte, Berliner Morgenpost v. 30.8.1981, S. 3.
[19] Hoffmann-Axthelm, Prinz-Albrecht-Palais, S. 1779.
[20] Peter Jochen Winters, „Ein Museum für Deutsche Geschichte“, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 15.8.1981.
[21] Zu Begriffsgeschichte und Konstruktionscharakter siehe Peter Hoeres, Von der „Tendenzwende“ zur „geistig-moralischen Wende“. Konstruktion und Kritik konservativer Signaturen in den 1970er und 1980er Jahren, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 61 (2013), 1, S. 93-119, bes. 104.
[22] Plenarprotokoll Ausgabe 1981/82, 9. Wahlperiode, Band I, 1981/1982, 1.-18. Sitzung, 10., 15. u. 18. Sitzung vom 12.11.1981, 28.1. u. 11.3.1982, S. 527, 848, 1030.
[23] Cornelia Siebeck, „Grabe, wo du stehst!“. Motive der Neuen Geschichtsbewegung in der Bundesrepublik der 1980er-Jahre, in: Lernen aus der Geschichte, 27.2.2019.
[24] Zit. nach Endlich, Die Schauplätze der Geschichte zum Sprechen bringen, S. 162 f.
[25] Siehe u. a. Matthias Haß, Das Aktive Museum und die Topographie des Terrors (= Notizen, Bd. 4), Berlin 2012, S. 29-53; Reinhard Rürup, Die Berliner Topographie des Terrors in der deutschen NS-Gedenkstättenlandschaft, in: vorgänge 169 (2005), 1, S. 75-92, bes. S. 78-82; Matthias Stange, Ein „Täterort“ im Erinnerungsdiskurs. Von der Mauerbrache zur „Topographie des Terrors“ 1981-1987, in: Hanno Hochmuth, Paul Nolte (Hg.), Stadtgeschichte als Zeitgeschichte. Berlin im 20. Jahrhundert (= Geschichte der Gegenwart, Bd. 22), Göttingen 2019, S. 301-329; Ulrich Tempel, Der Ort der „Topographie des Terrors“, in: Michael Disqué, Andreas Gehrke (Hg.), Land’s End. Der Ort der „Topographie des Terrors“ im Spiegel zeitgenössischer Fotografie, Berlin 2019, S. 95-104; Jenny Wüstenberg, Zivilgesellschaft und Erinnerungspolitik in Deutschland seit 1945 (= Memory Sudies, Bd. 2), Berlin 2020, S. 121-141; Ein Treffen im „Sprechzimmer der Geschichte“ [Gespräch mit Dieter Hoffmann-Axthelm und Andreas Nachama], in: Bauwelt 16 (2010), S. 12-19; „Es kam eigentlich zum richtigen Zeitpunkt“. Ulrich Eckhardt und Thomas Flierl im Gespräch über die Präsentation der Ausstellung Topographie des Terrors in der DDR, in: GedenkstättenRundbrief 196 (2019), S. 10-19.
[26] 575 000 Besucher bei Preußen-Ausstellung, Der Tagesspiegel v. 17.11.1981, S. 4; Preußen- ein Komplex mit mancher Lücke, Berliner Morgenpost v. 15.11.1981, S. 7.
[27] Gottfried Korff, Preußen – Versuch einer Bilanz [1981], in: ders., Museumsdinge. deponieren – exponieren, hg. von Martina Eberspächer, Gudrun Marlene König und Bernhard Tschofen, Köln 2007 [2002], S. 232-240, hier: S. 232.
Zitation
Yves Müller, Bilanz eines Versuchs. Die Preußen-Ausstellung von 1981, das nationalsozialistische Erbe und die „Topographie des Terrors“, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/bilanz-eines-versuchs