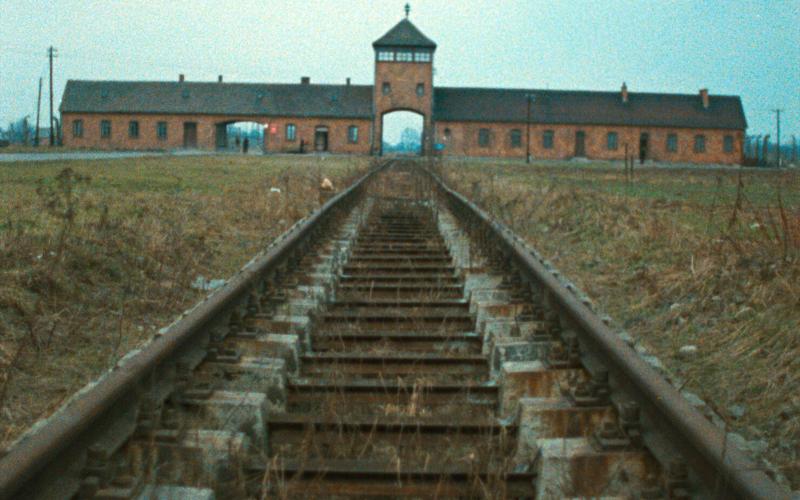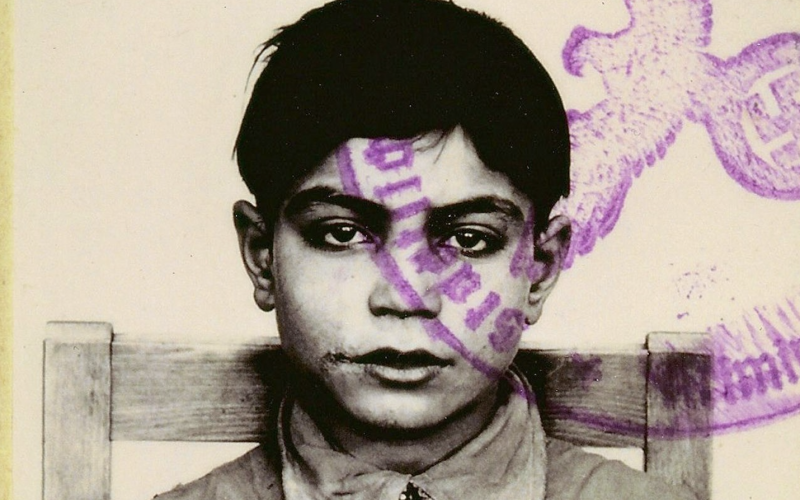Das Kino Arsenal in Berlin Schöneberg 1973: Vom 15. bis zum 18. November fand dort das Erste Internationale Frauen-Filmseminar statt. „Seminar“, falls sich jemand wundert, musste die nicht von einem Filmfestival unterscheidbare Veranstaltung aufgrund von Sponsorenauflagen heißen. Vorgestellt wurden damals 45 Filme aus sieben Ländern. Das Festivalprogramm kam einer Pionierinnenarbeit gleich. 250 Teilnehmer:innen, die in Frauengruppen aktiv waren oder in der Medienbranche arbeiteten, waren eingeladen.
Auf dem Ersten Internationalen Frauen-Filmseminar wurde selbst auch gefilmt. Die Kamera des norwegischen Kameramanns Georg Helgevold Sagen läuft, der Ton, verantwortet von Ivar Rolland, auch. Vor die Kamera tritt Vibeke Løkkedal. Die damals 28-jährige norwegische Filmemacherin führte während der Veranstaltung Gespräche mit den Initiatorinnen des feministischen Filmfestivals Claudia von Alemann und Helke Sander sowie einer Handvoll Akteurinnen aus der auch internationalen Film- und Fernsehbranche wie Angelika Wittlich, Christiane Schäfer, Nurith Aviv, Annabelle Miscuglio und Ariel Maria Dougherty. Unter den Anwesenden und Gesprächspartnerinnen waren zudem einige bekanntere Feministinnen wie die Journalistin Alice Schwarzer – mit einer sagen wir mal nicht unauffälligen Redebereitschaft – oder auch eine nicht namentlich angeführte, so lässt der Akzent vermuten, Schweizer Ärztin. Letztgenannte wollte nach eigenen Aussagen durch die Teilnahme an jenem Filmseminar in einen Austausch mit anderen Frauen treten und ihre Solidarität ausdrücken. Die Situation der Frauen sei doch berufs- und klassenübergreifend vergleichbar.
Das Treffen diente in erster Linie der Vernetzung, die Aufnahmen von und mit Løkkeberg sollten Missstände aufzeigen und dokumentieren. Der Plan, nach dem Seminar einen Film über die Arbeitsbedingungen in der Filmbranche zu veröffentlichen, konnte aufgrund von eingestellter Förderung nicht weiterverfolgt werden.[1] Das Material verschwand für eine lange Zeit, bis es vor ein paar Jahren in der Norwegischen Nationalbibliothek wiederentdeckt wurde. Auch nach der dazugehörigen Tonspur musste erst gesucht werden. Der Film “The Long Road to the Director’s Chair” macht das während des Frauen-Filmseminars gedrehte dokumentarische Material erstmals mit Bild und Ton für die Öffentlichkeit zugänglich. Løkkeberg editierte das aufgefundene Rohmaterial.
Gezeigt wird die Dokumentation während der diesjährigen 75. Berlinale in der Sektion Forum Special. 2023, genau 50 Jahre nach dem Frauen-Filmseminar, wurden bereits Teile des Films in Kooperation mit dem Festival „feminist elsewheres“ in Berlin aufgeführt, damals noch ohne Tonspur und mit Livekommentar von damals Beteiligten.[2] Ein weiteres Screening legte den Fokus auf den Arbeitsprozess des Films: Løkkeberg, Claudia von Alemann, Helke Sander und die Filmwissenschaftlerin Ingrid S. Holtar führten ein Werkstattgespräch, nachdem erste Ausschnitte von „The Long Road to the Director’s Chair“ gezeigt worden waren.[3]
Insgesamt, das macht der Film deutlich, bestand während des Seminars Redebedarf über weit mehr als die Produktionsbedingungen feministischer Filme oder die Machtverhältnisse in der Medienbranche. Die Gespräche umfassten unter anderem Sexualität und Lust, alternative Arbeitsorganisation und die Situation der internationalen Frauenbewegung. Schwarzer meint passend dazu: „Die Frauenfrage legt sich wie ein Raster über alles.“ Diese zeitgenössische Wahrnehmung spiegelt auch die vor Ort ausgestellte Kunst wider, die teilweise als Kulisse für die Gespräche diente.[4]
Neben den Gesprächen in unterschiedlicher Besetzung – womöglich wurden diese zwischen den Programmpunkten gedreht – fängt der Film die Stimmung während des Filmseminars ein. Im Vorraum des Kinos Arsenals, damals noch in Schöneberg im Westen Berlins zu Hause oder in einem größeren Raum in der gegenüberliegenden Schule kamen viele junge und einige ältere Teilnehmer:innen zu Diskussionen und einer abschließenden Pressekonferenz zusammen. Zuschauer:innen von “The Long Road to the Director’s Chair” sehen dabei zu, wie die Teilnehmer:innen denken, filmen, fotografieren, Notizen machen, reden, rauchen, in Gedanken abschweifen, aufstehen, quatschen, rauchen, sich umarmen, Informationsmaterial mustern und einstecken, lachen, um Ruhe bitten, streiten und rauchen. Dadurch, dass die Diskussionen und Zusammenkünfte stumm und mit melancholischer Musik unterlegt sind, haben diese Szenen eine künstlerische Dimension und bilden einen Kontrast zu den spontanen Gesprächen, deren Inhalte kurz nachhallen können.
Die Kamera schwenkt über die Menge und fängt die unterschiedlichsten, durch einige Nahaufnahmen fast intimen, Momente ein. Nahezu geriet ich durch die dadurch erzeugte melancholische Atmosphäre in Versuchung, die vergangene Zeit zu verklären – bis die Gespräche wieder einsetzten. Deutlich wird ein ums andere Mal, wie die Akteurinnen jede auf ihre Weise oder auch gemeinsam Kämpfe mit ihren Kolleg:innen, mit dem Patriarchat, ausfochten. Immer wieder fällt der Satz, dass sie extra hart arbeiten müssten, um für ihr Können wertgeschätzt zu werden. Es geht um Akzeptanz und Anerkennung in einer von Männern dominierten Branche. Einige Gesprächsteilnehmerinnen berichten von sexueller Belästigung. Von kollektiven, widerständigen Praktiken erfahren wir Zuschauer:innen jedoch auch. Etwa, dass einzelne Arbeitsaufgaben auf mehrere Schultern verteilt wurden, um mehr Zeit für feministische Arbeit und Kunst zu haben, oder dass von verschiedenen Kolleg:innen zusammengestohlenes Material dazu verwendet wurde, um nicht auf die Finanzierung eigener Filme warten zu müssen.
Nach der #Metoo-Debatte, die in der Filmbranche ihre Wurzeln hat, erscheint es uns heute selbstverständlich, dass wir über die Erfahrungen anderer Personengruppen und Einzelpersonen wissen. Zur Zeit des ersten Frauen-Filmseminars Anfang der 1970er Jahre ging diese Praxis, eigene Erfahrungen zu teilen und sie in einen größeren gesellschaftspolitischen Kontext einzuordnen, gerade erst los. Im Lauf der Folgejahre fanden sich immer mehr feministische Vernetzungs- und sogenannte Selbsthilfegruppen.
Das wiederentdeckte Material zeigt, wie schon damals versucht wurde, Missstände zu dokumentieren und an eine breitere Öffentlichkeit zu tragen, um kollektives Problembewusstsein herzustellen, sich weiter zu vernetzen und auch Alternativen aufzuzeigen. Zu sehen bekommen wir das Resultat eines über 50 Jahre alten Projekts leider erst jetzt, was uns daran erinnert, dass immer noch entscheidend ist, wer, wann, welche Filme zeigen darf und kann.
[1] Vgl. Inrid S. Holtar: Out of the Margins of Feminist Filmmaking. Vibeke Løkkeberg, Norway, and the Film Cultures of 1970s West Berlin, in: Anna Weserstahl Stenport, Arne Lunde (Hrsg.): Nordic Film Cultures and Cinemas of Elsewhere, Edinburgh 2019, S. 85-93, hier S. 90.
[2] Erstes Internationales Frauenfilm-Seminar, Veranstaltung am 11.06.2023, Arsenal 1, zuletzt abgerufen am 12.02.2025.
[3] Long Road to the Director’s Chair: Scenes from an Unfinished Film Project by Vibeke Løkkeberg, Veranstaltung am 08.11.2023, Arsenal 1, zuletzt abgerufen am 12.02.2025.
[4] Die Kunst stammte von der Projektgruppe Emma der HdK um Evelyn Kuwertz, Birgitte Mauch und Antonia Werney, Berlin 1970-73. Nachdem die Ausstellung, die dezidiert im öffentlichen Raum stattfinden sollte, mehrmals an anderer Stelle abgelehnt wurde, stellten sie auf dem Filmseminar aus, mehr dazu auf der Webseite von Evelyn Kuwertz, zuletzt abgerufen am 12.02.2025.
Zitation
Alina Müller, “You always have to proof something”. Die wiederentdeckte Dokumentation des Ersten Internationalen Frauen-Filmseminars 1973, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/you-always-have-proof-something