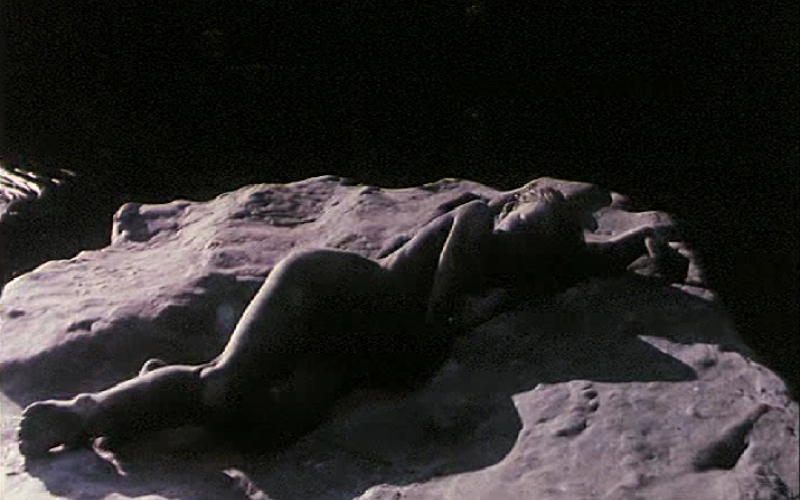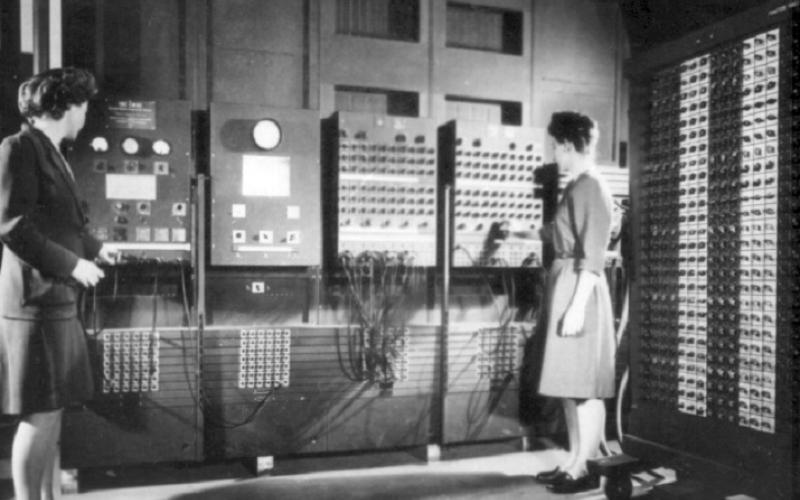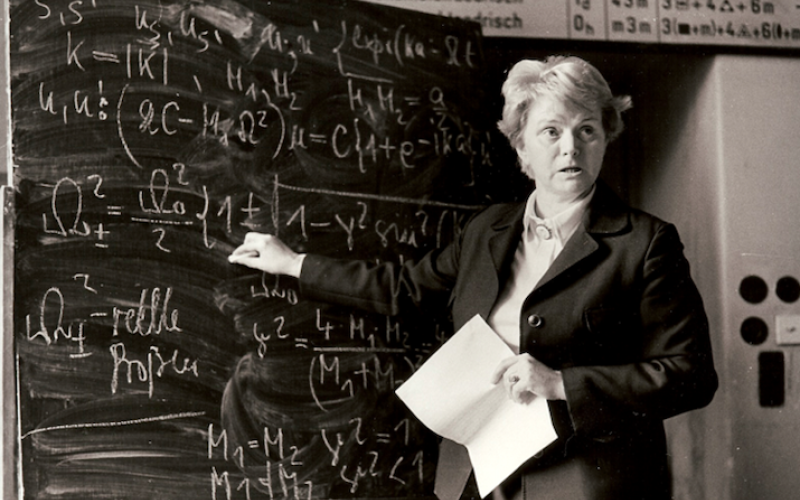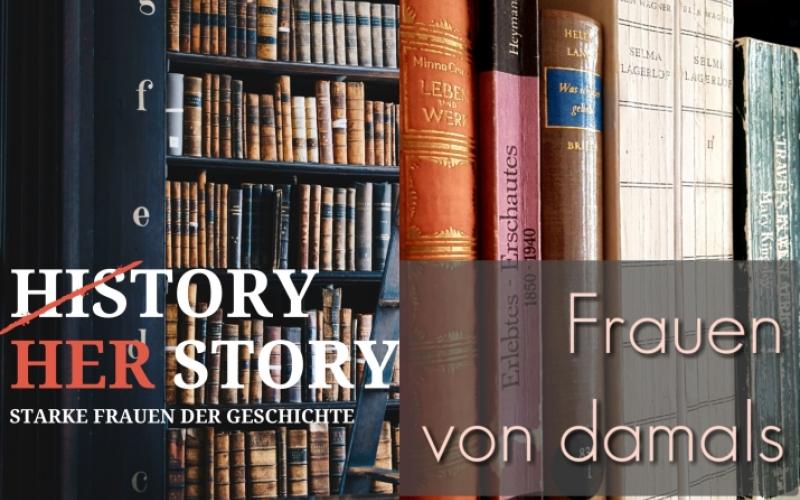Wir haben alle Interviewpartner*innen am Ende unserer Gespräche gefragt: Welche Empfehlungen würden Sie dem (weiblichen) Nachwuchs* mit auf den Weg geben, damit wir in Zukunft mehr Chancengleichheit in der Wissenschaft errreichen?
Julia Erdogan, assoziierte Doktorandin am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam
Janine Funke, assoziierte Doktorandin am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam
Anna Kaminsky, Direktorin/Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Teresa Koloma-Beck, Professorin für Soziologie der Globalisierung an derUniversität der Bundeswehr München
Mareike König, Abteilungsleiterin Digital Humanities und Leiterin der Bibliothek am Deutschen Historischen Institut Paris
Ein Erfolgsrezept habe ich leider auch nicht, und jeder und jedem, die oder der in der Wissenschaft eine Karriere anstrebt, muss unter den gegebenen Umständen damit rechnen, dass es nicht weiter als bis nach der Promotion klappt. Im wissenschaftlichen Nachwuchs regt sich zunehmend Widerstand gegen die Bedingungen. Unter #unbezahlt kann man auf Twitter die Debatte verfolgen und sich einmischen. Allgemein würde ich dazu raten, offen zu sein, sich zu vernetzen, einen eigenen Weg zu gehen und den Spaß an der Wissenschaft nicht zu verlieren. Jungen Frauen würde ich zusätzlich raten, sich eine Mentorin zu suchen und noch stärker Ausschau zu halten nach anderen Frauen, die ihnen helfen oder sie fördern können. Je höher man dann auf der Karriereleiter kommt, umso wichtiger wird es, sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen.
Simone Lässig, Direktorin des GHI Washington
Ermuntert Euch und sensibilisiert die männlichen* Kollegen immer wieder! Chancengerechtigkeit in jeglicher Hinsicht gemeinsam zu schaffen ist ein Ideal, an dessen Annäherungen immer weiter gearbeitet werden muss.
Sylvia Necker, von 2015 bis 2017 Gleichstellungsbeauftragte am Institut für Zeitgeschichte München
Die Frage geht ausgerechnet an eine Wissenschaftlerin, die einen Weg genommen hat, der gerade nicht als Karriereberatung taugt. Oder vielleicht doch? Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, neugierig zu sein und sich nicht zu naiv und zu schnell auf vorgegebene und vermeintlich unveränderliche Karrierewege zu begeben. Ratschläge und Erfahrungen anderer Kolleginnen und Kollegen sind wichtig, doch muss jede ihren eigenen Weg gehen. Und bitte, was soll eine „Karriere“ in der Wissenschaft sein? Möglichst viel publiziert zu haben? Eine Dauerstelle zu bekommen? Tausende Follower auf twitter zu haben? Direktor*in zu werden? Oder mit Georg Kreisler gefragt: „Was hast Du davon, wenn ich Direktor bin?" Also ich würde raten, Karriere nicht anzustreben, sondern sie zu machen, auch wenn das jetzt sehr platt daherkommt. Aber da die Beschäftigungsverhältnisse so unsicher und in den meisten Fällen befristet sind, diffundiert doch ein klarer Zielpunkt. Insofern muss jede Wissenschaftlerin für sich entscheiden, in welchem Feld unserer Profession sie am ehesten und vor allem in welchem Umfeld sie arbeiten möchte. Ob das dann alles klappt, steht genauso wie eine „Karriere“ in den Sternen.
Carla Schriever, Gründerin von Fem4ScholarMentoring-Programm
Eva Schlotheuber, Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands
Annette Vowinckel, Abteilungsleiterin »Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft« am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam(gemeinsam mit Jürgen Danyel)
Sybille Wüstemann, Gerda Henkel Stiftung (Pressearbeit und Veranstaltungsmanagement)
Im Jahr 2006 veröffentlichte die damalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes Jutta Limbach einen Beitrag mit dem Titel „Zur Situation von Wissenschaftlerinnen im Kontext gesellschaftlicher Normen und Strukturen“. Darin diagnostizierte sie:„Die Frauen sind Klasse, aber nicht Spitze. Wohl halten die Frauen inzwischen die Hälfte der Hörsäle besetzt, doch gilt das nicht für Lehrstühle.“ Schaut man sich zum Vergleich die Zahlen des Bundesforschungsministeriums für 2017 an, gilt das immer noch: Der Anteil der Frauen zu Studienbeginn liegt bei 50 Prozent. Bei Habilitationen und Professuren fällt dieser Satz dann ab, im Jahr 2017 auf 29,3 bzw. 24,1 Prozent. Die Kluft zwischen Männern und Frauen ist damit zwar deutlich geringer als etwa in den frühen 1990er Jahren, aber immer noch nicht geschlossen. Der Rat an Nachwuchswissenschaftlerinnen würde lauten: hier ansetzen, sich auf dem eigenen akademischen Weg nicht beirren lassen und die Partner mit ins Boot holen.
Lale Yildirim, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Friedrich-Meinecke-Institut Arbeitsbereich Didaktik der Geschichte.
Irmgard Zündorf, Koordinatorin des Studiengangs Public History an der Freien Universität Berlin
Zitation
Rebecca Wegmann, Sophie Genske (Hg.), Empfehlungen unserer Interviewpartner*innen an den wissenschaftlichen Nachwuchs, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/empfehlungen-unserer-interviewpartnerinnen-den-wissenschaftlichen-nachwuchs