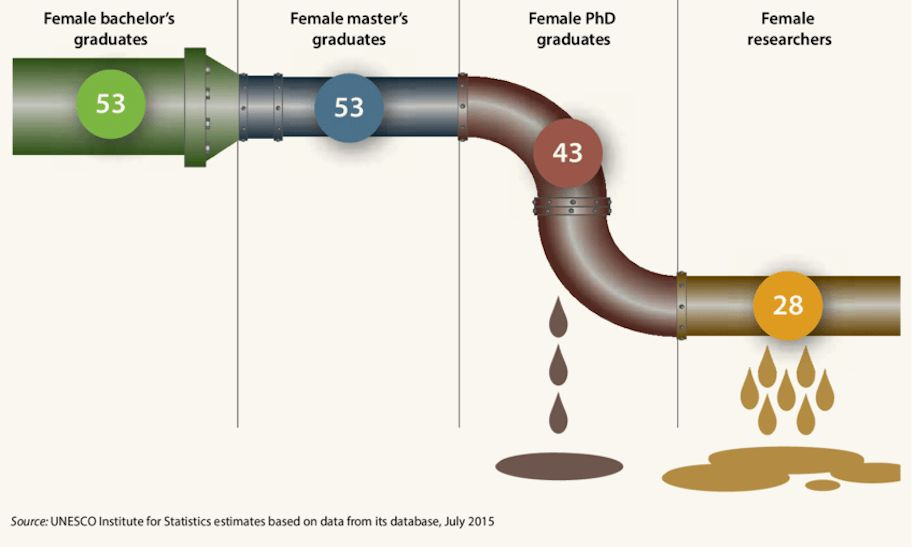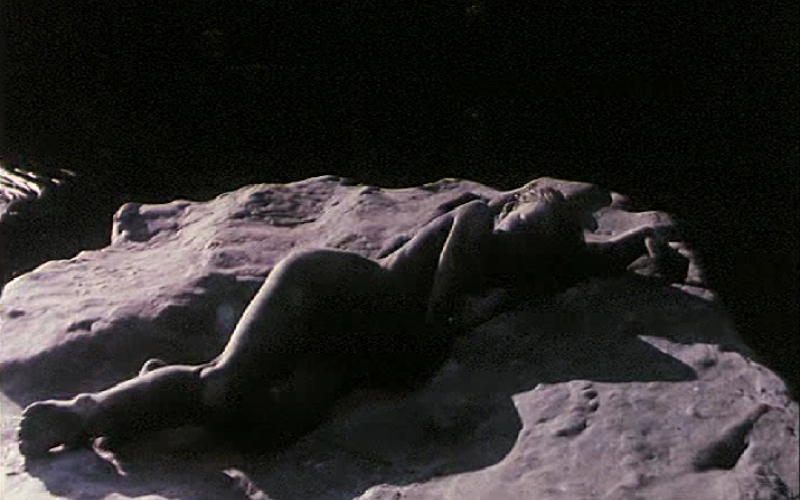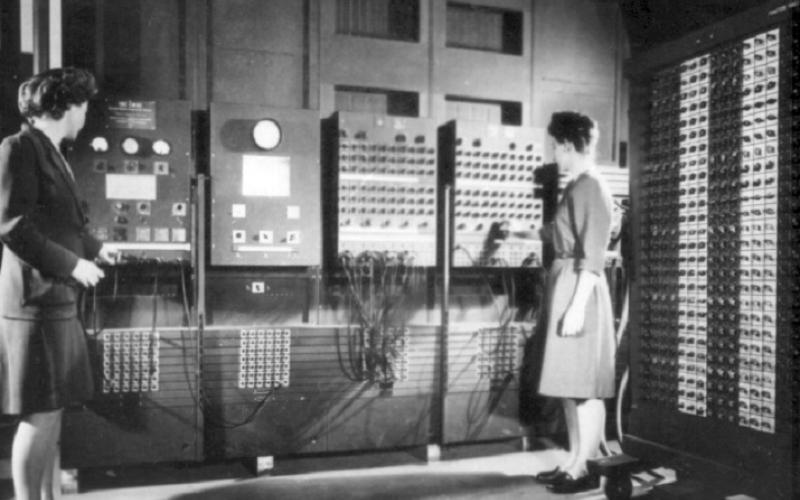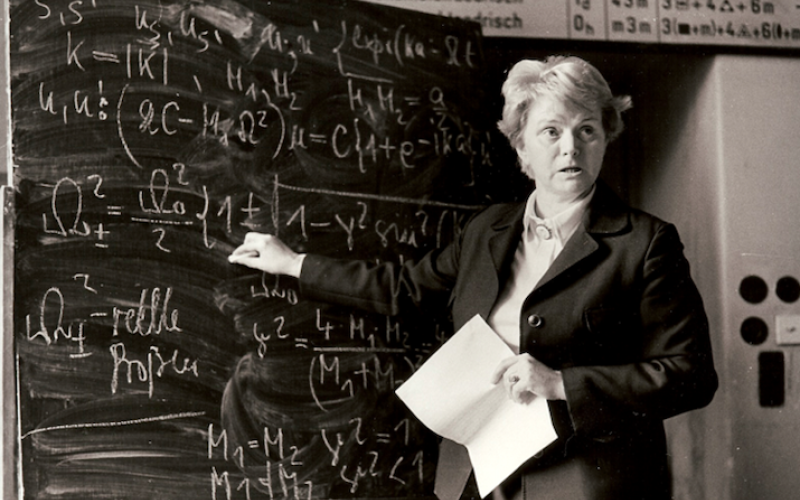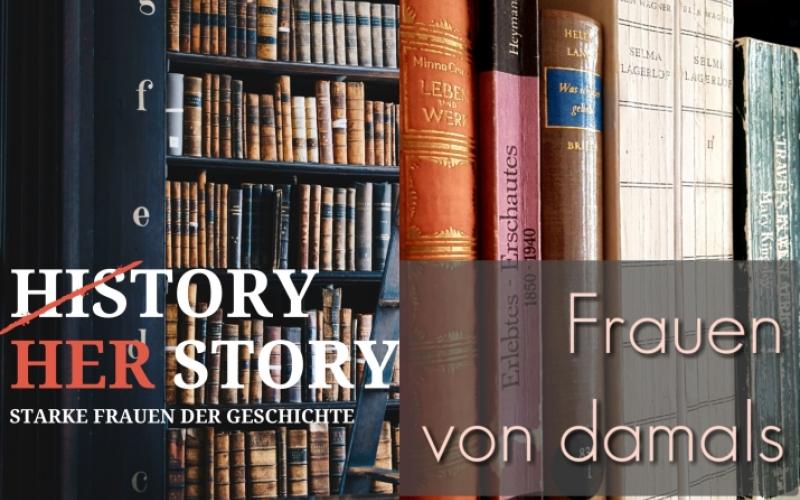Am zweiten Tag des histocamps 2019 in der Rosa-Luxemburg Stiftung in Berlin haben Sophie Genske und Rebecca Wegmann für zeitgeschichte|online die Teilnehmer*innen zu einer Session zum Thema Frauen* in der Wissenschaft eingeladen.
Am Nachmittag des 23. November 2019 versammelten sich über dreißig Teilnehmer*innen des histocamps, darunter auch eine Hand voll männlicher Teilnehmer, um für zwei Stunden über das Thema zu sprechen. Ursprünglich sollte die Diskussion gefilmt werden, auf Wunsch der Diskussionsteilnehmer*innen wurde sich letztlich aber dagegen entschieden. Das Gespräch wurde stattdessen transkribiert, um es in schriftlicher und anonymisierter Form zu veröffentlichen.
Im ersten Teil der Session stellten Sophie Genske und Rebecca Wegmann das Anliegen des Themenschwerpunktes „Frauen* in der Wissenschaft“ vor. Sie fassten die Beiträge des Themenschwerpunktes kurz zusammen, berichteten über Erfahrungen, die sie im Verlauf der Gespräche mit den Wissenschaftlerinnen gesammelt haben, und präsentierten beispielhaft drei Interviewausschnitte, die Anregung für die Diskussion geben sollten.
zeitgeschichte|online: Habt Ihr Fragen zum Themenschwerpunkt an uns?
Teilnehmerin: Ich möchte keine Diskussion lostreten. Aber mich interessiert, wofür in eurem Titel das Sternchen steht?
zeitgeschichte|online: Am Anfang war die Überlegung, nicht von einer binären Sichtweise auszugehen, sondern offen für alle Interviewparter*innen zu sein. Wir wollen alle mit einschließen und hätten gerne auch transsexuelle oder intersexuelle Personen interviewt. Falls ihr beispielsweise eine Person kennt, die bereit wäre, mit uns zu sprechen, würden wir uns über eure Tipps sehr freuen.
Eine Frage, die wir in ähnlicher Form unseren Interviewpartner*innen gestellt haben, würden wir gern auch an euch richten: Wie interagiert ihr mit Gleichstellungs(plänen), wie setzt ihr Gleichstellung um? Habt ihr Kontakt zu eurer Gleichstellungsbeauftragten?
Teilnehmerin: Ich spreche aus studentischer Perspektive. Ich weiß, wer unsere Gleichstellungsbeauftragte ist, allerdings ist die Kommunikation meiner Meinung nach nicht wirklich vorhanden. Oder die Kommunikation ist aufgrund der bestehenden Hierarchien problematisch. Das ist bei Gleichstellungsfragen noch recht unproblematisch, schlimmer ist es bei Antidiskriminierungs- und Rassismusfragen. Äußerst schwierig ist es, wenn diese Ämter mit Personen besetzt sind, die problematisches Verhalten an den Tag legen, wo sie eigentlich helfen, vermitteln und einspringen müssten.
zeitgeschichte|online: Für uns war bei der Erarbeitung des Themenschwerpunkts wichtig, dass wir das Thema auch positiv durchleuchten. Wir wollten nicht nur über die negativen Aspekte schimpfen und wiederholen, dass sich das System ändern muss. Entsprechend haben wir jede der von uns interviewten Personen gefragt, welche Initiativen oder Organisationen, die gute Arbeit machen und versuchen, die Gleichstellung voranzutreiben, sie kennen und empfehlen. Unsere letzte Frage in jedem Interview war andersherum außerdem: Was empfehlen Sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs? Der Schlüsselbegriff in allen Antworten darauf lautete: Netzwerken, so viel wie möglich – nicht nur nach oben, in höhere Ebenen, sondern auch und vor allem auf der jeweils eigenen Ebene. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Teilnehmerin: In meiner bisherigen beruflichen Laufbahn in der Wissenschaft konnte ich beobachten, dass besonders Frauen keine Frauen fördern. Viele Frauen haben explizit und offen kommuniziert, dass sie lieber männliche Mitarbeiter haben. Demgegenüber waren die männlichen Kollegen, denen ich bis jetzt begegnet bin, sehr unterstützend, helfend und kooperativ und sind keinesfalls sexistisch gewesen. Ich habe die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass Frauen durchaus eher zu „Stutenbissigkeit“ neigen. An einigen Stellen fördern Frauen weniger das eigene Geschlecht, als man das vielleicht erwartet. Die Variante habe ich erfahren.
Teilnehmerin: Ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast. Denn ich habe tatsächlich die Erfahrung genau andersherum gemacht. Wobei ich vielleicht ein bisschen Glück hatte mit meiner Position. Bei mir war es so: Ich habe in Hamburg studiert. Zu diesem Zeitpunkt waren viele Professorinnen an meiner Universität, die sich explizit für die Förderung von Frauen eingesetzt haben. Ich bin nach dem Studium in mein erstes Arbeitsverhältnis mit einer ganz tollen Chefin gegangen, die Wert auf Offenheit legt und selbst aktiv Frauen fördert.
Im Gegensatz dazu war ich als Studentin in einer Lehrveranstaltung einer Professorin, die den Spieß in Bezug auf Geschlechterdiskriminierung umgedreht hat. Bei dieser Professorin hatten vor allem männliche Kommilitonen Probleme. Meine Mitstudenten wurden von dieser Professorin sehr viel kritischer beurteilt. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ich finde, bei Gleichstellung geht es darum, für alle – egal welcher Geschlechtsidentität - gleiche Chancen zu schaffen.
Teilnehmerin: Was ich problematisch finde, ist, dass der Schlüssel zum akademischen Networking häufig im Alkoholkonsum liegt. (Einige Teilnehmer*innen lachen laut) Das ist wirklich wahr. Networking steht oft in Verbindung mit Alkoholkonsum und passiert u.a. in Kneipen, auf irgendwelchen Festen, Weihnachtsfeiern oder Grillabenden. Das gilt nicht nur für die Geschichtswissenschaften, sondern auch für andere Fächer. Mir persönlich ist das sehr unangenehm.
Während meines Deutsch-Studiums habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass vor allem jene Studierenden die Hilfskraftstellen bekommen haben, die mit den Dozierenden draußen gemeinsam geraucht haben. Wenn man weder raucht noch sich besonders gerne betrinkt, dann ist man sowieso schon einmal außen vor. Das finde ich ziemlich schwierig.
Teilnehmerin: Ich bin Journalistin und arbeite dementsprechend nicht direkt in der Wissenschaft. Ich habe geschlechterdiskriminierendes Verhalten bei Männern und Frauen erlebt. Ich weiß nicht, ob das „Stutenbissigkeit“ ist, oder, ob es einfach nur dieses Narrativ der „Stutenbissigkeit“ ist. Es sind nur wenige Frauen. Es können nur wenige Frauen schaffen. D.h. ich muss den Platz, den ich habe, verteidigen, weil hier nur Platz für eine ist. Das System ist toxisch. Ich weiß nicht, ob es die Frauen an sich sind. Was ich erlebt habe, dass es mir in dem Moment, wo ich persönlich angefangen habe, andere Frauen mehr zu sehen, ihnen mehr Platz zu geben, mehr zu empfehlen, ohne dass ich davon einen Vorteil hatte, zugutegekommen ist. Ich habe mir mein Netzwerk jenseits der von Männern dominierten Redaktionen gesucht und meine Netzwerke in den sozialen Medien kuratiert. Dort habe ich tolle Menschen online kennengelernt, bevor ich sie erst viel später persönlich kennenlernen konnte. Nun empfehlen wir uns gegenseitig fächerübergreifend zum Beispiel als Speakerinnen für Podiumsdiskussionen. Wir unterstützen uns.
Auch, wenn ich nicht Geschichtswissenschaftlerin bin, saß ich bereits auf Panels oder in Diskussionen, in deren Zentrum Geschichte und Geschichtsvermittlung standen. Die Frage ist, wo muss man sich Unterstützung suchen? Wo muss die Unterstützung sein? Wo muss das Netzwerk sein? Das histocamp bietet die allerbesten Chancen, sich mit anderen zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Die Frage ist auch: Kann man nicht eigene Veranstaltungen planen? Ich weiß, das ist ein hoher Anspruch, weil die meisten Frauen ohnehin schon sehr ausgelastet sind. Aber ich finde, wir sollten eigene Veranstaltungen machen, auf die natürlich auch Männer kommen können und dürfen. Es muss keine exklusive Veranstaltung für Frauen sein. Aber es wäre sinnvoll, eine eigene Veranstaltung zu organisieren, bei der Frauen bestimmen können, wer auf dem Podium sitzt und die Gesprächspartnerinnen selber besetzen. Man muss sich nicht erst fragen lassen. Man kann auch mal einfach machen. Das klingt immer einfacher als es ist und ich weiß auch, was für ein enormer Aufwand hinter solchen Veranstaltungen steckt. Aber bevor ich gar nicht stattfinde, schaffe ich mir selbst meinen Raum.
Teilnehmerin: An der Universität, an der ich arbeite und studiere, wurde dieses Jahr ein Buch von uns Studierenden herausgegeben, welches speziell die Frauengeschichte der Universität thematisiert. Gleichzeitig wurde aber auch ein weiteres Buch von Historikern herausgegeben, in dem es um die Geschichte der Universität Köln ging.
Da hat man gesehen, inwieweit die Universität Köln diesem Projekt Raum gegeben hat und wie viel Raum sie uns Frauen in ihrer Geschichte gegeben hat. Also die Herren, die die Bandbreite der Universitätsgeschichte Köln erforscht haben, die haben den Gürzenich, also den Festsaal in Köln, bekommen. Zu der Veranstaltung kam sogar die Oberbürgermeisterin. Wir Studierenden hatten eine Veranstaltung im Philosophikum organisiert, zu der hauptsächlich Freunde und Verwandte kamen. Es ist leider so, dass diese Hierarchien immer noch an den Universitäten praktiziert werden. Die Hierarchien spiegeln unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist die traurige Realität.
Teilnehmerin (dazu): Stell dir vor, du hättest in den sozialen Netzwerken ganz viele Journalistinnen gekannt, die zu euer Veranstaltung gekommen wären.
Teilnehmerin: Wir hatten eine Veranstaltung auf Facebook erstellt und hatten auch die Pressestelle der Universität Köln kontaktiert.
Teilnehmerin: Das reicht nicht.
Teilnehmerin: Aber wir haben das alles selbst organisiert, zusätzlich zu unserem Studium. Wir waren zwei Jahre lang mit diesem Projekt beschäftigt und wir waren wirklich am Ende sehr erschöpft. Und im Vergleich dazu hatte unsere Veranstaltung wenig Resonanz, was einfach schade ist.
Teilnehmerin: Eure Ausgangsfrage bezog sich ja auf unsere Erfahrungen mit der Gleichstellung an unseren Universitäten. Das passt zum Thema Networking. Ich höre immer wieder, dass gerade Networking sehr wichtig ist. Ich glaube, Männer betreiben das instinktiv mehr als Frauen. Bei uns an der Universität gibt es vom Gleichstellungsbüro zusammen mit dem Zentrum für Promovierende ein Mentoring-Programm. Ich habe selbst noch nicht daran teilgenommen, will mich aber jetzt bewerben. Das Programm spricht unterschiedliche Statusgruppen an: Masterstudentinnen, Doktorandinnen und auch Post-Docs. Ich hoffe, dass ich einen Platz in diesem Programm bekomme, weil ich mir sehr viel davon verspreche. Auf der einen Seite die lokale Vernetzung unter den Doktorand*innen. Hinzu kommen Mentorinnen, die interdisziplinär arbeiten. Ich bin keine Historikerin, aber stark an der Geschichte angedockt. In meinem Themenbereich gibt es nur Männer. Wir haben fünf Post-Doc-Stellen, die alle mit Männern besetzt sind. Seit dem 1. November 2019 haben wir eine Doktorandenstelle, die mit einer Frau besetzt wurde. Ich würde nicht sagen, dass meine Kollegen mich gar nicht unterstützen. Aber ihnen fehlt der Blick für bestimmte Probleme, die ich als Frau in der Wissenschaft habe. Der Blick für das eigene Verhalten meiner Kollegen in Kolloquien, in Diskussionen oder Sitzungen, das Ausschlüsse produziert. Ich habe die Hoffnung, dass sich durch meine Teilnahme an dem Mentoring-Programm für mich neue, andere Möglichkeiten ergeben.
Teilnehmerin: Ich wollte an die vorhergegangen Diskussionsbeiträge anschließen und fragen, was mit der studentischen Veranstaltung durch ein anderes Netzwerken passiert wäre. Ich bin Kulturwissenschaftlerin. In den Kulturwissenschaften gibt es einige Frauen. Aber dieser Netzwerkgedanke, zu sagen, wir halten Kontakt nach dem Abschluss oder der Promotion, ist nicht so präsent, besonders auf das Berufsleben von Frauen in der Wissenschaft bezogen, wie das bei Männern der Fall ist. Wenn ich mit meinen Kollegen spreche, merke ich das immer wieder. Unter Frauen ist das nicht so verbreitet wie bei den Männern. Aber ich glaube, im Networking zwischen Frauen steckt viel Potenzial. Für viele Frauen ist das Networking nicht selbstverständlicher Teil ihrer wissenschaftlichen Arbeit, sondern ein Extra-Task. Eine Aufgabe, die erlernt werden und der man sich widmen muss.
Teilnehmerin: Ich bin im Nachdenken darüber vierzig geworden. Und ich frage mich wirklich, warum ich nicht schon viel früher damit angefangen habe, mir über soziale Netzwerke ein Netzwerk an unterstützenden Frauen aufzubauen. Denn man merkt, wenn man einmal damit angefangen hat, wie gut und positiv das für einen selbst ist.
Teilnehmerin: Das ist genau der Gedankengang, dem ich nachgehe. Eigentlich höre ich gerne erfahreneren Frauen zu, die mir erzählen, was sie schon hier und da ausprobiert haben. Oder ich habe mich bemüht, Frauen in der Branche zu unterstützen, aber es hat nicht funktioniert. Dann denke ich mir: „Eigentlich wird es seit einiger Zeit schon probiert. Aber es scheitert immer wieder.“
Teilnehmerin: Ja, es gibt Initiativen, die scheitern. Aber es gibt auch solche, die fruchtbar sind und Erfolg haben. Ich muss sagen, in meinem Network funktioniert es wirklich richtig gut.
Teilnehmerin: Networking finde ich super. Aber es gibt gerade im wissenschaftlichen Bereich den Punkt, an dem alles Networking nichts bringt. Und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt, wenn es um Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten geht. Da sitzt dann meist ein männlicher Professor, eine Koryphäe in seinem Fachbereich, und will dir irgendetwas überstülpen, weil das sein Fachgebiet ist. Und du sitzt vor ihm und denkst dir, klar, in dem Moment wäre Networking super für dich, hilft dir aber in deiner wissenschaftlichen Karriere überhaupt nicht weiter. Weil immer noch – und da sind wir wieder bei den Hierarchien und den toxischen Strukturen angekommen - bestimmte Leute Machtpositionen innehaben, die dafür sorgen, dass Frauen weiterhin klein gehalten werden. Die entscheidenden Stellen, die über Besetzungen und Berufungen entscheiden, sind immer noch mit Personen besetzt, die an den alten Strukturen festhalten. Das ist ein strukturelles Problem vor allem in der Wissenschaft. Und dagegen hilft auch kein Networking.
Teilnehmerin: Das stimmt natürlich. Networking ist kein Allheimmittel. Aber, wenn du auf Podiumsdiskussionen eingeladen werden und als Expertin teilnehmen möchtest, dann hilft Networking. Es gibt mittlerweile immer wieder Beispiele von Frauen, auch in meinem Netzwerk, die sich öffentlich gegen die Teilnahme an All-Male-Panels stellen. Das ist stark. Da sehe ich eine Entwicklung.
Teilnehmerin: Wie beim Historikertag. Dort gibt es auch noch sehr, sehr viele All-Male-Panels. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, grundsätzlich nur an Panels teilzunehmen, wenn Frauen involviert sind. Das ist eine Kompetenzfrage. Aber natürlich will jeder lieber den Mann einladen. Das ist zwar traurig, aber...
Teilnehmerin: NEIN, das ist nicht traurig. Dann sucht man einfach eine Frau. Niemand kann mir erzählen, dass es keine Frau gibt, die nicht zum selben Thema sprechen könnte wie ein Mann. In diesen toxischen Strukturen sind die Männer darauf angewiesen, weil sie diesen einen männlichen Experten unbedingt wollen. Dann setzt man die Frau trotzdem mit aufs Podium. Notgedrungen.
Teilnehmerin: Das sind Strukturen des Äußeren. Das ist nicht nur eine Art der Nicht-Wahrnehmung von Frauen, sondern auch und vor allen Dingen ein Nicht-Mitdenken von Frauen. Aber Benachteiligung äußert sich in pragmatischen Vorgaben, die uns gemacht werden. Während ich meine Dissertation schrieb, habe zwei unserer vier Kinder zur Welt gebracht. Da fing das an, dass die Männer, die mit mir angefangen hatten zu promovieren, an mir vorbeizogen. Wenn es um Stellenbesetzung, vor allem Lehrstuhlbestzungen, also Professuren ging. Im Berufungsverfahren wird geschaut, was hast du publiziert, wie viel Forschungsprojekte hast du eingeworben und auf wie vielen Veranstaltungen hast du getanzt. Es gibt keinen Ausgleich für die Zeit der Geburten. Dass jemand aus dem Berufungskomitee sagt: „Die hat in der Zeit ein Kind zur Welt gebracht und gestillt. Die konnte in der Zeit nicht durch Europa jetten. Das ließ sich nicht machen.“ Dafür gibt es keinen Ausgleich. Das muss für uns Frauen möglich gemacht werden, wenn wir eine Chancengleichheit erreichen wollen. Die Karrierephase fällt bei Frauen nun einmal oft mit der reproduktiven Phase zusammen. Wenn wir sagen, Kinder sind für die Erhaltung der Menschen prinzipiell notwendig, Karriere wollen Frauen aber auch ganz gerne machen, dann muss eine Art Ausgleich geschaffen werden. Darüber wird an den Hochschulen bis jetzt eigentlich gar nicht gesprochen. Natürlich steht immer irgendwo im Kleingedruckten, dass es eine Gleichstellungsbeauftragte gibt.
Ich habe einmal bei einem Bewerbungsverfahren erlebt, dass mit der Eingangsbestätigung sofort ein Schreiben der entsprechenden Gleichstellungsbeauftragten verschickt wurde. Das war kein persönliches Anschreiben, sondern adressiert an uns Wissenschaftler*innen. In dem Schreiben der Gleichstellungsbeauftragen stand: „Liebe Wissenschaftlerin, schön, dass sie sich beworben haben. Ich bin dafür da, sie durch dieses Verfahren zu begleiten. Wenden Sie sich jederzeit an mich. Und, wenn Sie Förderungen für z.B. die Probevorlesungen brauchen, da gibt es den Verband und den Verband und den Verband. Dort können Sie an Online-Schulungen teilnehmen.“ Ich glaube, dass war an der Fachhochschule Osnabrück. Aber das ist das einzige Best-Practice Beispiel, was mir widerfahren ist. Vielmehr habe ich das Gegenteil erlebt, dass ein Kollege, ein Universitätsprofessor, zu mir in Bezug auf die Förderung eines Forschungsprojektes sagte: „Liebe Frau X, Sie haben doch schon ganz schön viele Kinder. Kriegen Sie das denn überhaupt hin, mit den Archivreisen und so weiter?“
Mein Mann ist Geschäftsführer eines Verbandes in der Behindertenhilfe. Der ist noch nie gefragt worden, wie er das mit vier Kinder hinkriegt.
Es geht also nicht nur um diese fehlende Wahrnehmung, sondern es geht tatsächlich um einen Ausgleich.
zeitgeschichte|online: Ähnliche Antworten haben einige unserer Interviewpartner*innen gegeben. Wir haben immer wieder gehört: „Mein Mann wurde das nicht gefragt.“ Darauf haben wir nachgehakt und gefragt, warum denn die Männer danach nicht gefragt werden?
Wir haben unseren Interviewten zum Teil außerdem die Frage gestellt, wie Konferenzen und Tagungen kinderfreundlicher bzw. familienfreundlicher gestaltet werden könnten. Was muss wirklich geändert werden, was geschaffen werden? Räume zum Stillen, Kinderbetreuung während der Tagung und so weiter.
Eine unserer Interviewpartner*innen hat uns davon berichtet, dass sie sich einmal zum Stillen in eine Rumpelkammer zurückziehen musste, weil es keinen anderen verfügbaren Raum gab. Auf dem Rückweg von der Rumpelkammer hat sie einen älteren, männlichen Kollegen getroffen, dem bei ihrem Bericht darüber plötzlich ein Licht aufging: „Ach, ja genau, Sie müssen ja Stillen.“ Der Kollege hat ihr daraufhin einen besseren Raum angeboten. Bis zu diesem Zeitpunkt, weil niemand es thematisiert hatte, war dem Kollegen die Lage unserer Interviewten gar nicht klar gewesen. Erst als die von uns interviewte Wissenschaftlerin ihm von ihrer Erfahrung erzählte, wurde ihm die Problematik bewusst. Danach war der Kollege bereit, die Infrastruktur so einzurichten, dass sie unserer Interviewten ein Stillen in angenehmer Atmosphäre erlaubte. Aber der Moment der Realisierung solcher Probleme fehlt bei vielen Männern noch.
Teilnehmerin: Frauen dürfen sich ruhig etwas trauen. Ich habe vor einiger Zeit eine Lehrveranstaltung gegeben. Mein Mann hat in der Seminarzeit unser damals noch sehr kleines Baby draußen spazieren gefahren. Auf einmal hate das Kind dann richtig Hunger gekriegt, das war in der Mitte des Seminarverlaufs. Da habe ich schlichtweg zu den Studierenden gesagt: „Ich gehe davon aus, dass Sie damit klarkommen, dass eine Mutter ihr Kind stillt.“ Und habe mein Baby während der Lehrveranstaltung gestillt.
Einige Teilnehmer*innen klatschen
Teilnehmerin: Toll! Finde ich gut!
Teilnehmerin: Noch einmal zurück zum Netzwerken: Das finde ich gut und wichtig. Ich glaube auch, dass Netzwerke Druck ausüben können und auch sollten. Aber wir haben strukturelle Probleme. Wir haben Zeitverträge. Wir haben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Natürlich wird einem ein Jahr mehr gewährt, wenn man Elternzeit nimmt. Aber diese Strukturen bieten keine Perspektiven. Das sind Probleme, die Netzwerken alleine nicht löst.
Teilnehmerin: Netzwerken ist wie gesagt kein Allheilmittel.
Teilnehmerin: Ja. Ich glaube schon, dass Netzwerke in der Lage sind, viel Druck auf bestehende Strukturen auszuüben. Und natürlich sollten viele von uns Netzwerke mehr dafür nutzen. Aber die Probleme, die ich anspreche, finden auf politischer Ebene statt. Ich fühle mich so, als wäre ich das kleinste Rad im Getriebe. Es ist schwer, gegen solche Probleme anzugehen, in dem wir darüber nur reden.
Teilnehmerin: Mir geht es noch einmal um die institutionellen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich studiere Geschichte und Soziologie und habe die Erfahrung gemacht, dass solche Strukturen zum Teil sehr fachabhängig waren. In der Soziologie wurde mit Gleichstellung und ähnlichen Probleme viel achtsamer und sensibler umgegangen. Soziologie denkt das inhaltlich im Fach mit. Es gibt nun einmal diese Gender-Ungleichheit. In der Soziologie waren unter den Lehrkräften mehr weibliche Dozierende. Im Gegensatz dazu habe ich den Frauenanteil unter den Professoren in Geschichte erlebt. Ich denke, das Fach Geschichte ist in Gleichstellungsfragen noch zu verkrustet. In anderen Disziplinen, in denen das Bewusstsein für die Thematik einfach viel höher ist, werden die Strukturen viel mehr aufgebrochen und erneuert. Die Soziologie ist eine Wissenschaft, die schon länger als andere Wissenschaften auf die Thematik geschlechtsspezifischer Ungleichheiten aufmerksam macht. Geschichte ist einfach immer noch eine Disziplin alter, weißer Männer.
Teilnehmerin: Ich finde unser Gespräch inhaltlich sehr gut und bereichernd. Es ging nun vermehrt um die gegenseitige Bestärkung von Frauen. Ich wollte aber nur noch einmal sagen, dass wir weißen Frauen bedenken sollten, dass es Personen gibt, die noch wesentlich weiter unten in der Wissenschaftshierarchie stehen. Im Verlauf unserer Diskussion wurde bereits ebenfalls die Sexualität als zusätzlicher Diskriminierungsfaktor angesprochen. Nach Möglichkeit sollte man also nicht nur darauf achten, dass auf einem Panel neben zwei weißen Männer auch zwei weiße Frauen sitzen, sondern, dass auch Zugehörige anderer Diskriminierungskategorien, beispielsweise PoCs, beachtet und integriert werden. Wir sollten alle zu jedem Zeitpunkt darauf achten, dass die Privilegien, die wir uns erarbeitet haben, und die Räume, die wir uns geschaffen habe, dass diese divers werden und bleiben sollten.
zeitgeschichte|online: Auf jeden Fall. Intersektionales Denken und Handeln war auch unser Anliegen für den Themenschwerpunkt.
Teilnehmerin: Das ist ein Mindestziel. Eigentlich ist es wirklich bitter, dass Frauen fünfzig Prozent der Gesellschaft ausmachen und dass demgegenüber unser Mindestziel ist, diese Prozentzahl auf den Panels durchzubringen. Natürlich wäre es wünschenswert, auch in Bezug auf die anderen Diskriminierungskritierien mehr Präsenz auf Panels zu schaffen. Wir haben nur leider das Problem, dass wir nicht einmal unsere Mindestziele realisieren können.
Teilnehmerin: Etwas zur Sichtbarmachung: Das Problem ist, viele, die Teil der Struktur sind, glauben immer noch, dass Frauen mit Kindern Einzelfälle im Wissenschaftsbetrieb sind. Das höre ich wirklich häufig: „An unserem Institut ist eine Wissenschaftlerin, die hat gerade ein Kind bekommen, die kann ihre wissenschaftliche Arbeit nicht mit ihrer Mutterschaft vereinbaren.“ Das wird dann als persönliches Privatproblem der Frau deklariert. Ich glaube, es hilft schon auch, sichtbar zu machen, dass wir Frauen und Mütter keine Einzelfälle sind, sondern, dass die Wissenschaft als Betrieb große strukturelle Probleme aufweist. Die Konsequenzen dieser strukturellen Probleme tragen wir Frauen, nicht die Männer. Das spüren wir sehr deutlich.
Gerade wenn wir uns die Geschichte anschauen: Es gibt bis heute keine flächendeckende und ausreichende Versorgung mit Hebammen, die Geburten betreuen können. Sehr lange wurden Frauen, die von Kliniken abgewiesen wurden, als Einzelfälle betrachtet. Und die medizinischen Fachleute beteuern: „Wir haben keine Statistiken dazu. Wir können das nicht erheben. Blablabla. Deshalb können wir nicht politisch handeln.“ Es wird erst politisch gehandelt, wenn das Problem strukturell bekannt und beziffert ist. Es muss irgendwie beziffert sein, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, es geht eigentlich primär darum, die Probleme sichtbar zu machen, damit keine Mythen entstehen wie: „Eine Frau mit vier Kinder, die hat es auch irgendwie geschafft. Meine Güte, die hat halt ein bisschen länger gebraucht.“ Das darf so nicht stehen bleiben.
Das sind so Kleinigkeiten. Hörbarmachen und Sichtbarmachen zur Selbstverständlichkeit machen! Demgegenüber überlegt man als Frau immer, ob das Sichtbarmachen der Probleme einem zum Nachteil gereicht. Und das ist leider häufig so. Aber, wenn das in der Masse passiert, dann kann Mann uns ja nicht alle wegrationalisieren. Mann, du bist schon noch auf uns angewiesen. (Alle lachen)
Teilnehmerin: Ich wollte gerne noch einmal ein positives Beispiel nennen. Was man zum Beispiel als Studierende gegen solche Probleme machen kann. Wenn man erklärt, dass man Gleichstellungsbeauftrage am Institut braucht, dass man sich Unterstützung von der Gleichstellungsbeauftragten wünscht, dann wird den Gleichstellungsbeauftragten auch mehr Aufmerksamkeit zuteil und sie bekommen mehr „Macht“, zumindest am Institut. Bei uns haben wir einen Biologie-Professor, der frauenfeindliche, homophobe und demnächst rassistische Bücher publiziert. Gegen diesen Professor kann man wenig ausrichten. Wir sind damit als autonome Referate gemeinsam mit dem Asta zum Universitätspräsidium gegangen. Wir haben dem Präsidium in dieser Angelegenheit wirklich zugesetzt, konnten aber gegen diesen Professor wenig ausrichten. Aber vielleicht auch als Kompromiss wurde das Gleichstellungsbüro unserer Universität enorm aufgestockt. Es gibt nun eine starke Vernetzung zwischen den verschiedenen Diversity-Stellen. Da wurden Stellen geschaffen und deren Etat jeweils erhöht. Das alles, nur weil wir, die autonomen Referate, zum Präsidium gegangen sind. Wir haben auch ein persönliches Gespräch mit dem Präsidenten bekommen, der sich unser Problem angehört hat. Wir haben ihn geradezu zugetextet, dass es so nicht weitergehen könne. So konnten wir auf die strukturellen Probleme positiven Einfluss nehmen.
Damit will ich sagen, es gibt Möglichkeiten, die wir Studierende haben und auch nutzen sollten. Man kann auch immer zum Asta gehen. Wir gehen zum Beispiel auf Dozierende zu. Wir arbeiten eng mit den Dozierenden zusammen. Die Kommunikation zwischen Studierenden, der Studierendenvertretung, den Dozierenden und der Hochschulpolitik muss ebenfalls gestärkt werden.
Teilnehmerin: Wenn wir von Kindern sprechen, sollten wir auch Care-Arbeit und Zeiteinteilung mitdenken. Ich beobachte im Wissenschaftsbetrieb ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass Kinder nicht nur ein Problem von Frauen sind.
Teilnehmerin: In einer gestrigen Session wurde auch schon einmal etwas Ähnliches thematisiert, was du gerade zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz angesprochen hattest. Eine Teilnehmerin der gestrigen Session meinte: „Es muss doch auch möglich sein, in dreißig Stunden eine gute Arbeit leisten zu können.“ Ich habe das Gefühl, dass wir viel mehr miteinander darüber reden müssen, zu welchen Konditionen wir eigentlich arbeiten. Wir müssen uns solidarisieren. Das betrifft nicht nur die Wissenschaft, sondern auch andere Bereiche, mit wem ich mich auch unterhalte, überall geht es um die Missstände. Seien es Frauen, die sich nicht vernetzen. Dann geht es darum, dass, umso höher die Karriereleiter hochgestiegen wird, die Luft immer dünner wird. Und dass oben nicht mehr geguckt wird und alle immer wieder sagen: „Leute, wenn ihr aus dem Mittelbau herausgeht, müsst ihr trotzdem an die anderen denken.“ Das sind Diskussionen, die dort hineinspielen. Dann kann man darüber reden, wie sich die Universitätsstruktur verändern muss. Muss ich die Professur haben? Oder wie kann ich mich in die Departmentstruktur einbringen? Muss ich den Rektoren und Rektorinnen, die gerade neu berufen werden und das deutsche Universitätssystem beibehalten wollen, zustimmen?
Wenn man anfängt, Verantwortung zu teilen, damit Forschung und Lehre machbar wird, dann verändert sich auch für Frauen und natürlich auch für Männer ganz viel. Wenn man endlich einmal am System arbeitet, dann verändert sich sehr viel.
zeitgeschichte|online: Genau darauf gehen wir tatsächlich auch in unserer Einleitung zum Themenschwerpunkt ein. Wir zeigen auf, dass es sich ganz klar um strukturelle Probleme handelt.
Teilnehmerin: Ich habe jetzt noch einmal eine Frage an die Männer, die in dieser Session sitzen: Was nehmt ihr aus dieser Session mit?
Teilnehmer: Ich finde es interessant, zuzuhören und zu verstehen. Ich arbeite nicht direkt im Wissenschaftsbetrieb und mir war vieles, was hier besprochen wurde, so und in diesem Ausmaß einfach nicht bewusst. Besonders die Gleichstellungsprobleme im Wissenschaftsbetrieb waren mir nicht bewusst. Ich denke, wenn sich etwas ändern soll, dann müssen die Geschlechter miteinander sprechen.
Teilnehmerin: Ja, das, was allgemein unter „der Gläsernen Decke“ subsummiert wird, gibt es nicht nur im Wissenschaftsbetrieb. Ich arbeite ebenfalls nicht in der Wissenschaft und ich kenne das auch sehr gut. Ich bin kürzlich in einem Vorstellungsgespräch gefragt worden, ob ich meine Kinder versorgen kann. Das ist normal. So etwas muss in Bezug auf Wissenschaft, aber auch andere Zusammenhänge einfach viel mehr kommuniziert werden. Mir wäre das ein wichtiges Anliegen.
Teilnehmerin: Das Problem liegt schon darin, dass es als „normal“ angesehen wird, dass Frauen in Vorstellungsgesprächen gefragt werden, wie viel Zeit sie überhaupt neben der Kinderversorgung für die Arbeit aufbringen könnten. Sowas wie „Sind Sie sich sicher, dass Sie das schaffen?“, habe ich immer wieder zu hören bekommen. Das ist das Toxische.
Teilnehmerin: In meinem Fall wurde das sofort von dem Vorsitzenden der Berufungskommission unterbunden. Er hat den Kollegen darauf hingewiesen, dass sich diese Frage nicht gehört. Aber sie wurde gestellt und war damit im Raum. Das war normal, dass diese Frage im Raum stand.
zeitgeschichte|online: Wir würden gerne noch einmal die bereits gestellte Frage an die anwesenden Männer wiederholen. Wir hatten eben nur eine Männerstimme dazu gehört. Natürlich wollen wir hier niemanden zwingen. Vielleicht gibt es weitere männliche Teilnehmer, die sich dazu äußern wollen?
Teilnehmer: Ich stelle mir ja genau die gleiche Frage. Ich bin kurz vor dem Masterabschluss und schon länger mit meiner Freundin zusammen. Die Familienplanung rückt näher. Kann ich das überhaupt stemmen? Kinderkriegen in Zeitarbeit? Das sind Sachen, die mich genauso beschäftigen. Aber natürlich habe ich immer das Gefühl, dass das nicht ganz so wichtig ist. Das fühlt sich unfair an.
Teilnehmerin: Warum ist dir das nicht ganz so wichtig?
Teilnehmer: Ich meine, dass ich nicht dieser Diskriminierung so ausgesetzt bin. Das ist ein von mir selbstgewählter Druck, weil mir das wichtig ist. Aber das ist nichts, was von außen kommt. Das ist ein großer Unterschied, den ich auch versuche, bei mir selber zu bemerken.
Teilnehmer: Mein Tipp: Vernetz dich mit Vätern, Vätern aus der Wissenschaft. Ich habe mindestens drei oder vier Männer, mit denen ich darüber spreche, wie sie forschen – vor allem auch in auswertigen Archiven – mit Familie. Die erzählen mir, dass sie teilweise Frau und Kind mitnehmen.
Teilnehmerin: Da kann eine Frau dann ja auch keinen Job haben, an den sie gebunden ist, um überhaupt mitkommen zu können.
Teilnehmer: Ja. Ansonsten wir es wirklich problematisch.
Teilnehmerin: Wir könnten ja auch einmal die Männer mit ins Archiv nehmen. Oder was ist, wenn beide wissenschaftlich arbeiten und zur gleichen Zeit ins Archiv müssen, die Archive aber unterschiedliche Standorte haben? Wer nimmt dann das Kind oder die Kinder?
Teilnehmer: Tatsächlich war das für mich ein Grund zu sagen, dass ich nicht in die Forschung gehe. Ich bin nie auf Archivreise, weil ich meine Frau und mein Kind nicht alleine zu Hause lassen wollte.
Teilnehmerin: Es gibt ja nicht nur Archivreisen, sondern auch Tagungen und Konferenzen.
Teilnehmerin: Oder auch die Abendveranstaltungen nach 18 Uhr. Nicht gerade kinder- und familienfreundlich!
Teilnehmerin: Und Gremiensitzungen und Kolloquien ab 16 Uhr. Ich meine, Kinderbetreuung ist da auch nicht immer die Lösung. Auch Kinder stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Die Frage ist auch, wie lange man seine Kinder irgendwo betreuen lassen kann und will.
Teilnehmerin: Größere bzw. ältere Kinder kommen gerne auf internationale Tagungen mit. Zumindest war das bei meinen Kindern so. Wir konnten dafür schulfrei beantragen, das fanden meine Kinder natürlich super.
zeitgeschichte|online: Wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Als abschließenden Frage: Was wären nach dieser Diskussion weitere Lösungsansätze, neben dem Netzwerken?
Teilnehmerin: Vielleicht muss man andersrum fragen: Wie können Männer sich und andere Männer für diese Thematik sensibilisieren? Es hängt nicht an den Frauen. Nicht die Frauen sollten noch mehr Arbeit auf sich nehmen und sich vernetzen, sondern der Spieß sollte umgedreht werden. Männer sollten sagen: „Ich bin für diese Thematik sensibilisiert und ich versuche jetzt, auch andere Männer für die Thematik zu sensibilisieren.“
Teilnehmerin: Oder auch verpflichtende Workshops, die tatsächlich von allen am Institut besucht werden müssen.
Teilnehmerin: Ich finde, es muss jetzt damit anfangen – das hat für mich auch etwas mit Zeit und Raum zu tun –, dass Frauen sich selbst fördern und sich gegenseitig unterstützen. Wichtig sind Dinge, die Frauen gelernt haben. Dies sollte weiter gegeben werden an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Es gibt zahlreiche Stipendienprogramme. Bewerbt euch um ein Stipendium! Ihr habt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung gerade als Frau besonders gute Chancen, ein Stipendium zu bekommen. Da kommt jetzt wieder: „Aber ich habe kein 1,0 Abitur gemacht!“ Ja, dann probiert es trotzdem. Meldet euch bei VG Wort an. Holt euch das Geld zurück.
Publiziert, publiziert, publiziert und publiziert bitte noch einmal. Und traut euch, eure Abschlussarbeiten zu publizieren. Macht Self-Marketing und unterstützt andere! Empfehlt die Bücher und Publikationen von Kolleginnen. Wenn ihr bei einem Panel nicht könnt, dann empfehlt eine Kollegin. Und wartet nicht darauf, dass etwas passiert.
zeitgeschichte|online: Ganz herzlichen Dank an Euch alle für die produktive Diskussion. Wir nehmen, wie auch schon aus unseren Interviews, mit, dass Netzwerken enorm wichtig, aber natürlich nicht alles ist. Wir haben auch ein Interview mit fem4scholar Gründerin Carla Schriever geführt. Das können wir euch sehr empfehlen. Wir bedanken uns bei euch für die Teilnahme an unserer Session und für die angeregte Diskussion.
Zitation
Sophie Genske, Rebecca Wegmann, „Wenn man endlich einmal am System arbeitet, dann verändert sich sehr viel“ . histocamp-Diskussion über die Zukunft von Frauen* in der Wissenschaft, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/wenn-man-endlich-einmal-am-system-arbeitet-dann-veraendert-sich-sehr-viel