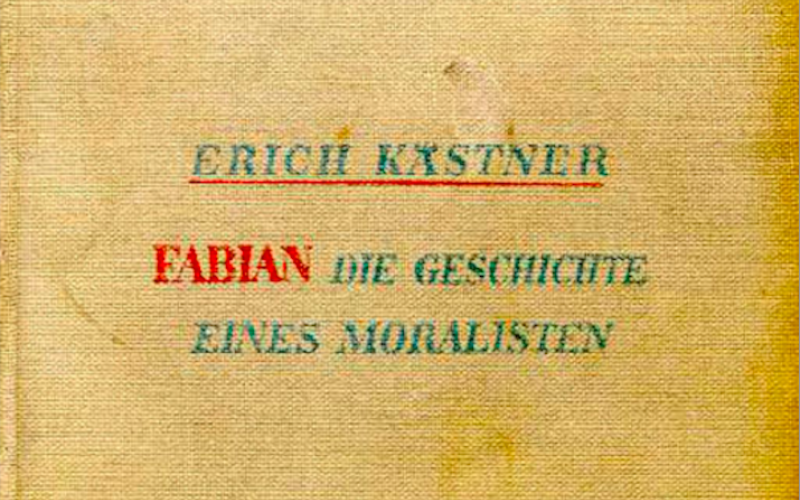„Der Globus hat Homo sapiens“, lautet es gleich zu Beginn von Roger Willemsens letztem, bereits posthum erschienenen und unvollendet gebliebenem Werk, das „Wer wir waren“ heißen sollte. Als Willemsen von seiner lebensbedrohlichen Erkrankung erfuhr, stellte er die Arbeit an diesem Werk ein; Kerngedanken präsentierte der Fernsehmacher, Publizistik und Weltbürger jedoch noch vor seinem Tod im Sommer 2015 in seiner sogenannten „Zukunftsrede“. Darin blickt er aus einer kommenden Zeit auf die conditio humana im frühen 21. Jahrhundert zurück, um in einer Art umgekehrter Prophetie das Hier und Jetzt sichtbar werden zu lassen: „Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Informationen, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung.“[1]
Mit diesen Worten beginnt auch ein neuer Dokumentarfilm von Marc Bauder, der Willemsens als „leidenschaftlicher Aufruf an die nächste Generation“, aber auch als „tief melancholisch[e], hoffnungs-, sogar gnadenlos[e]“ Abrechnung gepriesenes „Vermächtnis“ visualisiert und weiterzudenken sucht.[2] Der Film beginnt in einer postapokalyptischen Landschaft – ein in seiner Schutzkleidung kaum noch als solcher erkennbarer Mensch streift durch die Ruinen Fukushimas – und vermittelt zunächst den Eindruck bei Bauders „Wer wir waren“ (bei dem das „Wir“ groß geschrieben ist) handle es sich weniger um eine hypothetische Überlegung als um eine ausgemachte Tatsache. „Es gibt unglaublich viele und ungeheuerliche Dinge, und das Ungeheuerlichste davon ist der Mensch“, kommentiert der Mensch in Schutzkleidung, die Technikphilosophin Jana Loh. Sie ist eine von sechs Aktivist*innen, die sich dieser Ungeheuerlichkeit nicht beugen, sie auch als Chance zu verstehen suchen. Denn ungeheuerlich sei der Mensch nicht nur in einem wahnsinnigen, selbstzerstörerischen Sinne, sondern auch in seiner Anpassungsfähigkeit und seinem schöpferischen Erfindungsreichtum – Pandora und Prometheus…
Auf der Erde, unter Wasser und im Weltraum: „Ungeheuer ist viel und nichts ungeheurer als der Mensch“
Rasch wird deutlich, dass es Bauder mit seiner Visualisierung von Willemsens „Vermächtnis“ darum geht, Menschen vorzustellen, die sich dieser klassischen, schon in Sophokles Antigone formulierten Einsicht – „Ungeheuer ist viel und nichts ungeheurer als der Mensch“ – annehmen und sie in positive Bahnen zu lenken versuchen. Neben Loh sind das weiterhin der deutsche Astronaut Alexander Gerst und die US-amerikanische Meeresbiologin Sylvia Earle, der senegalesische Sozialwissenschaftler Felwine Sarr, der deutsch-amerikanische Ökonom Dennis Snower und der französische Mönch Matthieu Ricard. Bauder begleitet sie bei ihren Aktivitäten auf der Erde, unter Wasser und im Weltraum; Szenen, in denen seine Protagonist*innen Vorträge halten oder ihre Gedanken in anderem Kontext ganz konkret in Worte fassen, wechseln mit meditativen Momenten ab, in denen die Schönheit der Erde, aber auch die durch den Menschen angerichtete Zerstörung in atemberaubenden Bildern angedeutet wird. Gleichzeitig vermittelt der Film ebenso interessante wie irritierende Fakten: Wussten Sie, dass erst drei Menschen zu den tiefsten Punkten der Ozeane vorgedrungen sind, aber schon mehr als 500 Menschen die Erde verlassen haben und ins All hinausgeflogen sind? „Das ist was, was von hier oben wirklich verrückt scheint, dass wir diesen kleinen blauen Planeten haben. Der einzige Ort im Universum, wo wir Menschen leben können und wir nichts Besseres zu tun haben, als zu zerstören“, bekräftigt Alexander Gerst von Bord der Internationalen Raumstation (ISS) den sogenannten Overview-Effekt, einen Mythos der modernen Raumfahrt, dem zufolge jeder Mensch, der die Erde aus dem Weltall erblickt, nicht nur ein großes Gefühl der Ehrfurcht, sondern zugleich ein tieferes Verstehen der Verbundenheit allen Lebens auf der Erde und eine gesteigerte Verantwortung für unsere Umwelt entwickle.[3] Gleichzeitig bekundet der Kameramann, der Gerst bei seinem Aufenthalt im All begleitete, dass der kurze Aufenthalt in der Schwerelosigkeit bereits ausgereicht habe, um seine Füße ganz anders gebrauchen zu können als auf der Erde – ein eher beiläufiges Beispiel für die enorme Anpassungsfähigkeit des Menschen auf der Erde, aber eben auch überall sonst?
Bauder will wachrütteln, er will aber auch Mut machen – und scheint in Zeiten von Fridays for Future und Global Awareness mit Wer Wir waren einen blank liegenden Nerv getroffen zu haben. Jedenfalls wird er bereits vor seinem offiziellen Kino-Start im Juli von der Kritik durchweg gefeiert: sein Film sei „ein Hilferuf im Namen unseres Planeten“ und „eine Aufforderung zum Denken, zu Dialog und Miteinander“, die Mut mache und „irgendwie auch Hoffnung“.[4] Bereits mit dem Hessischen Filmpreis 2020 ausgezeichnet, verlieh ihm die Deutsche Film- und Medienbewertung das Prädikat „besonders wertvoll“ und begründete dies mit „seine[r] erzählerische[n] Ruhe, [den] starken Kinobilder[n] und [der] Fokussierung auf charismatische Protagonist*innen“. Insgesamt handle es sich um einen „eindringliche[n] und inspirierende[n] filmische[n] Appell“, der „eine wichtige Botschaft“ transportiere und „eine eigene poetische Kraft“ entwickle.[5]
Es sind eher beiläufige Beobachtungen, die diese hehren Absichten keineswegs in Frage stellen, aber nach einer etwas anders gelagerten Perspektivierung verlangen – etwa, wenn sich ein unübersehbarer Anflug von Irritation im Gesicht der europäischen Technikphilosophin Loh bemerkbar macht, als ein japanischer Kollege ihr eröffnet, dass der Mensch der Zukunft seine Vollendung möglicherweise im Roboter finden werde; oder wenn sich der Mönch Ricard und der Ökonom Snower gemeinsam darüber lustig machen, dass der westlichen Welt jeder Sinn für wahrhafte Spiritualität abhandengekommen sei. Es scheint bezeichnend, dass der Vertreter der Geistlichkeit in Bauders Ensemble charismatischer Zeitgenossen nicht dem christlichen Glauben angehört: der studierte Molekularbiologe Matthieu Ricard promovierte zunächst bei dem französischen Nobelpreisträger Francois Jacob, bevor er zum Buddhismus konvertierte und mittlerweile als offizieller Französisch-Übersetzer für den Dalai Lama wirkt.
Nicht der Verlust an Spiritualität steht jedoch im Mittelpunkt von Roger Willemsen letzten Überlegungen, sondern ein unübersehbarer Verlust an Zukunft und eine weitgehende Erschöpfung ihres utopischen Potenzials: „Nichts weist darauf hin, dass wir in unserer Zukunft sicherer, gesünder, freier, friedlicher leben werden“, schreibt Willemsen in „Wer wir waren“. „Bequemer, das ja, effizienter, unsentimentaler, all das, aber wessen Himmel bevölkern schon die Sachverwalter des Pragmatismus?“, beschwört er den scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug dessen, was Max Horkheimer einmal die instrumentelle Vernunft genannt hat, und findet für ihn ein ebenso eindringliches wie abgründiges Bild: „Die Zukunft, das ist unser röhrender Hirsch über dem Sofa, ein Kitsch, vollgesogen mit rührender Sehnsucht und Schwindel. […] In der Kraft ihrer Ignoranz hat sie keinen Bewegungsspielraum, sie steht in sich, weshalb man auch sagen kann: Was nicht neu ist, das ist die Zukunft.“[6]
Zurück in die Zukünfte: Für einen Perspektivwechsel
Wohl ließe sich darüber streiten, inwieweit der von Snowder und Ricard verspottete Mangel an Spiritualität und der von Willemsen beklagte Verlust an Zukunft nicht miteinander zusammenhängen, möglicherweise sogar das gleiche meinen – wer sich seines Platzes in der Schöpfung sicher ist, der wird auch zuversichtlich und hoffnungsfroh in die Zukunft blicken können –, weitaus entscheidender ist jedoch, dass die conditio humana, die hier auf dem Spiel steht und verhandelt wird, eine durch und durch moderne ist, getragen von den Zukunftsversprechen der europäischen Aufklärung.
Der Globus hat nicht Homo sapiens, könnte man in diesem Sinne über das sagen, was uns Bauders Film zeigt, er hat Homo sapiens europaeus. Schon vor zwanzig Jahren hat Dipesh Chakrabarty in seinem Klassiker Provincializing Europe darauf aufmerksam gemacht, dass jene Werte, die überall auf der Welt als moderne Errungenschaft hochgehalten werden – „Concepts such as citizenship, the state, civil society, public sphere, human rights, equality before the law, the individual, distinctions between public and private, the idea of the subject, democracy, popular sovereignty, social justice, scientific rationality“ – auf Ideen der europäischen Aufklärung zurückgehen, denen im Zuge des Imperialismus ohne Rücksicht auf lokale Traditionen ebenso vorgeblich wie nachhaltig globale Geltung verschafft wurde und die uns heute mit einem historisch unumkehrbaren Dilemma konfrontieren: „European thought […] is both indispensable and inadequate in helping us to think through the various life practices that constitute the political and the historical“ außerhalb dessen, was wir gemeinhin den „Westen“ nennen.[7]
Nirgends wird das deutlicher als in der Begegnung mit Felwine Sarr, den Bauder dabei begleitet, wie er mit einigen lokalen Aktivist*innen die Verheerungen des Klimawandels an Senegals Küste inspiziert. Die Aktivist*innen vor Ort verfügen weder über die notwendigen Ressourcen und Technologien, um der schleichenden Versandung ihrer Küste Einhalt zu gebieten noch sind sie für das Problem, mit dem sie konfrontiert sind, in irgendeiner Weise historisch verantwortlich. In einem ganz buchstäblichen Sinne zählt die Begegnung mit Sarr deshalb zu den spannendsten und instruktivsten des gesamten Films, denn als einziger unter Bauders charismatischen Zeitgenossen steht Sarr nicht ausschließlich in der Tradition der europäischen Aufklärung (Ricards Konvertierung zum Buddhismus ist demgegenüber wohl eher als bewusster Bruch mit dieser Tradition zu sehen).
Tatsächlich stellt sich die Frage, wer mit dem „Wir“ im Titel von Bauders Film eigentlich gemeint ist: Jeder, der sich diesen Film anschaut, wie das großgeschriebene „Wir“ andeutet, tendenziell also die gesamte Menschheit? Oder doch nur diejenigen, die aus historischen Gründen die Vernunft als einzig gültiges, weil scheinbar universales Prinzip anerkennen? „We need universals to produce critical readings for social injustices“, betont Chakrabarty. “Yet the universal and the analytical produce forms of thought that ultimately evacuate the place of the local.”[8] Europa und seine Ideen der Aufklärung zu provinzialisieren heißt für Chakrabarty deshalb nicht, vernunftbasierte Erkenntnis in Bausch und Bogen zu verwerfen oder als „europäisch“ zu verdammen, sondern sie als eine historisch gewachsene und damit letztendlich kontingente Form der Weltaneignung zu begreifen. Die Frage, die sich der Menschheit der Zukunft stellt, kann also nicht lauten, ob man für oder gegen die Aufklärung und ihre vernunftbasierten Prinzipien ist.
Damit Aufklärung aber nicht immer wieder in Ideologie umschlägt, braucht es einen grundlegenden Perspektivwechsel, der nicht weiterhin Vernunft und Tradition, Zentrum und Peripherie, Herrschende und Beherrschte gegeneinander ausspielt und in Stellung bringt. Wie die Berliner Ethnologin Heike Behrend unlängst notiert hat, mussten europäische Ethnolog*innen sich im Zuge des Post-Colonial Turn eingestehen, dass die statische Sicht auf die Moderne als europäischem Exportgut einen bedeutenden Anteil dessen unterschlägt, was die Gesellschaften des sogenannten „globalen Südens“ ihrerseits zur Entstehung und „Erfindung“ des Westens und der Moderne beigetragen haben.[9] Bauders Begegnung mit Sarr ist die einzige, in der die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich mit dem Versuch verbinden, die Moderne nicht statisch und nicht im Singular, sondern dynamisch und im Plural zu denken, zumindest angedeutet werden und sie zählt deshalb zu den stärksten Momenten des Films.
In einigen westafrikanischen Religionsgemeinschaften wird der Sankofah verehrt, ein mythischer Vogel, der so ziemlich das gleiche Unterfangen symbolisiert, das auch Roger Willemsen mit seiner „Zukunftsrede“ im Sinn hatte: aus der Vergangenheit für eine bessere Zukunft zu lernen. Bauders Ensemble an charismatischen Zeitgenossen macht deutlich, dass dies nur als polyphoner Prozess zielführend ist, darin liegt die Stärke seines Films, die ruhig noch ein wenig konsequenter hätte ausgeschöpft werden können. Statt mit Sylvia Earle darüber zu räsonieren, dass die Erde besser Ozean heißen sollte, immerhin besteht sie zu mehr als 70 Prozent aus Wasser, wäre spannend zu erfahren gewesen, welche utopischen Zukunftsversprechen sich etwa mit der Tätigkeit des japanischen Robotikers verbinden, die dem Film nur das Stirnrunzeln der europäischen Technikphilosophin wert sind. Um aber unseren Planeten von seiner Homo sapiens europaeus zu kurieren und zu einer Zukunft zurückzugelangen, die sich nicht nur ein wenig anders, sondern wirklich neu anfühlt, gilt es, das titelgebende „Wir“ weiter zu fassen, als es Bauder und auch Willemsen tun – nur so kann dessen röhrender Hirsch über dem Sofa vielleicht zu einem ein Sankofah werden oder auch zu einer Schildkröte, die in Asien aufgrund ihrer hohen Lebenserwartung als besonders weise und glückverheißend gilt. In jedem Fall ist Wer Wir waren eine beeindruckende Bestandsaufnahme der condition humana im frühen 21. Jahrhundert geworden, die allen Kinobesucher*innen genauso wärmstens zu empfehlen ist wie die Lektüre von Willemsens „Wer wir waren“.
Wer Wir waren, Regie: Marc Bauder, Deutschland 2021, 114 Minuten.
[1] Roger Willemsen, Wer wir waren [2016], Frankfurt a. Main 2018, S.8 und S.43.
[2] Vgl. Svenja Flaßpöhler, „Roger Willemsens Vermächtnis“ vom 29.12.2016 ; Verlagsankündigung S. Fischer Verlag [zuletzt abgerufen 8. Juni 2021].
[3] Vgl. dazu Frank White: Der Overview-Effekt. Vorwort von Ulf Merbold. Wie die Erfahrung des Weltraums das menschliche Wahrnehmen, Denken und Handeln verändert. Die 1. interdisziplinäre Auswertung von 20 Jahren Weltraumfahrt [1987], München 1993.
[4] Marga Boehle, Berlinale Review „Wer wir waren“ vom 04.03.2021, in: berlinale.de, [zuletzt abgerufen 8. Juni 2021].
[5] FBW-Pressetext, [zuletzt abgerufen 8. Juni 2021].
[6] Willemsen, Wer wir waren, S.10f.
[7] Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference [2000], Princeton 2008, S.4 u. S.6.
[8] Chakrabarty, Provicializing Europe, S. 254f.
[9] Vgl. dazu Heike Behrend, “Menschwerdung eines Affen”. Eine Autobiografie der ethnografischen Feldforschung, Berlin 2020, S. 128.
Zitation
Tilmann Siebeneichner, „Wer wir waren“ , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/wer-wir-waren