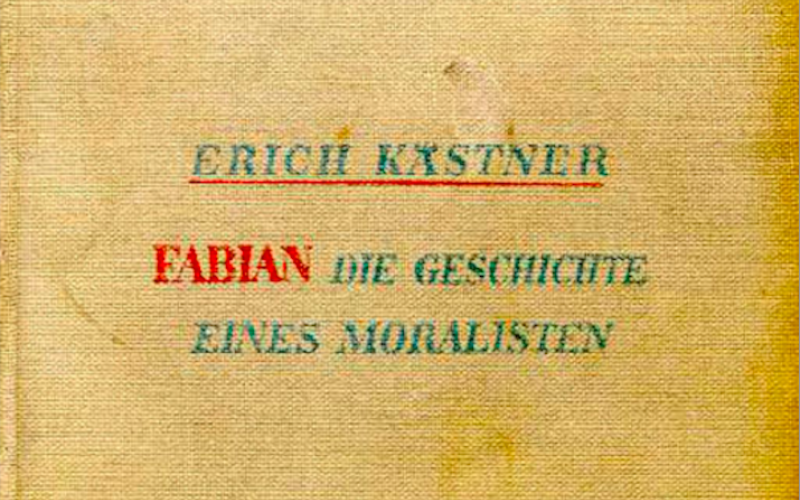Als Wolf Gremms „Fabian“ 1980 in die Kinos kam, war Kästners Roman von 1931 weitgehend unbekannt. Obwohl nach 1945 mehrere Neuauflagen im In- und Ausland erschienen waren, in den 1970er Jahren auch in der DDR, kannte meine Generation Erich Kästner vor allem als Autor von Kinder- und Jugendbüchern, im günstigsten Fall noch als Satiriker und Verfasser scharfzüngiger Gedichte. Dass er auch einen Roman für Erwachsene mit stark autobiographischen Zügen geschrieben hatte, der 1933 den Bücherverbrennungen zum Opfer gefallen war, überraschte mich und die meisten meiner Zeitgenoss*innen.
Die expliziten erotischen Darstellungen in Kästners Roman verhinderten lange Zeit eine breitere Rezeption. Wie der Autor im – nicht veröffentlichten – Nachwort der ersten Auflage schrieb, ist sein Buch „nichts für Konfirmanden, ganz gleich, wie alt sie sind“.[1] Und „die Sittenrichter, die männlichen, weiblichen und sächlichen“, waren auch in der Nachkriegszeit zur Stelle.[2] Im Jahr 1980 hatten sich die bundesrepublikanischen Moralvorstellungen und Sehgewohnheiten so weit liberalisiert, dass Gremms Film trotz der bildgetreuen Umsetzung von Kästners Roman keinen Skandal mehr auslöste, sondern dessen Anliegen zur Geltung bringen konnte, einen „Moralisten“ in einer Welt zu zeigen, der alle moralischen Standards und Zukunftsvisionen abhanden gekommen waren.
Das traf 1980 einen wunden Nerv, schien doch auch die alte Bundesrepublik in eine Sackgasse geraten zu sein, in der die wirtschaftliche Entwicklung stagnierte, die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schossen, der Wohlfahrtsstaat in Frage gestellt wurde, die internationalen Spannungen zunahmen und die krisengeschüttelte sozialliberale Koalition nur dank der Kanzlerkandidatur von Franz-Josef Strauß die Bundestagswahlen überstand. „Fabian handelt, wie viele junge Menschen heute fühlen und denken“, hieß es im Flyer zu Gremms Verfilmung, der die Aktualität von Kästners Romanfigur betonte. Und anlässlich des Kinostarts verriet der Regisseur: „Dieser Fabian ist ein radikaler Skeptiker, der meinem Lebensgefühl entspricht.“[3]
Anders als heute war das Bild Berlins in der Weimarer Republik als dynamische und letztlich völlig überdrehte Metropole 1980 weitaus weniger präsent in der westdeutschen Öffentlichkeit. Sicher gab es ein großes Interesse an der Weimarer Moderne, aber deren faszinierende Seiten standen in deutlichem Kontrast zu Weimar als Menetekel. Ein ums andere Mal beschworen besorgte Geister, Bonn sei nicht Weimar, und auch Wolfgang Gremm erklärte im Jahr 1980, er sehe zwar keinen neuen Faschismus „vor der Tür“, aber er spüre „ähnliche Symptome wie damals“.[4] Von da an dauerte es immer noch sieben Jahre, bis die große Berlin-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau anlässlich der 750-Jahrfeier der geteilten Stadt das Berlin der „Goldenen Zwanziger“ und frühen 1930 Jahre als temporeichste Großstadt der Welt wiederauferstehen ließ. Wer heute, nach drei Staffeln „Babylon, Berlin“ auf das Berlin-Bild der späten 1970er Jahre zurückblickt, mag sich die Augen reiben, wie verschnarcht es war: chaotisch vielleicht, aber doch eher liebenswert piefig als modern und dynamisch.
Heute befinden wir uns also in einer ganz neuen Situation, und das macht es plausibel, „Fabian“ erneut zu verfilmen. Bedenkt man, dass ein und dieselben Dissertationsthemen in weitaus kürzerer Frequenz vergeben werden, sind vierzig Jahre eine lange Zeit und damit das Unterfangen legitim, einen frischen Blick auf Kästners Roman zu werfen, um ihn aus heutiger Perspektive zu interpretieren. Inwiefern Dominik Graf diesem Anspruch gerecht wird, ist in engerem Sinne nicht Gegenstand dieses Textes, soll er doch in erster Linie darüber reflektieren, wie Geschichte im Film dargestellt und Vergangenheit und Gegenwart in Beziehung gesetzt werden.
Dazu ist indes schon viel gesagt worden, zuletzt in der Begründung der Jury für die Verleihung der CLIO an den besten historischen Film des Jahres 2021. Die Jury lobte vor allem die Transparenz, die Graf bei der Verschränkung der Zeitebenen walten lässt.[5] Und in der Tat beginnt der Film in dieser Hinsicht ausgesprochen verheißungsvoll. Wie in einer Zeitmaschine werden die Kinobesucherinnen und -besucher gleich in der ersten Szene am U-Bahnhof Heidelberger Platz aus der Gegenwart in das Berlin der frühen 1930er Jahre entführt. In der Folge werden immer wieder zeitgenössische Filmausschnitte in die Handlung hineinmontiert, teils mit eleganten Überblendungen, teils aber auch als deutlicher cut, wenn das körnige Schwarz-Weiß den Filmfluss unterbricht. Dass es Graf dabei weniger um Authentisierung als um Verfremdung im besten Brecht’schen Sinne geht, lässt er in einer Szene aufblitzen, als Fabian und sein Freund Labude die Wohnung der Bildhauerin Reiter verlassen und vor der Haustür eine größere Anzahl Stolpersteine ins Bild kommt.
Das überzeugt, wenn auch nicht immer ganz klar ist, was uns Graf mit diesen Schnitten zeigen will. Dass er sich der Verschränkung, Differenz und Distanz der Zeitebenen bewusst ist, gewiss. Aber kommt die Botschaft beim heutigen Filmpublikum an, wenn Graf mit den Stolpersteinen einen Bogen von 1931 zu den Verfolgungen und Verbrechen der NS-Diktatur zu schlagen versucht? Daneben finden sich im Film versteckte Zitate wie Friedrich Seidenstückers „Pfützenspringerinnen“, die wie manche der Schwarz-Weiß-Einblendungen etwas über die gedankenlose Unbeschwertheit der Stimmung im Berlin der „Goldenen Zwanziger“ aussagen.[6] Als nachgestellte Szenen mögen sie die Herzen der Filmkritikerinnen und -kritiker erfreuen, sie stehen aber ansonsten unverbunden neben der Handlung.
Historisch bedeutungsschwer, aber auch problematisch wird der Film in seiner letzten Szene, in der „Fabian“ als Kästners Manuskript auf einem riesigen Berg anderer Bücher verbrennt. Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz im Mai 1933, na klar… Aber wie beim Schwenk auf die Stolpersteine stellt sich auch hier die Frage, ob diese Assoziation bei der Mehrzahl der Betrachterinnen und Betrachter funktioniert. Gerade noch sahen sie, wie der kleine Junge, den Fabian – in Dresden – vor dem Ertrinken retten wollte, versonnen in dessen Notizen blättert, und plötzlich sollen sie sich in das nationalsozialistische Berlin versetzt fühlen…
Sicher zeichnet es Dominik Grafs Film aus, dass er es, um den Duktus der Jury aufzugreifen, im Gegensatz zu vielen fiktionalen Geschichtsfilmen vermeidet, aktuelle Maßstäbe „in die Geschichte zu projizieren und sie damit zu einer Exotisierung der Gegenwart zu degradieren“.[7] Allerdings fallen dabei einige markante Facetten weg, die nicht nur für den historischen Zusammenhang relevant, sondern auch aus heutiger Perspektive aufschlussreich gewesen wären. Zugegebenermaßen sind alle Regisseurinnen und Regisseure bei der Verfilmung von Romanen gezwungen, eine Auswahl zu treffen, wollen sie eine plausible Geschichte erzählen und unnötige Längen vermeiden. Aber obwohl Gremms Film mit 117 Minuten eine Stunde kürzer war als Grafs Opus, hielt er immerhin zwei der folgenden drei Szenen für wichtig genug, um sie in seine Version aufzunehmen.
Da wäre die Geschichte des Erfinders, bei Gremm prominent besetzt mit Charles Regnier, dem Fabian auf dem Kreuzberg begegnet und der ihm sein Leid klagt, er habe mit seinen Maschinen die Massenarbeitslosigkeit verschuldet. „Meine Maschinen waren Kanonen, sie setzten ganze Armeen von Arbeitern außer Gefecht“, so der Erfinder im Roman.[8] Mag sein, dass uns die Folgen der Rationalisierung 1980 besonders unter den Nägeln brannten, aber ist das Thema heute im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt vom Tisch?
Dann der „Zweikampf am Märkischen Museum“, bei dem sich ein Kommunist und ein Nazi wechselseitig „Reservelöcher in die entlegensten Körperteile schießen“, so Fabians alias Kästners sarkastischer Kommentar. Die Formulierung, bei diesen „politischen Schießereien“ handele es sich wie bei „Tanzbodenschlägereien“ um „Auswüchse des deutschen Vereinslebens“,[9] wird auch in Grafs Film aus dem Off eingesprochen, aber dabei geht verloren, wie sich Fabian in diesem Konflikt als Freund der Arbeiterklasse positioniert.
Überhaupt bleibt das proletarische Berlin in Dominik Grafs Film einigermaßen unterbelichtet. Auf dem nächtlichen Heimweg erklärt Fabian seiner großen Liebe Cornelia, Berlin gleiche „längst einem Irrenhaus“: „Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht, und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang.“[10] So ähnlich formulierte das zur selben Zeit auch Joseph Goebbels. Aber während sich die Nationalsozialisten anpriesen, diesen Augiasstall auszumisten, stürzt sich der „Bourgeois“ und „Kleinbürger“ Fabian in die Arbeiterviertel, um die Wut über den Verlust seiner Geliebten an den einflussreichen Filmregisseur Makart zu betäuben. Er gerät in eine Arbeiter*innendemonstration, die brutal von berittener Polizei auseinander getrieben wird, und verliert sich anschließend im Wedding auf einem Rummelplatz.
Nichts davon bei Graf. Wenn er das heruntergekommene und verarmte Berlin visualisiert, zeigt er abgeblätterte Fassaden mit zugemauerten Fenstern. Für die heutigen Kinobesucherinnen und -besucher ein vertrauter Anblick. Insofern ist auch das ein Mittel der Verfremdung, aber um den Preis, dass Fabian seinem bürgerlichen Umfeld verhaftet und das Menetekel des demütigenden sozialen Abstiegs weitgehend abstrakt bleibt.
Last but not least die Auseinandersetzung mit den traumatischen Kriegserfahrungen von Kästners Generation. Könnte man mit Blick auf die eben genannten Szenen davon sprechen, dass Graf dazu neigt, die Romanfigur aus ihrem historischen Kontext zu lösen, um sie der Gegenwart näher zu bringen, ist das beim Ersten Weltkrieg kaum möglich. Ohne die seelischen Verwundungen, die dieser bei Fabian hinterlassen hat, bliebe seine Person unverständlich. Seine abgrundtiefe Desillusionierung, die Verzweiflung über oberflächliche Vergnügungssucht und soziale Deklassierung, gepaart mit der Suche nach wahrer Liebe, erklären sich nur aus dem Schock über den seelischen Absturz der jungen Kriegsgeneration, die frisch aus den Klassenzimmern als Kanonenfutter verheizt wurde.
Wie in vielen seiner Gedichte blitzen die apokalyptischen Kriegserinnerungen immer wieder in Kästners Roman auf und werden in Beziehung zu seiner gegenwärtigen Situation gesetzt. So wie er nach seiner Einberufung mit der Zukunftserwartung zurechtkommen musste, demnächst „zu Blutwurst“ verarbeitet zu werden, und sich aus Verzweiflung darüber ziellos in erotische Abenteuer stürzte, sieht er sich 13 Jahre nach dem Krieg erneut „im Wartesaal“ der Geschichte: „Und wieder wissen wir nicht, was geschehen wird. Wir leben provisorisch, die Krise nimmt kein Ende.“[11]
Kästners Kriegserinnerungen sind schon in den ersten Szenen von Grafs Film präsent, als ein Kriegsveteran mit fürchterlich verstümmeltem Gesicht Fabian anspricht. Dieser Fremde, der wie eine Chiffre für den Krieg steht, hat noch einen weiteren Auftritt, als er Fabian in einem Albtraum an die völlig „entstellten“ Invaliden erinnert, die, abgeschirmt von der Menschheit „irgendwo in der Mark Brandenburg“, „mit furchtbaren Gesichtern, ohne Nasen, ohne Münder“ von Krankenschwestern am Leben erhalten werden, während ihre Familien sie als „vermisst“ längst aufgegeben haben. Diese Entsorgung der Vergangenheit, bei der nur noch eine „hübsche Fotografie überm Sofa, ein Sträußchen im Gewehrlauf“ an den Kriegshelden erinnern, mündet bei Kästner unmittelbar in die bange Frage: „Wann gab es wieder Krieg? Wann würde es wieder soweit sein?“[12] Das Bild der Gesichtsversehrten in Kästners Roman und seine visuelle Umsetzung in Grafs Film beziehen sich direkt auf die Porträtreihe, die Ernst Friedrich, der Gründer des Berliner Anti-Kriegsmuseums, 1924 in „Krieg dem Kriege“ veröffentlichte, ein Buch, das ihm den Hass aller Nationalisten und Militaristen der Weimarer Republik eintrug.
Die Figur des Gesichtsversehrten setzt die Kriegserfahrungen indes viel wirkungsvoller ins Bild als die von Graf zusätzlich in die Handlung eingefügte Szene der Schießübungen auf dem Labude’schen Anwesen im Grunewald. Jedes Mal, wenn Cornelia oder Labude auf eine Tontaube feuern, wendet sich Fabian ab und hält sich die Ohren zu, während sein Freund nur trocken kommentiert, er habe nichts anderes als Schießen gelernt. Als Cornelia den verstörten Fabian in den Arm nimmt und erklärt, ihn zu verstehen, weist er sie mit den Worten zurück, das könne man gar nicht. Wenn man Kästner und den historischen Kontext nicht schon vorher kennt, bekommt diese Szene erst durch den nachfolgenden Albtraum Kontur.
Ein „Kassenmagnet“ sei Wolf Gremms Film wohl nicht, schrieb Kästners Freund Rudolf Walter Leonhardt 1980 in der ZEIT: „Jedenfalls saßen im Hamburger Kino-Center Hauptbahnhof außer mir nur noch fünfzehn Menschen, von denen vier trotz zwei lebensnah gefilmten Koitus-Szenen während der Vorstellung weggingen.“[13] Trifft Dominik Grafs „Fabian“ den Nerv unserer Zeit? Mit drei Stunden Überlänge macht es sich der Film nicht leicht, ein großes Publikum zu erreichen, aber im Delphi Lux am Bahnhof Zoo saßen Ende September (sieben Wochen nach Kinostart) jedenfalls mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als seinerzeit im Hamburger Kino-Center – und es verließ auch niemand vorzeitig die Vorstellung.
Ungeachtet dessen, dass Kästners „Fabian“ einem klar umrissenen historischen Kontext entstammt, ist er mit all seinen Hoffnungen, Ängsten und Träumen, seiner Verzweiflung und seinen Enttäuschungen eine starke Romanfigur, die immer wieder neue Generationen anzusprechen vermag. Von dieser zeitlosen Aktualität lebt Grafs Film, ebenso wie vierzig Jahre zuvor schon der Vorläufer von Wolf Gremm.
Fabian oder Der Gang vor die Hunde, Regie: Dominik Graf, 2021, 186 Minuten.
[1] Erich Kästner, Fabian und die Sittenrichter, in: ders., Fabian. Die Geschichte eines Moralisten, München 2011, S. 239-241, hier S. 239.
[2] Ebd.
[3] Bodo Fründt, Einer schwimmt gegen den Strom. Erich Kästners Roman „Fabian“ wurde jetzt verfilmt, in: Stern, 16, 10.4.1980, S. 250-252, hier S. 252.
[4] Ebd.
[5] moving history; abgerufen am 4.10.2021.
[6] Jens Hinrichsen, Regisseur Dominik Graf. „Das geht auf einen Abgrund zu“, in: monopol magazin; abgerufen am 4.10.2021.
[7] Ebd.
[8] Erich Kästner, Fabian. Die Geschichte eines Moralisten, München 2011, S. 112.
[9] Ebd., S. 66f.
[10] Ebd., S. 99.
[11] Ebd., S. 61f.
[12] Ebd., S. 64.
[13] Rudolf Walter Leonhardt, Fabian alias Kästner. Wolf Gremms Film „Fabian“ läuft jetzt in den deutschen Kinos, in: DIE ZEIT, 22, 23.5.1980, S. 60.
Zitation
Thomas Schaarschmidt, Dominik Grafs „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“. Kein Historienfilm, aber ein historischer Film , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/dominik-grafs-fabian-oder-der-gang-vor-die-hunde