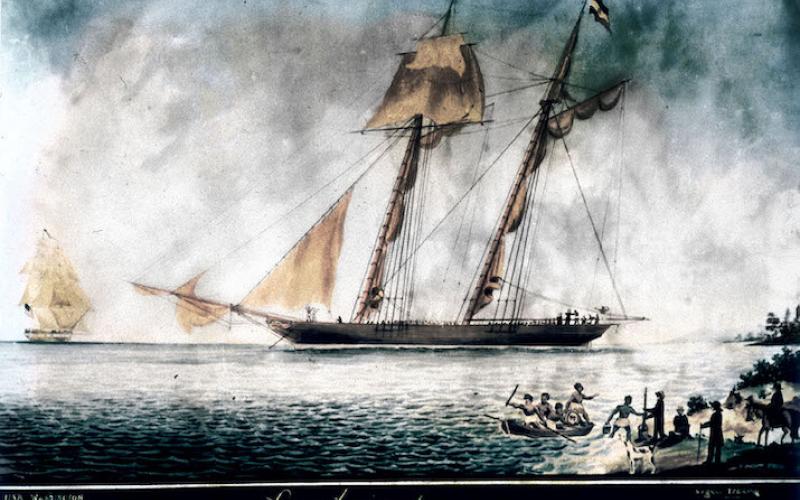In der populären Sitcom „The Big Bang Theory“ gibt es eine Folge, in der einer der Protagonist:innen der Serie, der theoretische Physiker und Vorzeige-Geek Sheldon Cooper, seiner Freundin, der Neurowissenschaftlerin Amy Farah-Fowler, einen seiner absoluten Lieblingsfilme präsentiert: Er selbst habe Jäger des verlorenen Schatzes, den ersten der inzwischen vierteilige Filmreihe um die Abenteuer des Archäologen Indiana Jones, bereits 36 Mal gesehen, gesteht er seiner Freundin in der vierten Episode der siebten Staffel, die im Original den Titel „The Raiders Minimization“ trägt. Der deutsche Titel „Ostereier im Juni“ ist eher irreführend, denn im Mittelpunkt der Episode steht Amy’s Reaktion auf den Lieblingsfilm ihres Freundes, die diesen mitsamt seiner Freunde in eine tiefe Krise stürzt.
Amy gesteht, den Film zwar durchaus unterhaltsam zu finden, weist ihren Freund jedoch darauf hin, dass sein Held Dr. Henry Walton Jones Jr. – wie Indiana Jones mit vollem Namen heißt – für dessen Handlung vollkommen überflüssig sei: Auch ohne sein Zutun wäre die Jagd auf die sagenumwobene Bundeslade, den titelgebenden „verlorenen Schatz“, ganz genauso verlaufen. Ein Affront? Sheldon und seine Freunde bemühen sich den Rest der Folge jedenfalls vergeblich darum, Amy zu widerlegen, am Ende feiern sie ihren Held dafür, dass er wertvolle Kulturgüter ihrer ordnungsgemäßen Verwahrung zuführt. In der letzten Szene von Jäger des verlorenen Schatzes wird die Bundeslade, mittlerweile in eine unscheinbare Kiste verpackt, in einer riesigen Halle abgestellt, die bis unter die Decke mit ähnlich unscheinbaren Kisten vollgestopft ist – Indiana Jones, der größte Abenteurer der Gegenwart, in Wahrheit bloß ein Handlanger biederer Bürokraten?
Selbstverständlich ist Indiana Jones – oder Indy, wie seine Fans ihn liebevoll nennen – kein Handlanger biederer Bürokraten und selbstverständlich ist „The Raiders Minimization“ kein Affront, sondern eine Hommage, die auf ironisch-pointierte Art und Weise ein wesentliches Merkmal des Spielberg’schen Kinokosmos feiert: die perfekte Illusion einer permanenten Gegenwart. Diese Behauptung gilt freilich nur für Spielbergs Popcorn-Kinokosmos – in dem Indiana Jones das erklärte Lieblingskind Spielbergs ist –, aber eben dieser Kosmos kommt im Grunde ganz ohne Geschichte (und in zugespitzter Form auch ganz ohne Helden) aus, ist reine Handlung, die ganz auf die Wucht ihrer spektakulären Bilder setzt. Seine Protagonist:innen erfahren keinerlei Wandlung, sondern kommen aus ihren Abenteuern so heraus, wie sie hinein gegangen sind. Eigentlich dienen sie nur der Dynamik einer visuell-erzeugten Spannung, die in ihrer Konsequenz bis ins Absurde hinein gesteigert wird. Formvollendet findet sich das in der Eröffnungssequenz des zweiten Teils der Reihe, Indiana Jones und der Tempel des Todes von 1984, vorgeführt: Auf der Flucht vor einem finsteren Unterweltboss retten sich Indiana Jones und seine Begleiter in Ermangelung von Fallschirmen mit einem Schlauchboot aus einem abstürzenden Flugzeug. Nach einer atemberaubenden Schussfahrt über Schnee, Stock und Stein „landen“ sie schließlich in einem Dorf, in dem die eigentliche Handlung des Films ihren Anfang nimmt.
Das „Schlauchboot“ – nicht Indy! – ist in meiner Familie generations- wie geschlechterübergreifend zu einem festen Begriff geworden und steht hier gleichsam emblematisch für den Spielberg‘schen (Popcorn-)Kinokosmos.
In Spielbergs Charakterisierung als „Vater des modernen Familienkinos“ schwingt immer auch etwas Herabwürdigendes mit; kulturpessimistische Stimmen sehen in seinem Geschick bei der Inszenierung permanenter Gegenwarts-Illusionen den puren Eskapismus am Werk, der insbesondere in gesellschaftlichen Krisenzeiten greife und von fragwürdigen Motiven wie Nostalgie und Kommerz getragen sei. Tatsächlich hat Spielberg bei der Wiederbelebung der Reihe im Jahre 2008 mit dem Prinzip der permanenten Gegenwart gebrochen: In Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels erfährt dieser, das er einen Sohn hat, zudem sind seine Gegenspieler keine Nazis mehr, sondern mittlerweile Kommunisten. Gut möglich, dass dem Regisseur das Erscheinungsbild seines unverzichtbaren Hauptdarstellers Harrison Ford zu diesem Schritt zwang; denkbar auch, dass nostalgische wie kommerzielle Aspekte hier mit hineinspielten. Fraglos hing eine erfolgreiche Wiederbelebung der Reihe von der Akzeptanz jener Fangruppe ab, die die ersten drei Teile der Reihe in den 1980er Jahren zu Klassikern des modernen Abenteuerfilms gemacht hatte.
Soziologisch zähle ich auch zu dieser Gruppe, subjektiv hat mich der neue, alte, älter gewordene Indiana Jones nicht sonderlich beeindruckt – ich will meinen Indy als Jäger der permanenten Gegenwart, nicht als verantwortungsbewussten Familienvater und auch nicht als Handlanger biederer Bürokraten, die dafür sorgen, dass wertvoller Kulturgüter ihrer ordnungsgemäßen Verwahrung zukommen. Gut möglich, dass auch ich mich für eine solche Forderung des Eskapismus bezichtigen lassen muss. Aber ist nicht das Kino in seinem ganzen Wesen als eskapistisch zu bezeichnen, wenn man Siegfried Kracauer darin folgt, dass „der Film von sich aus [fordert], dass die von ihm gespiegelte Welt die einzige sei“? Für Kracauer hat dieses Wesen per se nichts Verwerfliches, wie er im „Kult der Zerstreuung“ schreibt. Vielmehr habe auch das Popcorn-Kino einen Anteil daran, seinen Zuschauern „die Unordnung der Gesellschaft“ vor Augen zu führen, die diese dann dazu befähige, „jene Spannung hervorzurufen und wachzuhalten, die dem notwendigen Umschlag vorangehen muss“.[1]
Steven Spielberg als Klassenkämpfer zu beschreiben, ginge gewiss zu weit, aber im Sinne einer Definition von Kino, wie Kracauer sie vorschlägt, ist der Vater des modernen Blockbusters mit seinen perfekten Illusionen einer permanenten Gegenwart König und Diener des Kinos zugleich. Auch wenn sich der Trailer zum nunmehr fünften Teil der Reihe, Indiana Jones und der Ruf des Schicksals, der im Sommer in die Kinos kommen wird, abermals auf die Veränderung, ja, man möchte fast sagen: die Vergänglichkeit seines Helden kapriziert, wartet er wieder mit bösen Nazis auf und anstelle seines Sohnes stehen ihm erneut alte Gefährten zur Seite – ich bin gespannt.
[1] Siegfried Kracauer, Kult der Zerstreuung [1926], in: ders., Das Ornament der Masse. Essays, Frankfurt a. Main 1977, S.311-317, hier: S.315f.
Zitation
Tilmann Siebeneichner, Indiana Jones oder: Jäger der permanenten Gegenwart, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/indiana-jones-oder-jaeger-der-permanenten-gegenwart